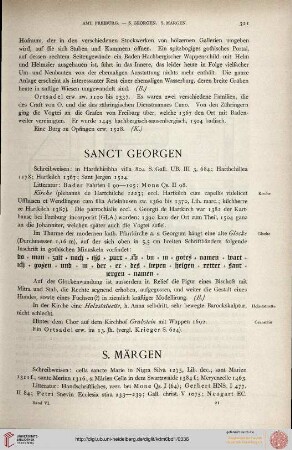Bestand
Sankt Märgen (Bestand)
Überlieferungsgeschichte
Das Augustinerkloster St. Märgen wurde in
wirtschaftlicher Notlage 1370 mit dem Freiburger Augustinerkloster
Allerheiligen vereinigt. Die Äbte waren zugleich Pröpste des
Freiburger Konvents. Nach dem Verkauf fast aller Güter an die Stadt
Freiburg (1462/63) zog der Konvent aus St. Märgen in das Freiburger
Kloster um. Zwischen 1540 und 1713 war das Kloster St. Märgen als
solches überhaupt erloschen. Die unablässigen Bemühungen, den
Besitz und die Abtei zurückzuerwerben, hatten im 18. Jahrhundert
Erfolg: 1717 konnte der Kirchenneubau in St. Märgen begonnen
werden, 1724 bzw. 1729 bezog der Konvent die neuen Klostergebäude.
1806 fiel das Kloster mit dem vorderösterreichischen Breisgau an
Baden und wurde säkularisiert.
Das Archiv bzw. dessen
spärlicher Rest - aus der Zerstreuung der Bibliothek vor Ort wird
man auch auf das Archivschicksal schließen dürfen - gelangte nach
Freiburg und von dort 1807 an das Generallandesarchiv (vgl. Bestand
13). Aus dem Aktenbestand wurden die Spezialia pertinenzmäßig
verteilt, lediglich die auf den Ort St. Märgen bezogenen Akten
blieben bei den Generalia.
Inhalt und
Bewertung
Der Bestand enthält zu knapp zwei
Dritteln Archivalien der beiden Klöster St. Märgen und
Allerheiligen, wobei die Auseinandersetzung mit der Stadt Freiburg
im Vordergrund steht. Der Rest besteht vor allem aus Schriftgut der
vorderösterreichischen Regierung und Kammer und der badischen
Nachfolgebehörden in Freiburg.
Vorwort: Das
Augustinerkloster St. Märgen wurde um 1118 von dem Straßburger
Domherrn und späteren Bischof Bruno v. Hohenberg gegründet. Diese
Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Ausdehnung der Besiedlung auf
den Hochschwarzwald im Spätmittelalter zu sehen. Die Hohenberger
erweiterten so ihren Einfluss vom Zartener Tal bis hinauf an die
Grenzen des von den rivalisierenden Zähringern gegründeten Klosters
St. Peter. Auf die Hohenberger folgten als Klostervögte Anfang des
14.Jh. die Freiburger Familie Turner, dann wechselweise die
Schnewlin und die v. Blumeneck und schließlich das Haus Habsburg.
Mit den beiden Vogtfamilien Schnewlin und v. Blumeneck lag das
Kloster im 14.Jh. in ständigem Streit, bei dem es sogar zur Tötung
zweier Äbte durch die Mannschaft der Vögte kam und der auch eine
Zerrüttung des Besitzstandes des Klosters mit sich brachte. Dies
führte 1370 zu der Vereinigung mit dem im Jahr 1300 durch den
Ritter Johann Ammann v. Waldkirch gegründeten Augustinerkloster
Allerheiligen in Freiburg, das durch Kriegsereignisse ebenfalls in
seinem Bestand gefährdet war. Auch diese Zusammenlegung brachte das
Kloster jedoch nicht aus seiner schwierigen materiellen Lage. So
sah es sich schließlich genötigt, im Jahr 1462 seinen wichtigsten
Besitz an die Stadt Freiburg zu verkaufen, die damit die Grundlage
für die Bildung eines eigenen kleinen Territoriums im Kirchzartener
Tal legen konnte. Der Konvent wurde in das Kloster Allerheiligen in
Freiburg verlegt und 1546 wurde die St. Märgener Abtswürde für
erloschen erklärt. Die Pröpste des Klosters nannten sich nun nur
noch "von Allerheiligen". In der Folgezeit und noch bis in das
18.Jh. versuchte das Kloster auf verschiedenen Wegen, den Verkauf
des Gründungsguts von St. Märgen rückgängig zu machen. Diese
Bemühungen blieben jedoch im Wesentlichen vergeblich. Lediglich
konnte es im Jahr 1699 seinen Meierhof in St. Märgen und später
vereinzelte weitere Besitzungen zurückkaufen. Als 1675 Freiburg an
Frankreich kam und neu befestigt wurde, fiel das Gebäude des
Klosters der Festungsanlage zum Opfer. Der Konvent, der damals nur
noch aus vier Personen bestand, gewann jedoch wieder eine solide
finanzielle Grundlage. So konnte bereits 1717 wieder ein neues
Kloster in Freiburg errichtet werden. Im selben Jahr wurde mit dem
Neubau einer Kirche in St. Märgen begonnen und 1724 bzw. 1729 zog
der Konvent wieder nach St. Märgen, wo inzwischen das neue
Klostergebäude fertiggestellt war. Der Bestand des Klosters an
seinem alten Platz sollte jedoch nur noch von kurzer Dauer sein,
denn am 29.8.1806 wurde es durch Baden säkularisiert. Der
Augustinerorden war eine klösterliche Gemeinschaft von Geistlichen,
die in Pfarreien tätig waren. Von St. Märgen aus wurden z.T. bis zu
dessen Aufhebung die Pfarreien Hüfingen, Wyhl, Haslach,
Scherzingen, Zähringen und die Klostergemeinde St. Märgen selbst
versehen. Zum Gründungsgut gehörte der Dinghof in Zarten, Höfe in
St. Märgen und Güter in Kirchzarten, Burg, Attental, Gottenheim und
Merdingen, zu dem bald auch weitere Besitzungen in Hüfingen,
Waltershofen, Niederrimsingen, Mengen, Tiengen und Endingen (von
Allerheiligen) dazukamen. Auch in anderen Orten des Breisgaus und
im EIsass bestand Streubesitz. Nach der Krise des Klosters, dem
Verkauf der wichtigsten seiner Besitzungen und der Verlegung nach
Freiburg konnte es erst bis Anfang des 18.Jh. seine Besitzgrundlage
wieder verbreitern. Im 18.Jh. besaß es vor allem den
zurückgekauften Meierhof in St. Märgen, sowie Lehengüter in
Merdingen, Waltershofen, Gundelfingen, Wyhl und Gottenheim und
einzelne weitere Besitzungen in Wyhl, Zähringen, Freiburg,
Merdingen, Kiechinsbergen und Herdern. Der ertragreichste Besitz
waren jedoch die Zehntrechte in St. Märgen, Wyhl, Haslach,
Scherzingen und Zähringen. Als das Kloster an Baden fiel, wurde der
Wert seines Besitzes immerhin mit 300000 fl. angegeben. Im
September 1806 wurde das Aktenarchiv des Klosters an die Regierung
und Kammer nach Freiburg geschickt (61/1881 Nr.37 63), von wo aus
es an das Generallandesarchiv nach Karlsruhe weitertransportiert
wurde. Über die Urkunden und anderen Archivalien findet sich keine
Nachricht, aber vermutlich wurden sie zur gleichen Zeit nach
Karlsruhe gebracht. Das Archiv sortierte die Akten und lieferte dem
Geheimen Rat ein Verzeichnis der Beraine und Einzugsregister, sowie
der neueren Akten, die noch nicht archivwürdig waren (101/1). Diese
Akten wurden der Regierung und Kammer zu Freiburg überlassen,
während bei den Berainen lediglich das Verzeichnis abgegeben wurde.
Bei Bedarf sollten dann für die Verrechnungen Abschriften der
Beraine gefertigt werden. Entsprechend der Prinzipien der
Archivordnung und Bestandsbildung im Generallandesarchiv wurden die
Archivalien des Klosters dann auseinandergetrennt. Der vorliegende
Bestand beinhaltet die Generalakten des Klosters und die
Spezialakten über die Gemeinde St. Märgen. Außerdem sind die
diesbezüglichen Akten vorderösterreichischer Provenienz und auch
Akten großherzoglich badischer Behörden eingereiht (s.
Provenienzliste). 56% der Akten stammen von St. Märgen, 10% von
Allerheiligen, 18% von vorderösterreichischen Behörden, 13% von
badischen Behörden und 3% von Sonstigen. Wie in den meisten
Beständen des Historischen Archivs des Generallandesarchives
entstammt der Hauptteil der Überlieferung dem 18.Jh. (55%). Je 1%
beziehen sich auf das 12. und 13.Jh., 2% auf das 14.Jh., 6% auf das
15.Jh., 8% auf das 16.Jh., 14% auf das 17.Jh. und 13% auf das
19.Jh. Der Bestand wurde 1938 von Albert Siebert durch ein
Zettelrepertorium erschlossen. Dieses wurde von Unterzeichnetem
überarbeitet, durch Umfangs- und Provenienzangaben erweitert und
mit Indizes versehen. Die Herstellung des Findbuches erfolgte im
Rahmen des Midosa-Projektes der Landesarchivverwaltung mit Hilfe
der EDV. Karlsruhe, im Januar 1990 R. Rupp
Literatur: St. Märgen.
Festschrift zur 850-Jahr-Feier, St. Märgen 1968
- Reference number of holding
-
Abt. Generallandesarchiv Karlsruhe, 101
- Extent
-
118 Akten
- Context
-
Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Generallandesarchiv Karlsruhe (Archivtektonik) >> Ältere Bestände (vornehmlich aus der Zeit des Alten Reichs) >> Akten >> Kleinere geistliche Territorien >> St. Märgen
- Related materials
-
Rainer Brüning/Gabriele Wüst (Bearb.), Die Bestände des Generallandesarchivs Karlsruhe, Teil 6, Bestände des Alten Reiches, insbesondere Generalakten (71-228), Stuttgart 2006, S. 202.
- Date of creation of holding
-
[1125]-1864
- Other object pages
- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs
- Last update
-
03.04.2025, 11:03 AM CEST
Data provider
Landesarchiv Baden-Württemberg. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Bestand
Time of origin
- [1125]-1864