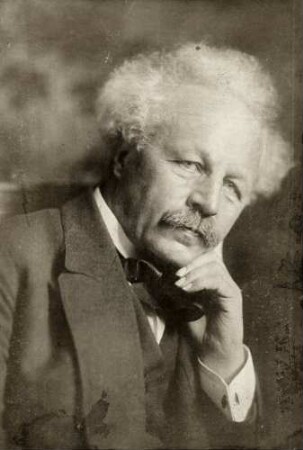Bestand
Nachlass Oskar Muser (1850-1935), bad. Landtagsabgeordneter (Bestand)
Überlieferungsgeschichte
1973 Geschenk von Dr. Eckhardt Muser
Inhalt und Bewertung
Reden,
Zeitungsartikel zu seiner politischen Tätigkeit.- Korrespondenz
u.a. mit Theodor Barth, Friedrich Naumann, Berta von
Suttner
1. Vorwort: Oskar Muser wurde
am 28. April 1850 in Offenburg als einer von fünf Söhnen des
Kreisgerichtsregistrators in Offenburg und Freiburg im Breisgau,
Jacob Muser, geboren. Er besuchte die Gymnasien in Offenburg und
Freiburg im Breisgau und legte 1869 das Abitur ab. Unterbrochen
durch seine Teilnahme am Deutsch-Französischen Krieg 1870/71
studierte Muser anschließend bis 1873 Rechtswissenschaften an der
Universität Freiburg. Nach Anstellungen als Rechtspraktikant und
Referendar in Schwetzingen und Karlsruhe arbeitete er ab 1878 als
Rechtsanwalt in Offenburg und wurde dort Stadtverordneter. Aus
seiner 1877 geschlossenen Ehe mit Lina von Pötz gingen zwei Töchter
und ein Sohn hervor. Von 1889 bis 1897 und erneut von 1899 bis 1919
war Muser für die Freisinnige Volkspartei (FVP), dann für die
Fortschrittliche Volkspartei (FVP) und schließlich für die Deutsche
Demokratische Partei (DDP) Mitglied der zweiten Kammer des
Badischen Landtags (Wahlbezirk Offenburg-Stadt). 1911-1918 hatte er
das Amt des Fraktionsvorsitzenden der FVP inne. In den Sessionen
des 45. Landtags 1911/12 amtierte Muser als zweiter Vizepräsident.
In der badischen Nationalversammlung war Muser 1919 zweiter
Vizepräsident, stellvertretender Alterspräsident und Mitglied des
Verfassungsausschusses. Bereits zu Beginn seiner parlamentarischen
Tätigkeit machte sich Muser durch seine dezidiert
liberaldemokratischen Ansichten in der Auseinandersetzung um die
Sozialistengesetze einen Namen als "liberales Gewissen" und galt
schnell als profiliertester demokratischer Politiker Badens.
Gleichwohl lehnte er elementare Punkte des Programms der SPD wie
die Klassenkampftheorie oder deren dogmatischen Kollektivismus ab
und warb stattdessen für sein Modell der "Sozialen Demokratie", das
am Konkurrenzprinzip und Privateigentum festhielt und soziale
Sicherheit durch die Gründung von Großgenossenschaften garantieren
sollte. Des Weiteren trat Muser für die rechtliche Gleichstellung
der Frauen ein, wobei er deren Wahlrecht und deren Recht auf
Bildung befürwortete. Außerdem setzte er sich für die Schaffung
eines laizistischen Staats ein, in dem nicht nur Staat und Kirche,
sondern auch Schule und Kirche getrennt sind, wodurch er vor allem
den Widerstand der katholischen Kirche und des Zentrums auf sich
zog. Nachdem Muser 1919 wegen Differenzen um das neue Schulgesetz
sein Landtagsmandat niedergelegt hatte, betätigte er sich in erster
Linie publizistisch und als Redner für die DDP. Allgemein geachtet
und mit führenden linksliberalen Politikern seiner Zeit in Kontakt
stehend (u. a. Eugen Richter, Friedrich Naumann, Friedrich von
Payer, Theodor Barth), lebte Muser zurückgezogen in Offenburg, wo
er am 25. Juni 1935 starb.
2. Zur Ordnung: Muser hatte
in seinen letzten Lebensjahren den Versuch unternommen, sein
Schriftwerk systematisch zu ordnen. Den Anstoß dazu gab zu einem
nicht geringen Teil die "Machtergreifung" durch die
Nationalsozialisten. Die Niederschriften zum Wesen der Demokratie,
zur Verfassungsentwicklung u. a. waren als Rechenschaft über seine
politische Überzeugung für seine Nachkommen gedacht. In diese, fast
immer diktierten Manuskripte wurden die älteren Materialien
eingearbeitet, wobei freilich manche Zusammenhänge verloren gingen.
Weitere Eingriffe nach Musers Tod wirkten vollends zerstörend. Für
die archivische Ordnung ergab sich daraus die Notwendigkeit, zwei
Hauptgruppen zu bilden: 1) Die Fragmente des älteren Schrifttums,
vor allem die frühen Veröffentlichungen und Reden der
Abgeordnetenzeit, soweit sie isoliert aufbewahrt waren (Abschnitte
A-B) 2) Die späteren, unter Stichworten angelegten Hefte, in denen
frühere Notizen und Schriften als Beilage rangieren (Abschnitte
C-F). Der Nachlass wurde dem Generallandesarchiv 1973 von
Ministerialrat Dr. Eckhardt Muser als Eigentum übergeben. Er
umfasste damals vier Kartons mit 45 Faszikeln. 1982 wurden weitere
zwei Kartons abgegeben, die im Frühjahr 1991 von Gabi Dub
verzeichnet wurden. Der Nachlass umfasst nun sechs Archivboxen mit
56 Faszikeln. Der Nachlass wurde 1976 von Konrad Krimm erschlossen
und verzeichnet. Die Übertragung des analogen Findmittels in ein
Online-Findmittel erfolgte 2017 durch René Gilbert im Rahmen eines
von der Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg finanzierten Projekts.
Zusätzlich versah Gilbert den Bestand mit Orts- und
Personenindizes.
3. Quellen und Literatur:
Quellen: "Muser, Oskar", Dienerakte, GLA 234 Nr. 2837 [Laufzeit:
1869-1930] Literatur: Kremer, Hans-Jürgen: Muser, Oskar, in:
Badische Biographien, Neue Folge, Bd. 2, hg. von Bernd Ottnad,
Stuttgart 1987, S. 207-209
- Reference number of holding
-
Abt. Generallandesarchiv Karlsruhe, N Muser
- Extent
-
56 Akten
- Context
-
Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Generallandesarchiv Karlsruhe (Archivtektonik) >> Nichtstaatliches Archivgut >> Nachlässe >> Andere Nachlässe >> Muser
- Indexentry person
- Date of creation of holding
-
1875-1935
- Other object pages
- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs
- Last update
-
03.04.2025, 11:03 AM CEST
Data provider
Landesarchiv Baden-Württemberg. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Bestand
Time of origin
- 1875-1935