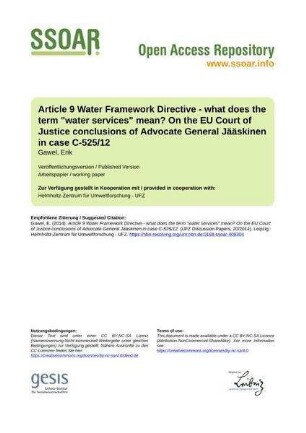Artikel
Zur Neuen Politischen Ökonomie der deutsch-deutschen Währungsunion
Die Entscheidung für die deutsch-deutsche Währungsunion im Frühjahr 1990 und deren anschließende Ausformung hinsichtlich des Zeitpunktes und der Umstellungskurse stand unter dem Primat der Politik; den Bedenken der wissenschaftlichen Ökonomik wurde wenig bis keine Beachtung geschenkt. Eine solche Konstellation legt die Untersuchung dieser Entscheidungsphase mit dem analytischen Instrumentarium der Neuen Politischen Ökonomie nahe. Die Bundesregierung bewegte sich als Hauptakteur auf drei Feldern: Außenpolitisch galt es, die DDR aus der Blockbindung an die UdSSR und den Warschauer Pakt zu lösen – eine Option, die seinerzeit als ein vorübergehendes "window of opportunity" wahrgenommen wurde. Mittel hierzu war eine Änderung der Unterstützungsstrategie und eine Erhöhung des maximalen Unterstützungsvolumens durch das Angebot einer Währungsunion. Schon vor der staatsrechtlichen Vereinigung wurde eine in ihren Strukturen gesamtdeutsche Innenpolitik betrieben. Die ostdeutschen (Proto-)Parteien boten im Wahlkampf zur Volkskammerwahl im März 1990 weitgehend gleichlautende Pläne zur Währungsunion (dem offensichtlichen Hauptinteresse der Medianwähler) an. Der erdrutschartige Sieg der Ost- CDU in der Volkskammerwahl muß als eine Entscheidung für deren Partner, die westdeutsche (Regierungs-)Partei CDU verstanden werden. Kann eine Partei im Wahlkampf einen höheren Faktor "Durchsetzungsmacht" für ihr Wahlprogramm bieten, der auf ihrer größeren ideologischen Nähe zur Regierung des wichtigsten ausländischen Partnerlandes basiert, entsteht für die Bürger ein Anreiz, strategisch zu wählen, wie ihn das Medianwählermodell standardmäßig nicht kennt. Um eine Währungsunion glaubhaft anbieten zu können, mußte sich die Bundesregierung zudem noch über die Bedenken der Bundesbank hinwegsetzen. Eine vollkommen unabhängige Zentralbank, deren Leitung in erster Linie Prestigemaximierung durch Inflationseindämmung betreibt, hätte keine Anreiz, ihre Bedenken hinsichtlich der Inflationsgefahren einer Währungsunion zurückzustellen. Da die Bundesbank aber in Fragen der Währungsverfassung und der Wechselkurse von Regierung und Parlament abhängig ist, mußte sie sich entscheiden, entweder durch weiteren Widerstand ihr Ansehen aus der Inflationseindämmung zu maximieren oder ihr (nach 40 Jahren mittlerweile autonomes) Ansehen aus der Unabhängigkeit nicht dadurch zu gefährden, daß die Bundesregierung sich über ihren Widerstand hinweggesetzt hätte. Dieses Dilemma erklärt die schnelle Zustimmung der Bundesbank zu den Währungsunionplänen der Bundesregierung als Entscheidung für eine von zwei gleichermaßen unbequemen Alternativen.
- Sprache
-
Deutsch
- Erschienen in
-
Journal: Kredit und Kapital ; ISSN: 0023-4591 ; Volume: 29 ; Year: 1996 ; Issue: 1 ; Pages: 1-31
- Klassifikation
-
Wirtschaft
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Gawel, Erik
Thöne, Michael
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Duncker & Humblot
- (wo)
-
Berlin
- (wann)
-
1996
- DOI
-
doi:10.3790/ccm.29.1.1
- Letzte Aktualisierung
- 10.03.2025, 11:44 MEZ
Datenpartner
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Artikel
Beteiligte
- Gawel, Erik
- Thöne, Michael
- Duncker & Humblot
Entstanden
- 1996