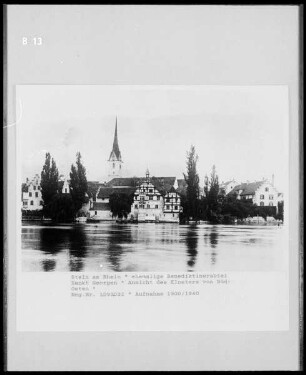Bestand
Sankt Georgen, Kloster, Amt und Ort (Bestand)
Überlieferungsgeschichte
Die Vogtei des Benediktinerklosters St. Georgen
hatten im 16. Jahrhundert die Herzöge von Württemberg inne. Mit der
Einführung der Reformation wurden die Mönche 1536 aus St. Georgen
vertrieben und ließen sich in Villingen nieder. Den Anspruch auf
St. Georgen ließ der Konvent aber auch nach dem Scheitern der
kurzfristigen Restitutionen bis zum Ende des Alten Reiches nicht
fallen. Das Kloster St. Georgen in Villingen behielt die Rechte und
Besitzungen in Österreich, der Schweiz und im Elsaß, während das
neugebildete württembergische Klosteramt St. Georgen den
Klosterbesitz in Württemberg verwaltete (vgl. Bestand 12). Unter
den von St. Georgen aus gegründeten Klöstern ist wegen der
regelmäßigen Visitationen vor allem das Frauenkloster Amtenhausen
zu nennen. Aufsichtsfunktionen besaß St. Georgen auch gegenüber
Klöstern im Elsaß und in Lothringen.
Der Ort St. Georgen
fiel 1810 an Baden. Bereits 1805 war das Kloster St. Georgen in
Villingen aufgehoben worden und zuerst an Württemberg, ein Jahr
später an Baden gekommen.
Inhalt und
Bewertung
Der Bestand enthält neben einigen
Vorakten aus der St. Georgener Zeit vor allem die Generalakten des
Klosters in Villingen. Da im Generallandesarchiv die alten
Signaturen des Kloster-"Hauptarchivs" (HA) ausnahmsweise
mitverzeichnet wurden, ist die direkte Verknüpfung zu dem bis auf
Vorgangsebene reichenden Repertorium vom Ende des 18. Jahrhunderts
(GLA 68/506) möglich. Der Kernbestand wird ergänzt durch Akten
württembergischer Provenienz über das Klosteramt und den Ort St.
Georgen. Weitere Archivalien des Klosters und des Klosteramtes
befinden sich im Hauptstaatsarchiv Stuttgart Bestand A 521 und A
521 L.
Geschichte von St. Georgen:
Die Adligen Hezelo, der im Investiturstreit zur gregorianischen
Partei gehörte und Vogt der Reichenau war, sowie Konrad und Hesso,
die 1083 ein Benediktinerkloster in Königseggwald (bei Saulgau)
gründen wollten, verlegten auf Verlangen des Hirsauer Abtes Wilhelm
ihre Stiftung nach dem heutigen Sankt Georgen. Schon die Amtszeit
des Abtes Theoger(1088-1118) führte das Kloster in eine Blütezeit,
die bis zur Säkularisation nicht mehr erreicht wurde und die sehr
mit der Person dieses bedeutenden Abtes verbunden war. Hirsauisch
geprägte Reformideen verliehen dem Kloster eine Ausstrahlungskraft,
die zu Kontakten mit zahlreichen Benediktinerklöstern führte. Auch
die Beziehungen des Klosters in den lothringischen Raum, die bis in
das 18.Jahrhundert bestanden, stammen aus dieser Zeit. Die
Besitzungen des Klosters waren ursprünglich weit gestreut. Bis zum
15.Jahrhundert fand jedoch eine Besitzverdichtung statt, deren
Kernbereich im Quellgebiet von Donau und Neckar und in den
Schwarzwaldtälern im Einzugsbereich des Klosters lag. Die
Vogtsrechte über das Kloster gingen von den Stifterfamilien über
verschiedene Hände schließlich 1444/1532 ganz auf Württemberg über.
Württemberg begann durch wiederholte Eingriffe, das Kloster trotz
dessen behaupteter Reichsunmittelbarkeit zu einer landständigen
Einrichtung zu machen. 1536 führte Herzog Ulrich die Reformation
ein und die Mönche wurden vertrieben. Damit setzte eine lange Zeit
der Auseinandersetzungen mit Württemberg ein, die nach
verschiedenen Restitutionen nach dem Augsburger Interim 1548 und
während des Dreißigjährigen Krieges schließlich damit endete, dass
Württemberg die in seinem Hoheitsgebiet liegenden Besitzungen des
Klosters einschließlich Sankt Georgens in seinen Händen behielt,
während das Kloster Sankt Georgen seinen Sitz in seinen vormaligen
Pfleghof in Villingen verlegte und den Zugriff auf seine außerhalb
Württembergs liegenden Besitzungen behauptete. Diese Besitzungen
reichten als Existenzgrundlage und ermöglichten es dem Kloster in
Villingen in der ersten Hälfte des 18.Jahrhunderts eine neue
Klosteranlage und ein Gymnasium zu errichten. Trotz der weiterhin
von Klosterseite behaupteten Reichsunmittelbarkeit war Sankt
Georgen faktisch nun ein österreichischer Landstand bis es 1805 im
Frieden von Preßburg an Württemberg und 1806 im Tausch an Baden
fiel. Als Herzog Christoph v. Württemberg 1556 erneut die
Reformation in Sankt Georgen einführte und die Mönche schließlich
1566 vertrieb, wurde eine evangelische Klosterordnung errichtet. Es
wurde eine Klosterschule eingerichtet, die allerdings nur im
16.Jahrhundert bestand. Die evangelischen Äbte oder Prälaten, die
dem katholischen Abt in Sankt Georgen nachfolgten und die bis 1806
eingesetzt wurden, residierten jedoch nur zu Anfang in Sankt
Georgen. Später hielten sie sich dann in Alpirsbach auf und waren
in Sankt Georgen durch einen ständigen Vikar vertreten. Die
weltliche Verwaltung der in Württemberg liegenden Güter des
Klosters war einem Klosteramtmann übertragen. Er übte die
staatlichen Hoheits- und Verwaltungsaufgaben in den Klosterorten
aus und verwaltete den Klosterbesitz. Zum Klosteramt Sankt Georgen
gehörten die Orte Sankt Georgen, Oberkirnach, Brigach, Peterzell,
Langenschiltach, Stockburg, Schabenhausen, Wildenstein,
Mönchweiler, Bühlingen und Rotenzimmern. Vorgesetzte Behörde war
der Kirchenrat in Stuttgart. 1806 wurde das Klosteramt aufgehoben
und ein Kameralamt eingerichtet. Dieses fiel 1810 an Baden. Die
Gemeinde Sankt Georgen hat sich aus einer Ansiedlung beim Kloster
entwickelt. 1500 wurde ihr das Marktrecht verliehen. 1633 wurde sie
mitsamt dem Klostergebäude zerstört. Sie blieb jedoch, da sie mit
dem Marktrecht ausgestattet und Sitz des Klosteramtes war,
zentraler Ort und konnte nach dem Dreißigjährigen Krieg langsam
wieder ihre frühere Stellung einnehmen. Das Stadtrecht erhielt sie
allerdings erst 1891.
Bestandsgeschichte: Der
vorliegende Bestand ist im Laufe des 19.Jahrhunderts nach dem im
Generallandesarchiv damals angewandten Pertinenzprinzip gebildet
worden. Es wurden aus sämtlichen Archiven der in den Jahren nach
1802 an Baden gekommenen Territorien und Institutionen hier
diejenigen Akten zusammengefaßt, die das Kloster, das Klosteramt
und die Gemeinde Sankt Georgen betrafen. Derartige Mehrfachbetreffe
waren bei der Bestandsbildung im Generallandesarchiv häufig (z.B.
Bestand 97 Säckingen, Stift und Amt, Bestand 103 Sankt Trudpert und
Münstertal, Bestand 171 Pforzheim Stadt und Amt). In all diesen
Fällen decken sich jedoch die gewählten Betreffe, sie beziehen sich
auf den selben topographischen Raum. Dies ist bei dem vorliegenden
Bestand nicht der Fall - die Überlieferung über das Kloster bezieht
sich auf den in Villingen beheimateten Konvent und dessen
Besitzungen in den Österreichischen Landen, während die
Überlieferung über das Klosteramt die Gemeinde Sankt Georgen und
die umliegenden Klosterorte im württembergischen Besitz betrifft.
Die Bildung dieses Bestandes stellt also in gewisser Hinsicht einen
Bruch mit den bei der Bestandsbildung in den Aktenbeständen des
Historischen Archivs gültigen, in der Brauer'schen Archivordnung
niedergelegten Grundsätzen dar, denn danach sollten Bestände nach
jeweils einem topographischen Betreff gebildet und voneinander
abgegrenzt werden, während der vorliegende Bestand zwei
verschiedene topographische Betreffe hat. Diese Unstimmigkeit bei
der Bestandsbildung ist natürlich auf die eingangs geschilderte
besondere Geschichte des Klosters zurückzuführen und ein Teil der
überlieferung vor dem entgültigen Verlust des alten Klostersitzes
in Sankt Georgen im Jahr 1648 mit dem Westfälischen Frieden bezieht
sich auch noch auf die später württembergischen Orte. Der
überwiegende Teil betrifft jedoch topographisch die
österreichischen Lande. Der Bestand umfasst 667 Faszikel in 8 lfd.
m und hat eine Laufzeit von 1178-1860. Er wurde 1923 von Albert
Krieger durch ein Zettelrepertorium erschlossen. Dieses wurde von
Unterzeichnetem unter Verwendung des MIDOSA-Progammes überarbeitet.
Hierbei wurde der Umfang der einzelnen Faszikel angegeben, wobei
bei Akten mit Blattzählung oder einem Umfang von bis zu etwa 10
Blatt die Blattzahl angegeben wurde, bei sonstigen Akten unter 1 cm
Umfang die Bezeichnung "1 Fasz." steht, und bei Akten ab 1 cm
Umfang die Zentimeterzahl in Schritten von 0,5 cm angegeben ist. 1
cm entspricht etwa 50 Blatt (bei Hadernpapier), so dass sich durch
diese Angaben der ungefähre Umfang eines Aktenheftes berechnen
lässt. Außerdem wurde die Provenienz (des letzten angefallenen
Schriftstücks) ermittelt und die Filmsignatur hinzugefügt. Die
Aktentitel wurden modernisiert und im Einzelfall durch weitere
Inhaltsvermerke erweitert und durch Indices erschlossen. Krieger
hatte die von ihm verfassten Aktentitel nach den Stichworten des
Brauer'schen Rubrikensystems geordnet. Dabei ergab sich aufgrund
der oben skizzierten Inkonsequenz bei der Bestandsbildung die
Schwierigkeit, dass sich bei vielen Titeln, in denen z.B. von
Kloster, Klosteramt, Abt oder Klosterorten die Rede war, nicht ohne
weiteres erkennen ließ, ob sie sich auf Württemberg oder auf das
Kloster in Villingen beziehen. Aus diesem Grund wurden die
Aktentitel völlig neu geordnet. Es wurden zwei Abteilungen
gebildet, wobei die eine die Akten über das Kloster enthält, die
andere die Akten über das württembergische Klosteramt und seinen
Bereich umfasst. Es wurde dabei nicht versucht, Provenienzbestände
herzustellen- beide Abteilungen enthalten verschiedene
Provenienzen- sondern es sollten entsprechend dem Brauer'schen
Prinzip die verschiedenen topographischen Betreffe hergestellt
werden. In den Provenienzverhältnissen der so entstandenen beiden
Abteilungen des Bestandes spiegeln sich aber natürlich dennoch die
herrschaftlichen Verhältnisse der beiden Bereiche.
Bearbeiterbericht: Der Serie
der nach der Brauer'schen Rubrikenordnung geordneten Aktentitel
folgte bei Krieger eine Gruppe mit Akten, die sich auf
nichtbadische Orte bezog. Sie wurde von ihm mit einer neuen Zählung
beginnend mit "A 1" versehen. Die Orte betrafen teilweise Klöster,
die unter Aufsicht des Klosters Sankt Georgen standen, und
teilweise Besitzungen des Klosters, die nicht im Bereich des
späteren Großherzogtums Baden lagen. Teilweise war der Besitz
dieser Orte mit Württemberg umstritten, so dass diese Akten nur bis
in das 17.Jahrhundert reichen und provenienzmäßig oft mit
württembergischen Akten vermischt sind. Die Akten über die in Baden
liegenden Besitzungen des Kloster sind in den entsprechenden
Ortsakten (vor allem in Bestand 229) des Generallandesarchivs zu
suchen. Bei der Neuordnung wurden die Akten aus dem Klosterarchiv
der Serie über die allgemeinen Akten über das Kloster unter der
Bezeichnung "Nichtbadische Orte" nachgestellt. Die Akten über die
unter Aufsicht stehenden Klöster wurden jedoch unter die Rubrik
"Stifter und Klöster" eingereiht. Akten rein württembergischer
Provenienz wurden unter der Abteilung "württ. Klosteramt"
eingereiht. Da es sich nur um sehr wenige Akten handelte, wurde
hier keine eigene Serie "Nichtbadische Orte" gebildet, sondern die
Aktentitel finden sich unter der jeweils zutreffenden Sachrubrik.
Die Akten sind im Ortsregister nachgewiesen. Die Abteilung "Kloster
Sankt Georgen" besteht zu 96% (422 Akten) aus Akten, die aus dem
Klosterarchiv stammen. Das Klosterarchiv hatte in der zweiten
Hälfte des 18.Jahrhunderts eine mustergültige Neuordnung erfahren.
Das erhaltene Archivinventar (Signatur: 68/506) gliedert das sog.
Hauptarchiv nach Sach- und Ortsbetreffen in 48 Laden, die wieder in
Faszikel aufgeteilt waren, die innerhalb einer Lade durchgezählt
wurden und deren Überschrift angegeben wurde. Innerhalb der
Faszikel wurden die einzelnen Schreiben quadranguliert. Auch der
Inhalt der einzelnen Schreiben ist im Archivinventar angegeben, so
dass hier ein Findmittel vorliegt, das in seiner Erschließungstiefe
nichts zu wünschen übrig lässt. Auch die alten Deckblätter der
Faszikel, die sich vereinzelt noch vorfinden, waren derart
ausführlich beschriftet (siehe S.312). Der Gedanke lag daher nahe,
dieses Findmittel der Neuverzeichung zu Grunde zu legen. Es zeigte
sich jedoch bald, dass nur ein Teil der Akten mit den Signaturen
des Klosterarchivs versehen und in dem Archivinventar feststellbar
war. Bei Abschluss der Arbeiten ergab sich, dass es sich etwa um
drei Viertel der Akten des Klosterbestandes handelt. Diese Akten
waren zwar zumeist mit den Signaturen das Archivinventars versehen,
aber häufig waren diese unvollständig und es fehlten Schriftstücke,
die im Verzeichnis aufgeführt waren oder es waren Schriftstücke aus
Faszikeln mit anderer Signatur enthalten. So wäre doch ein
Arbeitsaufwand erforderlich gewesen, der über das hinausging, was
im Rahmen dieser Arbeit geplant war. Die Signaturen des
Klosterarchivs sind jedoch bei den einzelnen Aktentiteln angegeben
und das zitierte Archivinventar kann daher auch so als nützliches
Zusatzhilfsmittel für die Benützung dieses Bestandes dienen. Die
Signaturen sind nach folgendem Schema gebildet: "HA (=Hauptarchiv)
Arca (=Lade) Fasz. Quadrangel. Die Zahlen sind z.T. lateinisch,
z.T. arabisch wiedergegeben. Bei den einzelnen Titelaufnahmen
wurden sie nun der Einheitlichkeit halber alle arabisch
wiedergegeben. Außerdem sind Leerstellen durch Nullen aufgefüllt,
um die Erstellung der Konkordanz der alten Signaturen des
Klosterarchivs (siehe S.299) durch die EDV zu ermöglichen. Eine
Reihe von Akten des Klosterarchivs sind mit Akten württembergischer
Provenienz vermischt. Im Einzelfall tragen sogar Akten rein
württembergischer Provenienz Signaturen des Klosterarchivs. Dies
trifft besonders auf einzelne Akten über nichtbadischen Besitz des
Klosters zu und dürfte auf die lange strittigen Besitzverhältnisse
zurückzuführen sein. Die Akten über das Kloster, die nicht dem Klo
sterarchiv entstammen, verteilen sich auf österreichische
Provenienzen (7 Akten/1,6 %) und sonstige Provenienzen (2 Akten/0,5
%). Die 5 Akten (1,2 %), die badischen Behörden entstammen,
beziehen sich vor allem auf die Aufhebung des Klosters und die
Nutzung der Gebäude und ihres Inhalts. Bei 3 Akten (0.7 %) konnte
die Provenienz nicht geklärt werden. Die zeitliche Schichtung der
Überlieferung über das Kloster ergibt folgendes Bild: ca.17 % der
Akten enthält Schriftverkehr vor 1600. Davon liegen etwa drei
Viertel vor 1566, dem Jahr der zweiten Vertreibung des Konvents.
Etwa 43 Prozent enthält Überlieferung des 17.Jahrhunderts, etwa 37%
des 18.Jahrhunderts und etwa 3% des 19.Jahrhunderts. Ungewöhnlich
gegenüber den anderen Beständen des Generallandesarchivs ist hier
der hohe Anteil für die zeit vor 1600 und für das 17.Jahrhundert.
Vermutlich hängt diese Überlieferungslage mit den langwierigen
Streitigkeiten des Klosters mit Württemberg zusammen, die in diesen
Zeitraum fallen. Die Abteilung, die das württembergische Klosteramt
und seinen Bereich und die Gemeinde Sankt Georgen betreffen,
bestehen überwiegend aus Akten württembergischer Provenienz. 81,5%
(185 Akten) entstammen diesem Bereich, wobei die größte Gruppe der
Kirchenrat bildet, während vom Oberrat (und später Regierungsrat)
und dem Klosteramt selbst nur wenige Akten vorhanden sind. Diese
Akten sind im Rahmen von Archivalientauschmaßnahmen im
19.Jahrhundert von Württemberg an Baden abgegeben worden. 14,1% (32
Akten) entstammen der großherzoglich badischen Zeit nach 1810.
Nicht geklärt werden konnte die Provenienz bei 4,4% (10 Akten)
dieser Abteilung. Die zeitliche Schichtung der Überlieferung ergibt
folgendes Bild: 9% der Akten enthält Überlieferung des
16.Jahrhunderts, 23,5% des 17.Jahrhunderts, 35% des 18.Jahrhunderts
und 32,5% des 19.Jahrhunderts. Der vergleichsweise hohe Anteil von
Akten des 19.Jahrhunderts liegt daran, dass noch verhältnismäßig
viele Akten über das Kameralamt Sankt Georgen enthalten sind und
dass die badischen Akten über diesen Bereich noch bis 1860 reichen.
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass sich sowohl über das
Kloster als auch über das württembergische Klosteramt Sankt Georgen
weiteres Archivgut im Hauptstaatsarchiv Stuttgart befindet. Es
handelt sich um die Bestände A 521 und A 521 L. Sie beinhalten
sowohl älteres Schriftgut des Klosters selbst, das bei dessen
Aufhebung bzw. Vertreibung in württembergische Hände geraten ist,
als auch Schriftgut des württembergischen Klosteramts und
Ausleseschriftgut württembergischer Zentral und Lokalbehörden
hierüber. Karlsruhe, im März 1995 Reinhold Rupp
- Reference number of holding
-
Abt. Generallandesarchiv Karlsruhe, 100
- Extent
-
633 Akten (Nr. 1-502 und Nr. A 1-A 159)
- Context
-
Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Generallandesarchiv Karlsruhe (Archivtektonik) >> Ältere Bestände (vornehmlich aus der Zeit des Alten Reichs) >> Akten >> Kleinere geistliche Territorien >> St. Georgen, Kloster, Amt und Ort
- Related materials
-
Rainer Brüning/Gabriele Wüst (Bearb.), Die Bestände des Generallandesarchivs Karlsruhe, Teil 6, Bestände des Alten Reiches, insbesondere Generalakten (71-228), Stuttgart 2006, S. 199-201
- Date of creation of holding
-
[1178]-1860
- Other object pages
- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs
- Last update
-
03.04.2025, 11:03 AM CEST
Data provider
Landesarchiv Baden-Württemberg. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Bestand
Time of origin
- [1178]-1860