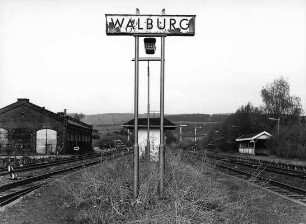Baudenkmal
Sachgesamtheit Lenoirstift; Hessisch Lichtenau, Lenoirstraße 1, Fahrlücke , Im Teich , Lenoirstraße 2, Lenoirstraße 3, Lenoirstraße 4, Teichwäldchen
Zwischen Hessisch Lichtenau und Fürstenhagen befindet sich, von der B 7 einsichtig, das Lenoirstift, eine innerhalb eines parkartigen Geländes angelegte Bautengruppe, deren Teile als Sachgesamtheit anzusprechen sind. Es sind dies zum einen drei Gebäude, die zu Beginn des 20. Jhs. im Auftrag der Kasseler Brüder Lenoir als Waisenhäuser erbaut wurden, zum anderen das wenig abseits befindliche Mausoleum der Stifterfamilie. Die angesprochenen Bauten entstanden von 1907 bis 1913.Schon 20 Jahre nach Inbetriebnahme des Heimes schlossen sich 1927 dessen Pforten infolge akuten Geldmangels. Während des „lll. Reiches" wurden die Gebäude bis 1939 als Kindererholungseinrichtung, danach als Reservelazarett genutzt. Im Spätsommer 1940 übernahm die Werksleitung der benachbarten Munitionsfabrik Hirschhagen (siehe Hessisch Lichtenau, S. 422) von der Stadt Kassel die Belegung der Bauten. Ein Haus bewohnten Angestellte des Werkes, in den übrigen Gebäuden wurden vorübergehend Arbeiterinnen des Werkes untergebracht, die im Spätherbst in das benachbarte Lager Waldhof übersiedelten. In eines der daraufhin leer stehenden Gebäude zogen andere weibliche Angestellte ein; andere Räume dienten als Gemeinschaftsquartier. Das andere Haus wurde als Werkskrankenhaus benutzt, das die deutschen und ausländischen Arbeitskräfte versorgte, die in der Sprengstofffabrik arbeiteten und in den anderen, Hessisch Lichtenau umgebenden Lagern untergebracht waren.Nach dem Zweiten Weltkrieg waren von 1950 das Auguste-Förster-Haus, das Kinderheim der Stadt Kassel sowie die Elisabeth-Knipping-Schule, Fachschule für Sozialpädagogik im Lenoirstift untergebracht. Diese Institutionen, die die Häuser im Sinne des Stifters führten, mussten 1983 die Bauten räumen. Nachdem lange Zeit keine adäquate Nutzung für das ehemalige Stift gefunden werden konnte, pachtete das Land Hessen das gesamte Anwesen. Heute dient es als Landesflüchtlingswohnheim. (1991)Drei über rechteckigem Grundriss aufsteigende Häuser, in Teilen noch umfangen von der bauzeitlichen Einfriedung, schließen sich zu einer gestaffelten Bebauung zusammen. In der Mitte befindet sich das ehemalige Verwalterhaus. Dieses wird rechts von dem Jungen-, links von dem Mädchenhaus gerahmt. Beide Gebäude sind aus der Flucht des Verwalterhauses hervorgezogen, so dass ein kleiner, rechteckiger Hof entsteht. In dessen Zentrum erhebt sich über einem Marmorsockel eine plastische Gruppe, die Pestalozzi zeigt. Insgesamt beherbergen die drei Häuser ca. 140 Wohn-, Arbeits-, Gruppen- und Wirtschaftsräume.Die Gebäude erheben sich über drei Geschossen in einem symmetrischen Fassadenaufriss, den ein exponierter Mittelrisalit zentriert. Die Ecken des Hauses werden von einem Giebelfeld betont, die dem Mittelteil jedoch deutlich untergeordnet sind. Dazwischen öffnen vier Fensterachsen die Geschosse.Das Verwalterhaus wird durch seine zahlreichen architektonischen Details und Verweise eindeutig als Hauptbau gekennzeichnet. Zentrum der Anlage ist die streng zentrierte Mittelachse des Hauses. Deren Ausgangspunkt ist das Portal, das das Gebäude in einem Palladiomotiv erschließt. Über dem in barocker Kurvatur abschließenden Wimperg steigen oberhalb der Portalzone farbig genasten Glasfenster auf. Seitlich abgesetzt davon werden die Flanken des stark aus der Fassadenflucht heraustretenden Risalites im Obergeschoss von rundbogig geöffneten Balkonen belegt, im Untergeschoss folgen die rechteckig eingeschnittenen Fenster dem Aufrisssystem, das die Seitenausdehnung der Fassade artikuliert.Die Verteilung der Räume im Inneren des Baues ist an der Fassadenstruktur ablesbar. In der Mitte macht ein großzügig angelegtes Treppenhaus die einzelnen Geschosse zugänglich. Davon strahlen schmale Korridore ab, die Zugang zu den Räumen zu beiden Seiten bieten. An den Enden münden die Korridore in große Gemeinschaftsräume, die durch ihre an der Hausrückseite einsichtige Verglasung deutlich als Wintergärten identifizierbar sind.Als repräsentativster Raum des Hauses befindet sich im ersten Obergeschoss die Aula des Heimes, im Untergeschoss darunter war die Heimküche angesiedelt.Durch den geringeren Schmuck und den Verzicht auf architektonische Details sind die flankierenden Gebäude, das Jungen- und Mädchenhaus, gekennzeichnet, Auf- und Grundriss ähneln dem Haupthaus. Die Korridore mit den abgehenden Schlafstuben werden durch das zentrale Treppenhaus erschlossen. An deren Ende befinden sich große Wintergärten als gemeinschaftliche Aufenthaltsräume.Im östlichen Bereich des umzäunten Geländes ist ein im Vergleich zu den drei Hauptgebäuden recht schmuckloser Zweckbau situiert, der vermutlich während der Nutzung durch die Munitionsfabrik entstanden ist. Dieser setzt sich aus einem zweigeschossigen Riegel und einem eingeschossigen Baukörper zusammen, die durch den umlaufenden Sockelbereich optisch zusammengefasst werden und jeweils ein Walmdach aufweisen.Abseits der beschriebenen Gebäude befindet sich in idyllischer Umgebung mit dunklem Nadelholzhintergrund an einem großen Spiegelteich gelegen das Mausoleum des Stiftgründers. Seitlich davon ein Plateau, ebenfalls mit Nadelbaumgruppen und Wegeführungen mit teilweise naturalistischen Einfassungen. Zentrum der - auch in der umfriedeten Grünfläche gezielt gestalteten - Anlage ist eine Halle über quadratischem Grundriss mit oktogonalem Tambour und abschließender Haube. Die Fassadenseite wird von einem Palladiomotiv geöffnet, dessen seitliche Stürze bzw. halbrunder Abschluss über ionischen Säulen aufliegt. Oberhalb des zentrierten Eingangs setzen von Doppelpilastern gerahmte, inkrustierte Felder einen besonderen Akzent. Sie sind, ebenso wie die den Gebäudeseiten angeschlossene Arkatur, die sich in rundbogigen Zwillingsbögen mit schlanker Säule öffnet, Zitat florentinischer Baukunst des Quatrocento. Zu denken ist - interessanterweise den Intentionen des Stifters entsprechend - an Brunelleschis Ospedale degli Innocenti (Waisenhaus) von 1421. Die Arkaturen enden zu beiden Seiten in Annexen, die in vereinfachter Form den zentralen Hauptbau rezipieren.In der Mittelachse der von einer Kuppel - zu denken ist an St. Maria del fiore in Florenz - geschlossenen Andachtshalle befindet sich, von einer Nische hinterfangen, eine Ädikula, deren stark aus dem Reliefgrund herausgearbeitete Figurengruppe an römisch-kaiserzeit-liche Grabplastik erinnert. Flankiert wird die Ädikula von Erinnerungstafeln mit folgenden Inschriften:Jérôme Henri LenoirGeh. Cassel am 8. Okt. 1795Gest. Cassel am 12. April 1873Elisabeth Lenoir geb. KochGeb. Cassel am 7. Januar 1803Gest. Wien am 18. Januar 1885Jean Conr. Nicolas LenoirGeh. Cassel am 13. Dez. 1832Gest. Wien am 11 Juni 1872George André LenoirGeb. Cassel am 5. Februar 1825Gest. Meran am 1. November 1909Anzumerken ist, dass sich nördlich der Siedlung Föhren die ruinösen Reste eines Wasserbehälters befinden, der für die Wasserversorgung des Lenoirstiftes diente.Das Lenoirstift ist auf Grund seiner ursprünglichen Zielsetzung und seiner architektonischen Ausgestaltung aus sozialgeschichtlichen und künstlerischen Aspekten als Sachgesamtheit schützenswert.
- Standort
-
Lenoirstraße 1, Fahrlücke , Im Teich , Lenoirstraße 2, Lenoirstraße 3, Lenoirstraße 4, Teichwäldchen, Hessisch Lichtenau (Fürstenhagen), Hessen
- Klassifikation
-
Baudenkmal
- Letzte Aktualisierung
-
04.06.2025, 11:55 MESZ
Datenpartner
Landesamt für Denkmalpflege Hessen. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Baudenkmal