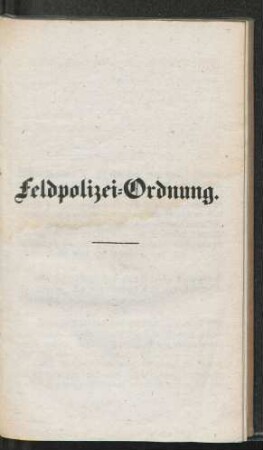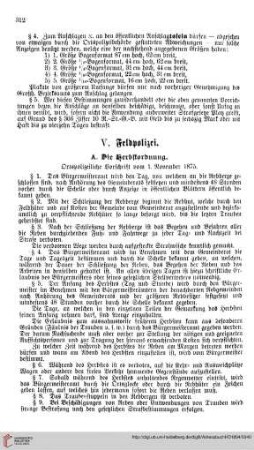Bestand
Dienststellen und Einheiten der Ordnungstruppen, der Geheimen Feldpolizei, der Betreuungs- und Streifendienste des Heeres (Bestand)
Geschichte des
Bestandsbildners: Dieser Abschnitt ist zum größten Teil
wörtlich zitiert aus der Publikation von Georg Tessin:
Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im
Zweiten Weltkrieg 1939-1945. Bd 1, Osnabrück 1979., S.
293-296.
Generale z.b.V.
Am 1. Februar 1941 wurde die Dienststelle
des General z.b.V. beim OKH eingerichtet, die federführend
für die gesamte Wehrmacht alle im Wehrmacht-Reiseverkehr
erforderlichen Maßnahmen für die Aufrechterhaltung der
Disziplin und die Betreuungseinrichtungen bearbeitete (siehe
Heeresmitteilungen HM Nr. 45/1941). Der General z.b.V. beim
OKH war ab Juli 1942 mit der Disziplinarstrafgewalt eines
Divisionskommandeurs gegenüber allen Unteroffizieren und
Mannschaften des Heeres sowie des Heeresgefolges
ausgestattet. Die in das Feldheer überführten Überwachungs-
und Betreuungseinheiten wurden mit Befehl vom 30. September
1943 den Oberkommandos der Heeresgruppen (außer Heeresgruppe
E) und dem Armeeoberkommando Norwegen unmittelbar
unterstellt. Die truppendienstliche Betreuung dieser
Heerestruppen überwachte der General z.b.V., der laut
Dienstanweisung vom 6. November 1943 (siehe RH 2/1110) dem
Oberbefehlshaber seiner Kommandobehörde unmittelbar
unterstand und an seine Weisungen gebunden war. Er übte die
Dienstaufsicht über die Kommandeure der Frontleitstellen in
Überwachungs- und Betreuungsangelegenheiten aus und hatte den
Einsatz der ihm unterstellten Einheiten im Benehmen mit dem
General des Transportwesens zu steuern sowie die
Zusammenarbeit sämtlicher für die Überwachung eingesetzten
Stäbe und Kräfte zu koordinieren. Neben der Erfassung und
Weiterleitung von Versprengten zu ihren Truppenteilen oblag
ihm auch die Überprüfung von Dienststellen, Kommandos und
Truppeneinheiten hinsichtlich ihrer Aufenthaltsberechtigung
in größeren Städten. Auf Anweisung des Oberbefehlshabers
konnte er unmittelbar örtlich eingreifen und war daher mit
den Disziplinarbefugnissen eines Divisonskommandeurs versehen
(siehe RH 48/197). Die dem OKH unmittelbar unterstehenden
Überwachungs- und Betreuungseinheiten blieben dem General
z.b.V. beim OKH unterstellt. Dieser war für die grundlegenden
Einsatzbefehle sowie die grundsätzlichen fachlichen
Anordnungen bezüglich Ausbildung, Gliederung und Ausrüstung
für den Überwachungs- und Betreuungsdienst verantwortlich.
Mit Befehl vom 30. September 1943 wurde er als Waffengeneral
der Überwachungs- und Betreuungstruppen beim OKH eingesetzt
und ihm in dieser Eigenschaft die Dienstaufsicht über die
Frontleitstellen des Feldheeres übertragen. Zur Durchführung
seiner Aufgaben wurde die Dienststelle General z.b.V. IV
(Außenstelle) beim Chef des Generalstabes des Heeres
(Gen.St.d.H.) eingerichtet und ihm unterstellt. Sie war
zugleich Verbindungsstelle zur Heerwesen-Abteilung und den
anderen Dienststellen des Hauptquartiers. Am 1. März 1944
wurde gemäß Erlass Hitlers vom 20. Januar 1944
(Heeresmitteilungen HM Nr. 262/1944) der
Wehrmachtstreifendienst mit Beteiligung der Wehrmachtteile
und der Waffen-SS gebildet und der Chef des
Wehrmachtstreifendienstes (Chef d. W. Str. D.) dem Chef OKW
unmittelbar unterstellt. Die Aufgaben des
Wehrmachtstreifendienstes waren die "Aufrechterhaltung der
Manneszucht" außerhalb der Truppe, die Überwachung des
Wehrmacht-Reiseverkehrs einschließlich Bahnhofswachdienst,
Fahndung in Zusammenarbeit mit der Polizei und die Betreuung
außerhalb der Truppe im Reichsgebiet (einschließlich
Böhmen-Mähren und Generalgouvernement), in den besetzten
Gebieten, in Italien, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Finnland,
Slowakei, Kroatien und Dänemark. Gegenüber den Generalen
z.b.V. bei den Heeresgruppen und den ihn unterstellten
Einheiten sowie gegenüber den Streifendiensten der
Armeeoberkommandos und der Wehrkreise hatte der Chef d. W.
Str. D. die Stellung eines Inspekteurs inne. Die Ernennung
der Generale z.b.V. konnte nur mit seinem Einverständnis
erfolgen (siehe Dienstanweisung in RW 4/457). Am 15. Februar
1945 wurde auf Befehl des Chefs des OKW die Dienststelle des
Chefs der Wehrmacht-Ordnungstruppen mit den Befugnissen eines
Armeeoberbefehlshabers neugebildet. Er unterstand dem Chef
des OKW unmittelbar und bündelte nun den Oberbefehl über den
Wehrmachtstreifendienst, die Feldgendarmerie und die Generale
z.b.V.
Kommandeure der Streifendienste
und für Urlaubsüberwachung
Bei den
Wehrkreiskommandos wurden am 1. Februar 1941 die Stellen des
Kommandeurs des Streifendienstes geschaffen, die dem General
z.b.V. IV im OKH unterstanden. Ihnen unterstellt waren die
Bahnhofswach- und Zugwach-Abteilungen und -Kompanien. Die
Gruppen Heeres-Streifendienst z.b.V. beim Feldheer wurden am
1. März 1944 in Gruppen Wehrmacht-Streifendienst umbenannt.
Die Kommandeure für Urlaubsüberwachung wurden seit Januar
1942 aufgestellt. Unterstellt waren ihnen außer den
Wehrmacht-Streifengruppen die Wehrmacht-Streifen-Kommandeure
bei den Heeresgruppen, die zunächst als Kommandeure des
Heeres-Streifendienstes für den Reiseverkehr aufgestellt
worden waren (Nord- und Mittelrussland; in Südrussland bei
den Heeresgruppen Don/Süd und A). Nicht im Osten eingesetzt
waren Mitte/Reich in Berlin, Skandinavien/Norwegen in Oslo,
Südost in Marburg/Drau, Süd/Südwest in Verona und West.
Entlausungs-Kompanien und
Heeres-Betreuungs-Abteilungen
Zu den
Heeres-Betreuungs-Abteilungen zählen auch die
Entlausungseinheiten. Am 1. November 1941 waren sie als
Entlausungsanstalten aufgestellt worden, wurden mit Befehl
vom 21. Januar 1942 in Entlausungskompanien und schließlich
am 13. Juli 1942 in Heeres-Betreuungs-Kompanien umbenannt
(siehe RH 48/66). Die Heeres-Betreuungs-Abteilungen und
-Kompanien mit den Nummern 1-17, 51-72 (E), 101-106 (mot.)
und 201-210 (B) unterstanden dem General z.b.V. IV im
OKH.
Frontsammel- und
Frontleitstellen
Die ersten
Frontsammelstellen wurden am 13. November 1939 bei den
Armeen, die ersten Frontleitstellen 1940 bei den
Militärbefehlshabern aufgestellt. Die ersteren wurden mit den
Großbuchstaben A-O, die letzteren zunächst nach ihrem
Einsatzort und ab dem 1. August 1941 ebenfalls mit Buchstaben
(P ff.) bezeichnet und dann durchnummeriert, wobei die letzte
Ziffer auf den aufstellenden Wehrkreis hinwies (z. B.: 6, 16,
26, 36, 46, 86 im WK VI). Seit dem 1. Januar 1943 wurden auch
die bisherigen Frontsammelstellen in Frontleitstellen
umbenannt. Auf Grund des "Frontnachweisers", der alle
Einheiten enthielt, wurden Transporte oder Urlauber auch bei
Truppenverschiebungen dem Hauptquartier ihrer Armee, den
Einschiffungshäfen (für Norwegen und Finnland) oder den sonst
zuständigen Sammelplätzen zugeführt. Außer ihrer Nummer
führten die Frontleitstellen auch Decknamen, die auf den
Einsatzraum hindeuteten (z. B. Otto, Oswald usw. für den
Osten; Nora, Nansen ff. für den Norden; Willi, Wolfram ff.
für den Westen; Sigrid, Sascha ff. für den Süden). Aufgabe
der Frontleitstellen war es vor allem, für Verpflegung und
Unterkunft der durchreisenden Soldaten Sorge zu tragen und
diese ihrem jeweiligen Bestimmungsort zuzuführen.
Wach-Bataillone
Die
Wach-Bataillone gehörten als Ordnungstruppen zusammen mit der
Feldgendarmerie zu den Versorgungstruppen des Feldheeres
(Allgemeine Heeresmitteilungen AHM Nr. 842/42). Da sie
ersatzmäßig aus Landesschützen bestanden und später zum Teil
in Sicherungs-Bataillone umgebildet wurden, sind sie unter
den Landesschützen-Bataillonen mit aufgeführt. Sie gehörten
aber in der Nummernfolge nicht zu den Landesschützen- oder
Sicherungs-Bataillonen, sondern führten zunächst Nummern wie
die Armeetruppen (über 500) oder wie die Heerestruppen (über
600).
Die bei Mobilmachung
aufgestellten Wach-Bataillone 502, 508, 521, 522, 531, 532,
541, 542, 551, 552, 561, 562, 571, 572, 581, 582, 591 und 592
waren also Armeetruppen und gehörten zu je zwei den
"Armeepaketen" Ostpreußen, W (= Wien), B (= Berlin), D (=
Dresden), S (= Stuttgart), M (= Münster), N (= Nürnberg), L
(= ?; im Wehrkreis VI aufgestellt) und K (= Kassel) an. Die
erste Zuteilung der "Pakete" zu den Armeen änderte sich
jedoch schon bald nach dem Polenfeldzug mit der Verlegung der
Armeen nach dem Westen im Oktober 1939. Die Wach-Bataillone
601-604, 608, 609, 615 und 617 waren Heerestruppen. - Das
Wach-Bataillon 631 für das OKH wurde 1939
I./Infanterie-Regiment "Großdeutschland"; 1943 wurden aber
zwei Wach-Kompanien 631 durch den Kommandanten des
Hauptquartiers OKH wieder gebildet und 1945 eine
Wach-Kompanie 700. Zu diesen 27 Wach-Bataillonen kamen 1939
die vier Radfahr-Wach-Bataillone 613, 614, 619 und 620 hinzu.
Anfang 1940 wurden fünf Bataillone in Polen (521, 532, 572,
601 und 608) zur Bildung der 9. Welle der
Infanterie-Divisionen verwandt. - Das Wach-Bataillon 592
wurde Infanterie-Lehr-Bataillon der 1. Armee. Neuaufgestellt
wurden 1940 die zwölf Wach-Bataillone 647-655 und 659-661.
Sie wurden aber schon nach kurzer Zeit in
Landesschützen-Bataillone umgewandelt. Die Nummer wechselte
(414-416, 987-989, 636-638 und 972-974). Im Herbst entstanden
aus den Festungs-Infanterie-Regimentern A-D die
Wach-Bataillone 701-708 und aus der wieder aufgelösten 9.
Welle die Bataillone 720-721. Anschließend wurden einige
Bau-Bataillone in Wach-Bataillone umgewandelt: 43, 45, 47-50,
58, 143, 150 und 326, ein Jahr später auch 122. Sie behielten
die Nummer, die sie als Bau-Bataillon geführt hatten. Von
diesen jetzt 46 Wach-Bataillonen waren neun
Radfahr-Bataillone. 1942 wurden aus vier von ihnen (613, 614,
619 und 620) die Sicherungs-Regimenter 3 und 4 formiert, aus
neun Bataillonen (502, 701, 703-708 und 722) die
Sicherungs-Bataillone 205, 791, 793-798 und 722. 1943
bildeten die Wach-Bataillone 531, 609, 615 und 721 die
Sicherungs-Bataillone 315, 946, 493 und 889, das
Radfahr-Wach-Bataillon 45 das Sicherungs-Bataillon 407, die
Radfahr-Wach-Bataillone 48, 50, 143 und 326 die
Radfahr-Sicherungs-Bataillone 755, 852, 757 und 226. Die
restlichen 24 Wach-Bataillone wurden gleichzeitig in
Nachschub-Bataillone umgewandelt.
Feldgendarmerie und Verkehrs-Regelungs-Abteilungen
Die Feldgendarmerie war eine aus Gendarmen
und aktiven Unteroffizieren gebildete Truppe für
militärpolizeiliche Aufgaben. Die Offiziere, Unteroffiziere
und Mannschaften der Feldgendarmerie waren gemäß Verfügung
des OKH/Generalstab des Heeres/Generalquartiermeister vom 3.
Dezember 1939 Soldaten. Zur Feldgendarmerie gehörten auch die
am 26. Oktober 1939 aufgestellten
Verkehrs-Regelungs-Bataillone (zu je 2 Kompanien), die aber
1942 in Russland aufgelöst und in Feldgendarmerie-Abteilungen
umgegliedert wurden. Bei Mobilmachung erhielt jede Armee eine
Abteilung. Sie waren mit Hilfe der Ordnungspolizei zu je drei
Kompanien aufgestellt worden. Außerdem war jedem Korps und
jeder Division ein Feldgendarmerie-Trupp und den
Feldkommandanturen eine Feldgendarmerie-Gruppe zugeteilt.
Auch für die Fallschirm-Korps und Fallschirm-Divisionen
stellte das Heer Feldgendarmerie-Trupps ab. Die Trupps
zwischen 501 und 1151 (mit nur geringen Lücken) zählten zu
den Heerestruppen. In Böhmen und Mähren waren dann noch
1901-1903, 2901-2903 und 3901-3903 aufgestellt worden. Die
Feldgendarmen trugen Ringkragen. Zu den Aufgaben der
Feldgendarmerie gehörten die Verkehrsregelung, die
Überwachung der Disziplin der Feldtruppen sowie des
Verhaltens der Wehrmachtangehörigen gegenüber der
Zivilbevölkerung, die Fahndung nach Wehrmachtangehörigen, die
Verhinderung von Sabotageakten, Erkundungen und die
Erledigung von Aufträgen zuständiger Dienststellen (siehe RH
36/237).
Feldjäger
Am 25. Dezember 1943 wurde aus Wehrmacht-Streifendienst
und ausgezeichneten Soldaten des Feldheeres das
Feldjägerkorps aufgestellt und direkt dem OKW unterstellt.
Die Befehlshaber der Feldjäger-Kommandos hatten den Rang
eines Kommandierenden Generals. Die ihnen unterstellten
Bataillone bestanden aus fünf Kompanien zu 30 Offizieren und
90 Unteroffizieren. Die Aufstockung auf Regimenter und
Bataillone bedeutete offenbar keine Vermehrung, sondern nur
eine Umbenennung, die durch die hohe Zahl der Offiziere
bedingt war. Die Feldjäger-Abteilungen wurden als besonders
hart durchgreifende und daher mit weitreichenden Vollmachten
ausgestattete spezielle Ordnungstruppe eingesetzt, als in
Folge der sich abzeichnenden Niederlage die Disziplin immer
schwieriger aufrecht zu erhalten war (siehe ZA 1/1250). Mit
Erlass des Chef OKW/Wehrmachtführungsstab vom 7. September
1944 hatten sie "auf Befehl Hitlers und in unmittelbarer
Unterstellung unter den Chef des OKW im rückwärtigen Gebiet
kurzfristig und vollständig, notfalls mit rücksichtslosen
Mitteln bis zum sofortigen Waffengebrauch, die militärische
Zucht und Ordnung in jeder Lage aufrechtzuerhalten." (siehe:
Absolon, Rudolf: Die Wehrmacht im Dritten Reich. Bd. 6: 19.
Dezember 1941 - 9. Mai 1945, in: Schriften des Bundesarchivs
16/VI, Boppard am Rhein 1995, S. 826)
Geheime Feldpolizei
Die Geheime
Feldpolizei gehörte nicht zu den Ordnungstruppen; sie
unterstand dem OKW/Amt Ausland/Abwehr. An ihrer Spitze stand
der Heerespolizeichef, der im Oktober 1939 Feldpolizeichef
der Wehrmacht wurde. Eine Gruppe Geheime Feldpolizei wurde
bei Kriegsbeginn jeder Armee zugeteilt. Sie bestand aus einem
Feldpolizei-Direktor, acht Feldpolizei-Kommissaren,
zweiundzwanzig Feldpolizei-Sekretären und achtzehn
Unteroffizieren und Mannschaften. Bei den Heeresgruppen waren
Leitende Feldpolizei-Direktoren eingesetzt. In Frankreich
wurde die Geheime Feldpolizei am 15. November 1942 in die
Sicherheitspolizei (Sipo) und den Sicherheitsdienst (SD)
überführt. Bei den Fronttruppen und in den anderen besetzten
Gebieten blieb sie bestehen, bis am 30. September 1944 auch
sie, wie vorher schon die Dienststellen und Einheiten Abwehr,
dem Reichssicherheitshauptamt des Reichsführers-SS (RSHA)
unterstellt wurde.
Feldstrafgefangenen-Abteilungen
Die Feldstrafgefangenen-Abteilungen (für Verurteilte,
deren Strafverbüßung bis Kriegsende ausgesetzt blieb) wurden
seit Mai 1942 durch die Wehrmacht-Gefängnisse aufgestellt und
waren im Osten eingesetzt. Die Abteilungen 21, 22 und 19
wurden erst 1944 durch Umbenennung der Feldstraflager I-III
gebildet, die 1940 in Norwegen und Lappland, später auch im
Bereich der Heeresgruppe Nord als Arbeitslager für
Nichterziehbare eingerichtet worden waren.
Die ab Januar 1940 jeweils für mehrere Wehrkreise
zuständigen, als Erziehungseinheiten vorgesehenen
Sonder-Abteilungen des Ersatzheeres in Stablack, Wandern,
Schwarzenborn und Grafenwöhr wurden im Mai 1942 bei
Aufstellung der Feldstrafgefangenen-Abteilungen aufgelöst
(Allgemeine Heeresmitteilungen AHM Nr. 357/43). Das
Feld-Sonder-Bataillon hatte Soldaten aufzunehmen, die zwar
ihre Strafe voll verbüßt hatten, wegen charakterlicher Mängel
aber nicht sofort zu ihrem Truppenteil zurückkehren
konnten.
Kriegs-Wehrmacht-Gefängnisse
und -Haftanstalten
Sofern sie ihre
Strafe nicht in einer Feldstrafgefangenen-Abteilung
verbüßten, wurden verurteilte Wehrmachtangehörige den
Kriegs-Wehrmacht-Gefängnissen bzw. -Haftanstalten überstellt,
die sich in besetzten Gebieten befanden und in ihrer
Bezeichnung den Zusatz "Krieg" führten. (siehe: Absolon,
Rudolf: Die Wehrmacht im Dritten Reich. Bd. 6: 19. Dezember
1941 - 9. Mai 1945, in: Schriften des Bundesarchivs 16/VI,
Boppard am Rhein 1995, S. 571 f.)
Bestandsbeschreibung:
Die Unterlagen stammen u.a. aus Aktenrückgaben aus den USA
und Großbritannien.
Inhaltliche
Charakterisierung: Bei diesem Bestand handelt es sich um
einen Sammelbestand, in dem die wenigen erhalten gebliebenen
Aktensplitter der Wach-Bataillone, der Dienststellen und
Einheiten der Ordnungstruppen (Generale z.b.V., Betreuungs-
und Streifendienste, Frontsammel- und Frontleitstellen,
Feldjäger und Feldgendarmerie) sowie der Geheimen Feldpolizei
und der Feldstrafvollzugeinrichtungen zusammengefasst sind.
Ein nicht unerheblicher Teil des Bestandes entfällt auf
Stammtafeln (ca. 30 Archivalieneinheiten).
Die 80 Aktenbände mit Erkennungsmarkenverzeichnissen der
Geheimen Feldpolizei wurden aus dem Bestand herausgelöst und
zuständigkeitshalber an die Deutsche Dienststelle in Berlin
abgegeben.
Ansonsten sind
Kriegstagebücher und Tätigkeitsberichte einzelner
Dienststellen und Einheiten vorhanden. Einsatzberichte von
Gruppen der Geheimen Feldpolizei sind mitunter auch bei den
Ic-Abteilungen der Armeen sowie im Bestand OKW/Ausland/Abwehr
(RW 5) nachgewiesen, während die von Feldgendarmerie-Trupps
häufig bei den Divisionen, denen sie unterstellt waren,
anzutreffen sind.
Der Bestand wurde in
der Vergangenheit durch zahlreiche Hinweise auf Archivalien
in anderen Beständen angereichert, ohne dass die
Überlieferungen der vorgesetzten Verbände oder
Kommandostellen systematisch auf solche
Überlieferungsverweise durchgesehen wurden. Diese wertvollen
Hinweise sollten nicht verloren gehen und wurden daher bei
der Datenbank-Erschließung mit aufgenommen.
Erschließungszustand:
Online-Findbuch 2006
Zitierweise: BArch RH
48/...
- Bestandssignatur
-
Bundesarchiv, BArch RH 48
- Umfang
-
210 Aufbewahrungseinheiten; 2,3 laufende Meter
- Sprache der Unterlagen
-
deutsch
- Kontext
-
Bundesarchiv (Archivtektonik) >> Norddeutscher Bund und Deutsches Reich (1867/1871-1945) >> Militär >> Reichswehr und Wehrmacht 1919 bis 1945/1946 >> Reichsheer und Heer >> Kommandobehörden, Verbände und Einheiten >> Weitere Einheiten
- Verwandte Bestände und Literatur
-
Fremde Archive: Deutsche Dienststelle (WASt), Berlin: Erkennungsmarkenverzeichnisse und namentliche Verlustmeldungen
Verwandtes Archivgut im Bundesarchiv: Bestände:
RH 19 (Heeresgruppen)
RH 20 (Armeen und Armeegruppen)
RH 22 (Befehlshaber rückwärtige Heeresgebiete)
RH 23 (Kommandanten rückwärtiger Armeegebiete
RH 26 (Infanterie- und Sicherungs-Divisionen)
RH 38 (Verbände und Einheiten der Sicherungstruppe und Landesschützen des Heeres)
RW 5 (OKW Amt Ausland/Abwehr)
ZA 1 (Operational History (German) Section der Historical Division der US-Army / Studiengruppe Wehrmachtführung und Heer)
Pers 15 (Verfahrensakten von Wehrmachtgerichten, darin ca. 400 Personalakten von Häftlingen der Feldstrafgefangengen-Abteilung 4)
MSG 2 (Militärgeschichtliche Sammlung)
Akten:
ZA 1/1250: Speidel, Wilhelm: Kurze Denkschrift über meine Aufgabe und Tätigkeit als Befehlshaber Feldjäger-Kommando III von Mitte März bis Ende Juni 1945
ZA 1/ 1230: Krichbaum, Wilhelm: Die Geheime Feldpolizei (1948, 191 Seiten)
Literatur: Absolon, Rudolf: Die Wehrmacht im Dritten Reich. Bd. 4: 19. Dezember 1941 - 9. Mai 1945, in: Schriften des Bundesarchivs 16/VI, Boppard am Rhein 1995
Böckle, Karlheinz: Feldgendarmen, Feldjäger, Militärpolizisten. Ihre Geschichte bis heute, Stuttgart 1987
Eberlein, Michael/ Haase, Norbert/ Oleschinski, Wolfgang: Torgau im Hinterland des Zweiten Weltkriegs. Militärjustiz, Wehrmachtgefängnisse, Reichskriegsgericht, hrsg. von der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer Politischer Gewaltherrschaft, Leipzig 1999
Gessner, Klaus: Geheime Feldpolizei. Zur Funktion und Organisation des geheimpolizeilichen Exekutivorgangs der faschistischen Wehrmacht, Berlin-Ost 1986
Ders.: Geheime Feldpolizei - die Gestapo der Wehrmacht, in: Heer, Hannes/ Naumann, Klaus: Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944, Hamburg 1995, S. 343-358
Ders.: Geheime Feldpolizei. Die "Gestapo der Wehrmacht", in: Paul, Gerhard/ Mallmann, Klaus-Michael: Die Gestapo im Krieg, Darmstadt 1995, S. 492-507
Held, Walter: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg. Eine Bibliographie der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. 5 Bde, Osnabrück 1978 ff
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. 20 Bde, Osnabrück 1967 ff
Wagner, Andreas: "In Anklam aber empfängt mich die Hölle... ", hrsg. von der Projektgruppe "Gedenkstättenarbeit in Mecklenburg-Vorpommern", Schwerin 2000
- Bestandslaufzeit
-
1939-1945
- Weitere Objektseiten
- Provenienz
-
Dienststellen und Einheiten der Ordnungstruppen, der Geheimen Feldpolizei, der Betreuungs- und Streifendienste des Heeres, 1939-1945
- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs
- Letzte Aktualisierung
-
08.01.2022, 14:43 MEZ
Datenpartner
Bundesarchiv. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Bestand
Entstanden
- 1939-1945