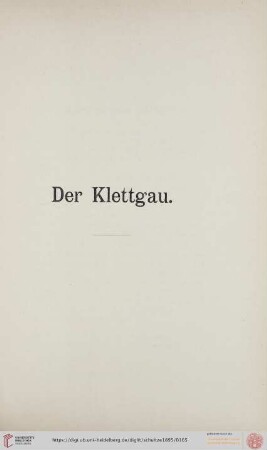Bestand
Klettgau (Bestand)
Überlieferungsgeschichte
Die Landgrafschaft Klettgau fiel im Erbgang 1687
von den Grafen von Sulz an die Fürsten Schwarzenberg. Tiengen, bis
dahin Residenz der Grafschaft, blieb Sitz eines schwarzenbergischen
Oberamts. Nachdem 1801/1803 bereits die schweizerischen Ortschaften
der Landgrafschaft an die Kantone Zürich und Bern übergegangen
waren, wurde die Landgrafschaft 1806 zum standesherrlichen Amt
Klettgau im Großherzogtum. Als Baden 1812 dieses Amt kaufte, wurde
das herrschaftliche Archiv geteilt: Familienschriftgut kam in das
Fürstlich Schwarzenbergische Archiv in Wien, von dort nach
Böhmisch-Krumau (Cesky Krumlov), wo es heute als Teil des
Staatsarchivs Wiltingau (Trebon) verwahrt wird. Das
Verwaltungsschriftgut gelangte 1823 in das Provinzialarchiv
Freiburg (vgl. GLA 68/526 sowie Bestände 10 und 224) und nach
dessen Auflösung 1841 in das Generallandesarchiv.
Vorwort: Die Landgrafschaft
Klettgau entwickelte sich im 13. Jahrhundert, wobei fraglich ist,
inwieweit ältere Traditionen der Gaugrafschaft gleichen Namens und
das hier schon früher vorhandene Landgericht dabei eine Rolle
spielten. Die wichtigsten Herrschaftsträger des Hochmittelalters
dieses Gebietes waren neben dem Kloster Rheinau die Herren von
Krenkingen, der Bischof von Konstanz und die Grafen von Habsburg.
1325 erscheint Rudolf von Habsburg-Laufenburg als Landgraf im
Klettgau. 1408 erlosch die Linie Habsburg-Laufenburg und die
Landgrafschaft kam an die Grafen von Sulz. Diese hatten ihre
ursprünglichen Herrschaftsgebiete am mittleren Neckar bis auf
wenige Reste an Württemberg verloren und begannen nun einen neuen
Herrschaftsmittelpunkt ihres Hauses im Klettgau aufzurichten. Ihre
Versuche, alte Vogteirechte gegenüber dem Kloster Rheinau
durchzusetzen waren nicht erfolgreich, aber gegenüber dem Bischof
von Konstanz konnten sie sich in mehreren Schritten durchsetzen.
Insbesondere gelang ihnen 1482 die Pfand weise Erwerbung der Stadt
Tiengen vom Bischof. Die Stadt, in der die Landgrafschaft
Stühlingen noch Hoheitsrechte besaß, wurde Residenz der Grafen.
Nach dem Aussterben der männlichen Linie der Grafen von Sulz im
Jahr 1687 fiel die Landgrafschaft Klettgau an den Fürsten Ferdinand
von Schwarzenberg, der eine Tochter des letzten Grafen von Sulz
geheiratet hatte. Die Fürsten von Schwarzenberg, deren Stammlande
im fränkischen Bayern lagen, hatten verschiedene weitere
Besitzungen im Reich. Insbesondere besaßen sie ausgedehnte Gebiete
in Böhmen. Sie pflegten enge Beziehungen zum Kaiserhaus und
regierten ihre Herrschaften häufig von Wien aus. Auch die
Landgrafschaft Klettgau war nur eine entfernte Außenbesitzung, die
allerdings durch ihren reichsrechtlichen Rang - 1698 wurde sie zum
Fürstentum erhoben - besondere Bedeutung hatte. Die Landgrafschaft
wurde durch die Oberamtmänner in Tiengen und Jestetten und die
darüber stehende Regierung in Tiengen verwaltet. Nur gelegentlich
besuchte der Fürst seine Herrschaft persönlich, aber die Regierung
musste über viele Vorgänge der Verwaltung Bericht nach Wien geben
und die fürstliche Entscheidung einholen. Gegen Ende des
Jahrhunderts stand die fürstliche Herrschaft zunehmend im Zeichen
des aufgeklärten Absolutismus. Die Reichskriege mit Frankreich
führten zu einer hohen Verschuldung des Landes und als die
Landeshoheit 1806 an das Großherzogtum Baden fiel, musste dieses
auch eine große Schuldenlast übernehmen. Die Fürsten von
Schwarzenberg bildeten eine standesherrliche Verwaltung mit Sitz in
Tiengen, aber schon 1812 entschlossen sie sich, ihre verbliebenen
standesherrlichen Rechte an Baden zu verkaufen. Der vorliegende
Bestand ist im Laufe des 19. Jahrhunderts nach dem im
Generallandesarchiv damals angewandten Pertinenzprinzip gebildet
worden. Es wurden aus sämtlichen Archiven der in den Jahren nach
1802 an Baden gekommenen Territorien und Institutionen hier
diejenigen Akten zusammengefasst, die die Landgrafschaft Klettgau
insgesamt betrafen. So spiegelt sich im jetzt erstellten
Provenienzverzeichnis (S. 692) des Bestandes die Zusammensetzung
der Territorien und kirchlichen Institutionen wieder, die einen
Bezug zu der Landgrafschaft hatten. Zuerst sind hier die Grafen von
Sulz zu nennen, die die Landgrafschaft von 1408 bis 1687
innehatten. Insgesamt 73 Akten (4 %) sind gräflich sulzischer
Provenienz. Sicher sind sie über das schwarzenbergische Archiv in
Tiengen in das Generallandesarchiv gekommen, aber sie sind nach
1687 nicht fortgeführt worden und nicht mit Archivsignaturen oder
Umschlägen des schwarzenbergischen Herrschaftsarchivs versehen
worden. Zahlreiche weitere Akten wurden jedoch in
schwarzenbergischer Zeit weitergeführt oder in das
schwarzenbergische Archiv in Tiengen übernommen und sind daher
unter der Provenienz "Landgrafschaft Klettgau" erfasst. Insgesamt
311 Akten enthalten Schriftverkehr aus der Zeit vor 1687. Dies
macht einen Anteil von 16% des Gesamtbestandes aus und gibt ein
genaueres Bild der enthaltenen sulzischen Überlieferung. Es finden
sich hierunter auch verschiedene Unterlagen über die über den
Klettgau hinausgreifenden Aktivitäten der Grafen. Insbesondere sei
hier auf die unter der Rubrik "Korrespondenz" zusammengefasste
Überlieferung des 15.Jahrhunderts hingewiesen. Weitaus der größte
Teil der Überlieferung des Bestandes (über 80%) entstammt dem
Archiv der klettgauischen Regierung und Kammer in Tiengen und ist
in der Zeit der fürstlich schwarzenbergischen Herrschaft
entstanden. Das Archiv war gegen Ende des 18. Jahrhunderts
möglicherweise im Zusammenhang mit der Neuorganisation der
klettgauischen Verwaltung neu geordnet worden. Die Archivalien
wurden nach 20 Klassen mit Unterabteilungen gegliedert und mit
Lokaturen (Kasten, Fach) versehen. Jede Akte erhielt einen Umschlag
oder eine Banderole, die mit diesen Angaben sowie mit einem
Aktentitel und teilweise mit dem Inhalt der enthaltenen Schreiben
versehen war (Beispiel siehe S. 799). Das 1791 fertig gestellte
Findbuch hierzu wird unter der Signatur 68/200 verwahrt. Viele
Akten des Archivs enthalten nur einen Vorgang und sind daher wenig
umfangreich. Gelegentlich wurden allerdings von späteren Archivaren
gleichartige Vorgänge mit mehreren Umschlägen zu einer Akte
zusammengefasst. Das Archiv in Tiengen wurde im Jahr 1823 durch den
Freiburger Archivrat Leichtlen gesichtet und soweit die Archivalien
nicht noch an einzelne lokale Ämter zum laufenden Gebrauch
abgegeben oder vernichtet wurden, wurde es nach der Archivordnung
von 1803 auf das Generallandesarchiv und das Provinzialarchiv
Freiburg verteilt (siehe Bestand 236/74 und 227/3). Die
schwarzenbergische Verwaltung in Tiengen stand in regem
Schriftverkehr mit der Zentrale der schwarzenbergischen Verwaltung
in Wien. Deren Überlieferung über die Verwaltung der Landgrafschaft
Klettgau befindet sich in dem ehemaligen schwarzenbergischen
Zentralarchiv, das heute im Staatlichen Archiv Wittingau
(Zweigstelle Böhmisch-Krumau, Zamek, 38111 Cesky Krumlov,
Tschechische Republik) verwahrt wird. Dort befinden sich übrigens
auch noch Archivalien der Grafen von Sulz (siehe hierzu "Quellen
zur südwestdeutschen Geschichte in Archiven der Tschechischen
Republik. Hrsg. von Volker Rödel. Werkhefte der Staatlichen
Archivverwaltung Baden-Württemberg Serie A Heft 5 (Stuttgart 1995)"
S. 95 ff.). Archivalien anderer weltlicher Provenienzbildner vor
1806 sind lediglich 5 (0,3%) enthalten. Ebenso ist auch die
Überlieferung kirchlicher Provenienzbildner vor 1806 mit insgesamt
36 Akten (1,9%) sehr gering vertreten. Akten großherzoglich
badischer Registraturen nach 1806 bzw. 1812 sind mit 56 Nummern
(3%) eben- falls nur sehr wenige enthalten. Nicht geklärt werden
konnte die Provenienz bei 98 Akten (5,3%). Der Bestand ist also im
Vergleich mit anderen Beständen des Historischen Archivs des
Generallandesarchivs provenienzmäßig sehr einheitlich. 90% der
Akten entstammen dem lokalen Herrschaftsarchiv der Grafen von Sulz
bzw. der Fürsten von Schwarzenberg. Dies ist aus der
Zusammensetzung der Herrschaftsträger, die sonst noch mit der
Landgrafschaft Klettgau in Verbindung standen oder dort Rechte
hatten, und mit deren Archivüberlieferungsgeschichte zu erklären.
Zu nennen sind hier im kirchlichen Bereich vor allern das Hochstift
Konstanz und in geringerem Umfang das Kloster Rheinau und das Stift
Zurzach, auf weltlicher Seite die Fürsten v. Fürstenberg und die
Schweizer Stände Schaffhausen und Zürich. Von diesen
Herrschaftsträgern ist lediglich das Archiv der Bischöfe von
Konstanz teilweise an das Generallandesarchiv gekommen, so dass nur
aus diesem Archiv bei der Pertinenzbildung Akten in den
vorliegenden Bestand kommen konnten. Die zeitliche Schichtung der
Überlieferung des Bestandes ergibt folgendes Bild: 15 Akten (0,7%)
enthalten Schriftgut vor 1500, 79 Akten (3,6%) betreffen das 16.
Jahrhundert, 345 Akten (15,6%) das 17. Jahrhundert, 1149 Akten
(52,1%) das 18. Jahrhundert und 257 Akten (28%) enthalten Schrift
gut, das dem 19. Jahrhundert entstammt. Gezählt wurde lediglich die
originale Überlieferung. Der Bestand umfasst 1832 Nummern in 20
lfd. m und hat eine Laufzeit von 1294-1850. Er wurde 1938 von Hans
Dietrich Siebert durch ein Zettelrepertorium erschlossen. Dieses
wurde von Unterzeichnetem unter Verwendung des MIDOSA-Programmes
überarbeitet. Hierbei wurde der Umfang der einzelnen Faszikel
angegeben, wobei bei Akten mit Blattzählung oder einem Umfang von
bis zu etwa 10 Blatt die Blattzahl angegeben wurde, bei sonstigen
Akten unter 1 cm Umfang die Bezeichnung "1 Fasz." steht, und bei
Akten ab 1 cm Umfang die Zentimeterzahl in Schritten von 0,5 cm
angegeben ist. 1 cm entspricht etwa 50 Blatt (bei Hadernpapier), so
dass sich durch diese Angaben der ungefähre Umfang eines Aktenhefts
berechnen lässt. Außerdem wurde die Provenienz (des letzten
angefallenen Schriftstücks) ermittelt, die Filmsignatur hinzugefügt
und eine alte im Generallandesarchiv verwendete Vorsignatur erfasst
und durch eine Konkordanz zu den Ordnungsnummern das Auffinden
alter Zitierungen ermöglicht. Teile des vorliegenden Bestandes
waren ursprünglich dem Pertinenzbestand Tiengen, Stadt (Bestand
224) zugeordnet gewesen, und wurden vermutlich vorn Bearbeiter
Siebert hierher übernommen. Sie sind in der Konkordanz der Alten
Signaturen getrennt aufgeführt und ergänzen die Konkordanz der
Alten Signaturen des Findbuchs zu Bestand 224. Die Aktentitel
wurden modernisiert und im Einzelfall durch weitere Inhaltsvermerke
erweitert und durch Indizes erschlossen. Beim Ortsindex sind
naturgemäß die meisten Stichworte unter "Klettgau, Lgfsch."
angefallen, obwohl Stichworte, die im Findbuch unter der Rubrik
auftauchen, unter der sie auch zu erwarten sind (z.B. Mühlen unter
der Rubrik "Mühlen"), in der Regel nicht noch einmal im Index
verwiesen wurden. Daher wurde versucht, durch Untergliederung der
Stichworte des Ortsbetreffs Klettgau, Lgfsch. nach Sachgruppen eine
größere Übersichtlichkeit und bessere Benutzbarkeit dieses
Indexteils zu erreichen. Die erste Eingabe der Aktentitel des
Zettelrepertoriums in das MIDOSA-Programm besorgte Piroschka
Hedden. Karlsruhe, im Januar 1996 Reinhold Rupp
- Bestandssignatur
-
Abt. Generallandesarchiv Karlsruhe, 116
- Umfang
-
1529 Akten (Nr. 1-1834)
- Kontext
-
Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Generallandesarchiv Karlsruhe (Archivtektonik) >> Ältere Bestände (vornehmlich aus der Zeit des Alten Reichs) >> Akten >> Kleinere weltliche Territorien >> Klettgau
- Verwandte Bestände und Literatur
-
Rainer Brüning/Gabriele Wüst (Bearb.), Die Bestände des Generallandesarchivs Karlsruhe, Teil 6, Bestände des Alten Reiches, insbesondere Generalakten (71-228), Stuttgart 2006, S. 225.
- Bestandslaufzeit
-
[1294]-1846
- Weitere Objektseiten
- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs
- Letzte Aktualisierung
- 03.04.2025, 11:03 MESZ
Datenpartner
Landesarchiv Baden-Württemberg. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Bestand
Entstanden
- [1294]-1846