Urkunde
Wigand Volker, Kleriker der Diözese Mainz, Notar kaiserlicher Autorität und Johann Bingertiner, Kleriker der Diözese Würzburg, Notar kaiserlicher ...
- Reference number
-
1041
- Formal description
-
Ausfertigung, Pergament, zwei Notarszeichen
- Further information
-
Identifikation (Urkunde): Originaldatierung: ... des sin inden jaren daman zalt nach Krists gepured viertzehenhundert unde dem sibenundsechtzigsten jaren inder funffzehenden keyser zal indes aller heyligsten Ingod vaters und Herrn unsers herrn Pauli von Gotlicher fursichtigkeyt baptss des andern im dritten jare siner kronunge auf Mantag nach sant Bartholomes tagk der da ist der einunddrissigkst und der lest tag des mandes zu latin Augustus gnant in den gnanten dorff Saltzslirff mentzer bysthuems
Vermerke (Urkunde): (Voll-) Regest: Wigand Volker, Kleriker der Diözese Mainz, Notar kaiserlicher Autorität und Johann Bingertiner, Kleriker der Diözese Würzburg, Notar kaiserlicher Autorität, bekunden, dass sie in Anwesenheit von Zeugen ein Notariatsinstrument über die Verlesung eines Schiedsspruchs im Gericht durch Konrad von Iringhausen von einem Schreiber haben anfertigen lassen. Zwischen Reinhard [von Weilnau], Abt von Fulda, einerseits, und Hermann und Georg (Jörg) Riedesel andererseits war es wegen des Dorfes [Bad] Salzschlirf zu einer Fehde gekommen. Ludwig [II.] und Heinrich [III.], Landgrafen von Hessen, Brüder, haben beide Parteien nach dem Wortlaut einer 1467 Juni 29 (in dem jare da man zalt nach Crists gepured viertzehenhundert und in dem sybenundsechzigsten jaren auf Montag Petri et Pauli den heyligen aposteln tag zu Zigenhain) in Ziegenhain ausgestellten Urkunde ausgestellten, von allen Beteiligten besiegelten Urkunde die Fehde beigelegt. Die das Dorf [Bad] Salzschlirf betreffenden Punkte sind inseriert: Die Männer des Gerichts sollen zusammenkommen, und dann kann jede Partei ihr Anliegen vorbringen; die getroffene Entscheidung soll gültig sein; die Sitzung soll am Montag nach Bartholomäus (auf Mantag nehest nach sant Bartholomes tag) [1467 August 31] stattfinden. Frank von Mörle, Dekan von Fulda, Konrad von Allendorf, Propst von Johannesberg bei Fulda für den Konvent von Fulda; Stam von Schlitz genannt Görtz, Marschall des Klosters, Heinrich Küchenmeister und Bosse von Buchenau, Räte des Abtes für den Abt; Konrad (Cord) von Iringhausen und Hermann von Treisa, Pfarrer in Lauterbach [?] (Lutterenbach), Johann Kuchberg, Pfarrer in Rückerode [?] (Rugebrode) und Johann Pfannenstiel (Pfanstyel) [Kleriker der Diözese Würzburg] für die von Riedesel treten vor dem Gericht des Dorfs [Bad] Salzschlirf, besetzt mit Konrad (Cuntzen) Lune, Schultheiß des Konvents, und zwölf Schöffen auf. Stam von Schlitz genannt Görtz beruft sich im Namen des Kapitels auf den zuvor genannten Artikel und fordert, dass der Zwist zwischen dem Abt und den von Riedesel in diesem Gericht von den Schöffen entschieden werden und den Schöffen der Artikel bekanntgegeben werden soll. Darauf antwortet Johann Pfannenstiel für die von Riedesel, dass die Vertreter der von Riedesel von diesen den Auftrag hätten, dem Gericht nur zuzustimmen, wenn ihr Schultheiß, Johann (Hans) Atterbein, dem Gericht angehört; sollte dies nicht zu erreichen sein und um weiteren Aufschub zu vermeiden, fordern sie die Abberufung des Fuldaer Schuldtheißen Konrad Lune; dies wird von beiden Parteien gebilligt. Johann Pfannenstiel fordert ebenfalls die Verlesung des genannten Artikels; danach fordert er die Verlesung der Urkunde über den Anspruch der von Riedesel; die Verlesungen werden durch Johann Pfannenstiel und Reinhard Schenk (Schengken) [von Stedtlingen], Kanzleischreiber des Abts, vorgenommen; darauf verliest Johann Pfannenstiel zwei Urkunden über die Rechte [der von Riedesel an dem] Dorf [Bad] Salzschlirf. Stam von Schlitz genannt Görtz bestreitet die Authentizität des Inhalts der Urkunden, da die Befragten teils bei den von Riedeseln in Lohn stehen und teils auswärtig geboren sind; außerdem sind die Urkunden nicht am richtigen Ort ausgestellt (... nicht gemacht an iren pillichen und zimelichen steden), wodurch sie an Wert verlieren. Daraufhin lassen Dekan, Propst und andere Räte des Abtes eine Urkunde über die Zustände in [Bad] Salzschlirf (wie vorn alles gewist were) durch Reinhard Schenk [von Stedtlingen] verlesen. Nach Versicherungen beider Parteien ziehen sich die Schöffen zu einer langen Beratung zurück. Nachdem sie sich wieder gesetzt haben, wendet Konrad von Iringhausen gegen die Schöffen ein, dass sie zu ihrer Beratung Parteivertreter zugelassen haben. Dagegen verteidigen sich die Schöffen, da sie Vertreter beider Partein hinzugezogen haben und einige der Geladenen nicht erschienen sind. Der Schöffe Johann (Hans) Reyt fragt beide Parteien, ob sie mit der Auskunft über die Gewohnheiten des Dorfs zufrieden sind. Stam von Schlitz genannt Görtz und Johann Pfannenstiel stimmen im Namen ihrer Herrn zu. Daraufhin gibt Vitus (Vitt) Lewer, einer der Schöffen, den Umfang des Gerichtsbezirks bekannt: [an Bezeichnungen werden genannt] Fronstein oder Hofvogtstein, Steinhang, Alderfelt, Mündung der Eichenau, Heynerborg [?], Breite Heide (Breyttenheyde), Heimbach, Steinbäume, Fulwidischborn, (Marrpachgrund) [Mortpachgrund?], (Lowichs Bugkich) [?], alter Hepford, Heilige Lyten [?], Gogkenberg, Steinengken, Hard, Scheideichen, Weg zum Steinberg, Setelstein, Höhenpfad, Melnbergs Koppen, Krangesgenn [?], Heylnrode, Grund, Borngen, Dragkenbach, Höhenaspen, Klingenpfad, Holn, Fererfurt, Rederstad, alte Landwehr, Hemwe, Luttersgrund, Smedestein-Koppe, Mittelstein, Hinderstein, die drei Koppen nennt man auch Singersborg, Huenstein, Erlesgraben, Celegraben [?], Siberbach [?], Grundelosborne, Huenstagk Folderbodem, Lindach, Glitsiffe, Gerichtsstein. Heinrich Himmelreich (Heintz Hymelrich), ein anderer Schöffe, teilt mit, dass bei einem Totschlag im Gerichtsbezirk das Besthaupt nicht dem Abt zufällt, wenn der Totschlag außerhalb des Bezirks (angewende henueß) [an einem Bewohner des Bezirks] geschieht. Geschieht der Totschlag aber innerhalb des Bezirks, fällt das Besthaupt an den Abt. Der Abt hat das Recht zur Einsetzung und Absetzung bei Wasser und Weide, den Wildfang, Gebot und Verbot, Heeresfolge (volge) soweit wie der Schultheiß zieht; weitere Folge geschieht auf eigene Verantwortung. Der Abt ist verpflichtet, die Beherbergung in [Bad] Salzschlirf durch die [Riedesel] von Eisenbach zu verhindern. Ebenso können die von Eisenbach dem Abt untersagen, hier Herberge zu nehmen, es sei denn, dies geschieht wegen des Klosters Fulda; dann kann der Abt eine Nacht hier verbringen. Kommt der Abt ins Dorf, soll er seine Verpflegung zahlen. Kommt einer der [Riedesel] von Eisenbach ins Dorf, soll er für sein Pferd zahlen und es am Kloersbaum [?] am Zaun anbinden; ein Bewohner kann nun das Pferd an sich nehmen und den von Eisenbach zu sich einladen. Die Räte des Abtes sollen wissen, dass die kleinste Buße 20 Pfennige beträgt und an Abt und Konvent fällt; sie wird für Streit verhängt. Für Rauferei, genannt Bluderwerk, wird eine Buße von fünf Schilling gezahlt. Schlägereien mit Fäusten werden mit siebeneinhalb Schilling gebüßt. (besserten sey aber dy hant, das ist gewassent, und slugen sich nicht mit besserung) fällt an den Zentgrafen. Beleidigen (scholden) sie sich aber, was verboten ist, büßen sie ein Pfund, zahlbar halb an den Abt, halb an die [Riedesel] von Eisenbach; diese Buße kann der Schultheiß des Abtes während der Gerichtssitzung aufheben. Schlagen sie aber gliedlange und nageltiefe Wunden, zahlen sie die höchste Buße von 60 Schilling; davon fällt ein Drittel an Abt und Konvent, ein Drittel an die [Riedesel] von Eisenbach und ein Drittel an den Zentgrafen. Bei Streitigkeiten um Schuld und Schaden soll auf Anforderung des Beschuldigten eine Gerichtssitzung vor dem [Fron-]hof stattfinden. Die Buße soll höchstens fünf Schilling betragen und an den Abt fallen. Wird ein Gut zu Lehen genommen, beträgt die Gebühr nur zwei weiße Tauben. Inhaber von Erb und Eigen sollen auffindbar sein; man soll ihnen keinen höheren Bann auferlegen, auch wenn sie zur Kur sind (dwile er sich under eyn badeschille behalden mag). Bewohner sollen nicht zur Ansiedlung anderer oder zur Erhöhung der Zinseinnahmen vertrieben werden. Jeder Bewohner kann mittwochs und freitags Fisch im Wert von drei Pfennigen fangen; dafür hat der Fischer das Recht, eine Reuse auf Gemeinland anzulegen (eyn rasen [?] zugraben auf der gemeine, ein schutz zu machen). Der Fischer soll mit seinem Messer (weydmesser) keine Weiden abschlagen, es sei denn, er steht mit einem Fuß in seinem Nachen und mit dem anderen auf dem Land (staden). Ein Knecht der [Riedesel] von Eisenbach soll bei den Gerichtssitzungen zuhören (hinder dem gericht stehen als ein horcher) und darauf achten, dass der Schultheiß des Abtes nichts vergisst. Die neun Schöffen Heinrich Himmelreich, Hermann Rendt, Hermann Heyman, Konrad Knobelauch, Hermann Frangk, Heinrich Rendt, Hermann Lerich, Vitus Lewer und Gerlach Preusel genannt Post bestätigen auf Nachfrage, dass dies ihr Weistum ist. Dann antworten die drei übrigen Schöffen, Konrad (Cord) Snyder, Johann (Henne) Krauwel und Alban Preusel, auf die Frage, ob dies ihr Weistum ist; Alban sagt aus, dass sie ihr Weistum erst beim nächsten ungebotenen Gericht verkünden wollen; dabei berät er sich mit einem außerhalb des Gerichts. Währenddessen wird Konrad Synder vom Schultheiß befragt; dieser antwortet, dass er den Schultheiß der [Riedesel] von Eisenbach nicht hat stehen sehen. Dies fragt der Schultheiß auch [Alban] und schlägt ihn mit dem Stab auf den Fuß; dieser antwortet, dass er dasselbe aussagt wie sein Geselle, dass nämlich der Schultheiß des von Eisenbach mit ihm über die einheitliche Verschriftlichung des Weistums gesprochen hat. Er fragt, wie er sich verteidigen soll, wenn ihm nicht geglaubt wird. Seine Bankgenossen, die Schöffen, erläutern ihm, dass er sich auf seinen vor Gott und dem Schöffenstuhl abgelegten Eid besinnen soll. Er legt einen Eid ab, nichts anderes auszusagen als sein Geselle Konrad Snyder. Die beiden übrigen Schöffen Konrad Snyder und Johann Krauwel bestätigen obiges Weistum; außerdem haben sie den von Eisenbach nicht stehen sehen. Notarszeichen. (siehe Abbildungen: Vorderseite, Rückseite)
Vermerke (Urkunde): Zeugen: Karl von Lüder, Ritter
Vermerke (Urkunde): Zeugen: Walter [von Mörle genannt] Beheim, Junker
Vermerke (Urkunde): Zeugen: Martin und Wigand von Lütterz (Lutharts)
Vermerke (Urkunde): Zeugen: Reinhard von Wechmar
Vermerke (Urkunde): Zeugen: Reinhard von Lüder
Vermerke (Urkunde): Literatur: Vgl. zum Weistum den Druck des ähnlichen Weistums von 1511/1512 bei Schwank, Weisthum von Salzschlirf, S. 59-70.
- Context
-
Fulda: Reichsabtei, Stift [ehemals: Urkunden R I a] >> Reichsabtei, Stift >> 1461-1470
- Holding
-
Urk. 75 Fulda: Reichsabtei, Stift [ehemals: Urkunden R I a]
- Date of creation
-
1467 August 31
- Other object pages
- Last update
-
10.06.20252025, 9:13 AM CEST
Data provider
Hessisches Staatsarchiv Marburg. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Urkunde
Time of origin
- 1467 August 31
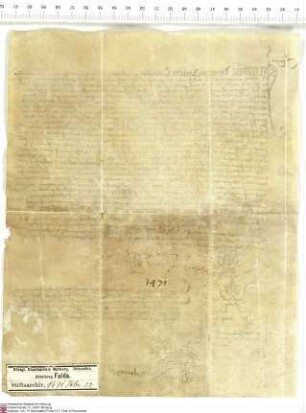
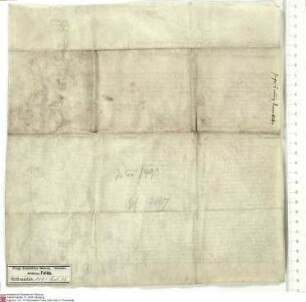

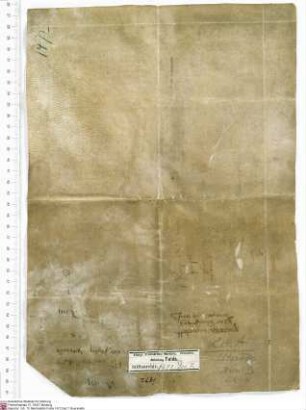
![Heinrich Lose aus Hersfeld, Kleriker der Diözese Mainz, Notar [kaiserlicher] Autorität, lässt ein Notariatsinstrument anfertigen. Konrad Rospach, ...](https://iiif.deutsche-digitale-bibliothek.de/image/2/33f2121c-4b91-40ec-aca2-2a710b65d60b/full/!306,450/0/default.jpg)


