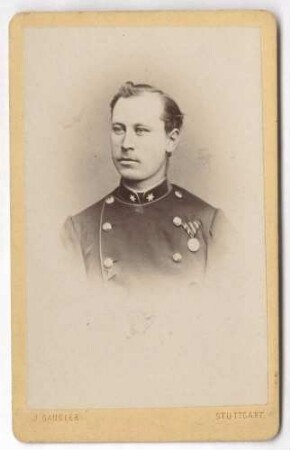Bestand
Archiv der Freiherren Kechler von Schwandorf zu Unterschwandorf (Bestand)
Inhalt und Bewertung
Die Kechler, ursprünglich wohl tübingische und hohenbergische Ministerialen, hatten ihre Besitzungen weitgehend im Gebiet westlich von Nagold. Adelige mit dem Beinamen Kechler lassen sich seit 1281 urkundlich nachweisen. Das namensgebende Schwandorf war seit 1363 württembergischer Besitz, später Eigenbesitz der Kechler, jedoch seit dem 16. Jahrhundert württembergischer Besitz. Zum Besitz der Familie gehörte daneben Ober- und Untertalheim, das Adelsgut in Gündringen, das Gut Dürrenhardt, sowie mehrere Häuser in Pforzheim und das durch Heirat erworbene Dorf Diedelsheim bei Bretten. Ein großer Teil des Besitzes musste jedoch seit dem 17. Jahrhundert nach und nach verkauft werden.
Das Archiv der Kechler von Schwandorf hat unter der Aufteilung nach dem Tod des letzten männlichen Nachkommens 1924 stark gelitten. Daneben traten auch Verluste durch Brand und unzureichende Lagerung auf. Im Rahmen eines von der Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg geförderten Projekts konnte 1995 das gesamte bekannte Schriftgut des Archivs der Kechler von Schwandorf inventarisiert werden. Die als Depositum hinterlegten Akten und Amtsbücher wurden mit den schon seit längerem im Hauptstaatsarchiv Stuttgart verwahrten Unterlagen vereinigt. Der Urkundenbestand wurde aus den seit 1941 im Hauptstaatsarchiv Stuttgart verwahrten Urkunden, den weiterhin in Schwandorf verwahrten, nun sicherungsverfilmten Urkunden, den Regesten der Achivpflegeraufnahme von 1894 und Regesten aus einem Repertorium von 1629 rekonstruiert.
1. Zur Geschichte der Familie Kechler von Schwandorf und ihrer Besitzungen: Als erste Nennung in den Quellen taucht 1270 mit der Bezeichnung conradus miles de swaindorf ein Angehöriger des Schwandorfer Ortsadels auf. Adelige mit dem Beinamen Kechler lassen sich ab 1281 urkundlich nachweisen. Erwähnt wird damals ein Ritter Diemone Kacheler in einem Schiedsspruch des Grafen Heinrich von Fürstenberg. Die Kechler, ursprünglich wohl tübingische und hohenbergische Ministerialen, hatten ihre Besitzungen weitgehend im Gebiet westlich von Nagold. Schwandorf, zunächst zur Herrschaft Nagold gehörig, war zuerst in tübingischem, dann hohenbergischem Besitz und gelangte 1363 an Württemberg. Später im Eigenbesitz der Kechler, wurde Schwandorf im 16. Jahrhundert württembergisches Lehen. In einem Vergleich trug 1516 Hans Kechler der Jüngere seinen Besitz zu Schwandorf unter Einschluß von Frevel und Buße dem Herzogtum Württemberg zu Lehen auf, nachdem es um die niedere Gerichtsbarkeit im Ort eine Auseinandersetzung mit Württemberg gegeben hatte. Zum Ritterkanton Neckar-Schwarzwald gehörig, kam Schwandorf 1805 unter württembergische Hoheit. 1288 verpfändete Ludwig Pfalzgraf zu Tübingen Diem genannt Kacheller das Dorf Obertalheim. Diem und dessen Erben behielten dieses als Lehen, da es nicht wieder ausgelöst wurde. Nach dem Übergang der Lehenshoheit an die Grafen von Hohenberg umfaßte dieses Lehen 1385 Obertalheim und einen Teil Untertalheims. Mit der Veräußerung der hohenbergischen Besitzungen an Österreich wurden auch die kechlerschen Güter zu Ober- und Untertalheim österreichisches Lehen. In den österreichischen Lehensbriefen taucht als weiterer Lehensbestandteil eine Taverne in Baisingen auf. 1466 kaufte Benz Kechler von Schwandorf von Ludwig von Emershofen das halbe Dorf Untertalheim und Besitzungen in Obertalheim, die ebenfalls österreichisches Lehen waren. In Talheim besaßen die Kechler auch allodiale Güter. Kaufbriefe von 1349, 1353, 1354 und 1367, 1543 und 1546 belegen den Erwerb von Gütern zu Unter-und Obertalheim aus dem Besitz der Familien von Talheim, von Bellenstein und anderer Personen. Einen Hof zu Obertalheim erwarb Hans Caspar Kechler von Schwandorf um 1582 von Jakob Eyting. Schließlich bezog die Familie Zehntabgaben aus Untertalheim: 1549 verlieh Graf Friedrich von Fürstenberg Konrad Kechler von Schwandorf den vierten Teil des Laienzehnten zu Untertalheim, den dieser 1547 von David Bletz von Rotenstein gekauft hatte. Trotz österreichischer heim. Die Blutgerichtsbarkeit über Schwandorf haben die Kechler nie besessen, über Diedelsheim wohl nicht ausgeübt, da sie von der die Landeshoheit beanspruchenden Kurpfalz wahrgenommen wurde. Als reichsunmittelbare Ritter nahmen die Kechler die niedere Gerichtsbarkeit für Schwandorf und Talheim durch ihr Amt - nach der Mediatisierung Patrimonial-(Stabs)amt - zu Altensteig wahr, jedoch nicht ohne mit den jeweiligen württembergischen, vorderösterreichischen und hohenbergischen Ämtern, dem Ober(vogtei)amt Horb und den Kreisämtern Rottenburg und Hirsau Kompetenzstreitigkeiten auszutragen. 1809 hob Württemberg die Patrimonialgerichtsbarkeit in seinem Territorium auf, was zum Verlust der ortspolizeilichen und gerichtsherrlichen Rechte der Familie führte. Über Patronatsrechte verfügten die Freiherren von Kechler zu Untertalheim bis zum Verkauf an Freiherr Raßler von Gamerschwang, zu Gündringen bis 1734 und zu Diedelsheim seit 1572. Die Johanniterkommende zu Rohrdorf hatte seit 1734 das Patronatsrecht der wieder selbständig gewordenen Pfarrei zu Gündringen inne. Unterschwandorf selbst besaß keine eigene Kirche, die Schloßkapelle wurde 1869 für den öffentlichen Gottesdienst freigegeben. Die Kirche zu Oberschwandorf war eine Filiale der Pfarrei Walddorf bei Altensteig, die erst badisches, dann württembergisches Patronat hatte. Als Ortsherr führte Hans Caspar Kechler von Schwandorf (1513-1576) 1560 die Reformation in Schwandorf und Gündringen ein, doch 1639 konvertierte Hans Melchior (um 1592-1664) zum katholischen Glauben, wodurch sein Herrschaftssitz Gündringen wieder katholisch wurde. Die anderen Linien der Familie blieben jedoch protestantisch. Die Kechler von Schwandorf sind mit Emil Karl Friedrich Albert von Kechler 1924 im Mannesstamm ausgestorben.
2. Zur Archivgeschichte: Die verschiedenen Linien der Familie Kechler von Schwandorf - die Talheimer, Gündringen/Dürrenhardter, Schwandorfer und die Diedelsheimer - haben vermutlich schon früh ihre eigenen Teilarchive ausgebildet. Das im vorliegenden Inventar verzeichnete Archivgut bezieht sich im wesentlichen auf das Schloßgut Unterschwandorf und die Besitzungen in Ober- und Untertalheim, nach dem Verkauf des Schloßguts Obertalheim auf die verbleibenden Restbesitzungen im Ort, und enthält daneben genealogische und andere persönliche Unterlagen der Familienmitglieder. Völlig oder weitgehend fehlen dagegen die aus dem Diedelsheimer sowie dem Gündringer und Dürrenhardter Besitz erwachsenen Akten, die vermutlich an die nachfolgenden Besitzer weitergegeben wurden.2 Nach Auskunft des vorliegenden Archivguts muß es zumindest im 17. Jahrhundert eine Unterbringung von Unterlagen im Schlößchen in Talheim gegeben haben. Ein dort 1631 ausgebrochener Brand vernichtete jedenfalls etliche Papiere. Ein Teil der Ober-und Untertalheim betreffenden Akten ist zudem wohl in das Archiv der Freiherren Raßler von Gamerschwang auf Schloß Weitenburg gelangt. Wahrscheinlich seit dem Verkauf des Schloßguts Obertalheim an den Freiherrn Raßler von Gamerschwang war für die Restbesitzungen der Kechler dort und das Schloßgut Unterschwandorf ein gemeinsamer Amtmann zuständig, der in Nagold, Haiterbach und schließlich in Altensteig ansässig war. Über die 1769 in der Amtsregistratur vorhandenen Urkunden und Akten gibt ein Repertorium Auskunft, das zwischen 1765 und 1769 von dem damaligen Amtmann Jakob Friedrich Maier und dem Substituten Gallus erstellt worden ist. Anlaß war der chaotische Zustand der Amtsregistratur zum Dienstantritt Maiers im Jahre 1760, der beklagt, daß nicht bald mehr ein Fascicul beysammen gelegen und eine Aufteilung in Rubriken völlig gefehlt habe. Diese Aufteilung der Registratur in Rubriken und die Zusammenführung der Akten nach Betreffen, ihre Numerierung und Verteilung auf insgesamt 44 Fächer wurde nunmehr vorgenommen. Bis 1808 wurden die Einträge, vor allem im Bereich der Nachlaßverwaltung, aktualisiert. Nach Ausweis dieses Repertoriums fehlen in dem heutigen Bestand wichtige Aktengruppen. Dies betrifft insbesondere die Vogtgerichts- und Amtsprotokolle, die ab 1626 vorlagen, die Haischregister von 1753-1760, die Rechnungsüberlieferung, die vor 1800 nur in wenigen Stücken vorhanden ist, sowie eine größere Anzahl Ober- und Untertalheim betreffende Niedergerichtsfälle. Weiterhin fehlen im heutigen Bestand größtenteils aus den gerichtsherrlichen und polizeilichen Rechten erwachsene Akten wie die Kauf- und Heiratsbriefe, die Pflegschaftsakten, die Testamente, die Inventuren und Teilungen sowie die Unterpfandbücher und die Schuldverweisungen. Möglicherweise wurden diese Unterlagen später an die staatlichen und kommunalen Rechtsnachfolger extradiert. Die Ober- und Untertalheimer Heiligenrechnungen und Kapitalbriefe sind, einem Eintrag im Repertorium zufolge, an die Heiligenladen der beiden Orte abgegeben worden. Ein Lagerbuch über die Schwandorfer Zinse und Gefälle von 1720 wurde bereits Ende des 18. Jahrhunderts nicht mehr aufgefunden. Bauunterlagen vor 1800, etwa bezüglich des von Heinrich Schickhardt im 17. Jahrhundert erneuerten Schlosses in Unterschwandorf, sind nicht erhalten, waren aber auch schon 1769 nicht verzeichnet. Vermutlich im Zusammenhang mit dem Verlust der Patrimonialgerichtsbarkeit und der Auflösung des Patrimonialamts zu Altensteig 1809 wurde die zuvor beim Amtmann geführte Registratur nach Schloß Unterschwandorf gebracht. Eine 1894 vorgenommene Aufnahme der Bestände des Schloßarchivs durch den damaligen Archivpfleger für den Bezirk Nagold, den Vollmaringer Pfarrer Josef Reiter (1849-1917), die dieser für die Württembergische Kommission für Landesgeschichte gefertigt hatte, enthält zwar Regesten von 130 Urkunden und den Eintrag etlicher Lagerbücher, jedoch bezüglich des Aktenbestands völlig unzureichende Beschreibungen, so daß nicht mehr ermittelt werden kann, was von den heute verschollenen Akten Ende des 19. Jahrhunderts noch vorhanden war. Anfang des 20. Jahrhunderts sind neuerliche Bemühungen um eine Neuordnung der Unterlagen nach größtenteils genealogischen Gesichtspunkten festzustellen, die vielleicht vorher teilweise noch vorhandene Strukturen fast völlig zerstörten. Die schlechte Lagerung des Archivs auf dem Dachboden, die Umlagerung und sogar Verbrennung eines Teils der Akten während des Kriegs führten zu Schäden und zu nicht genauer zu bezeichnenden Verlusten bei den Unterlagen. Schon ab 1936 hatte es Versuche von Seiten der Württembergischen Archivdirektion, des Württembergischen Landesamts für Denkmalschutz sowie des (Haupt)Staatsarchivs Stuttgart gegeben, Informationen über Umfang und Zustand des Schloßarchivs Unterschwandorf zu bekommen und einer eventuellen Veräußerung ins Ausland vorzubeugen. 1938 wurde das Archiv unter Denkmalschutz gestellt. 1941 stellte das Hauptstaatsarchiv bei entsprechenden Nachforschungen fest, daß sich das Archivgut nicht mehr auf Schloß Schwandorf befand. Vielleicht als Folge der daraufhin aufgenommenen Kontakte mit Frau Gisela von Kechler geb. Schertel von Burtenbach gelangten Bruchstücke des Archivs der Freiherren Kechler von Schwandorf aus deren Besitz an das Hauptstaatsarchiv. Die damals übergebenen Urkunden und Akten wurden unter der Signatur B 100 c in die Bestände des (Haupt)Staatsarchivs Stuttgart eingegliedert und von Archivrat Karl Otto Müller vorläufig verzeichnet. Einige der abgegebenen Urkunden gelangten in die Bestände A 155, A 315 und A 394. Zwei Lagerbücher aus Bestand B 100c wurden später dem Lagerbuchbestand H 180 Bd. 243 und 246 hinzugefügt. Auch drei Auszüge aus Lagerbüchern der Familie Kechler von Schwandorf, vom Finanzarchiv übernommen, finden sich im Lagerbuchbestand H 180 Bd. 242, 244 und 245. 1949 wird das Schloßarchiv Unterschwandorf abermals in den Akten des Hauptstaatsarchivs erwähnt, es wurde sogar ein Ankauf erwogen. Auskünfte über Umfang und Zustand des Archivs waren jedoch nicht zu erhalten. Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre wurden erneut Überlegungen zur Sicherung des kechlerschen Archivs angestellt. Schließlich konnten im Rahmen einer von der Landesarchivdirektion Baden-Württemberg betreuten und von der Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg finanzierten Erschließungsmaßnahme die restlichen Urkunden und Akten des Schloßarchivs Unterschwandorf geordnet und verzeichnet werden, wobei die Urkundenverzeichnung durch Frau Dr. Dagmar Kraus, die Aktenverzeichnung durch Frau Dr. Heike Talkenberger erfolgte. Die Akten wurden als Depositum im Hauptstaatsarchiv Stuttgart hinterlegt, während die im Eigentum der Erben der Familie von Kechler verbleibenden Urkunden nach ihrer Verfilmung zunächst weiterhin auf Schloß Unterschwandorf verwahrt werden sollen.
3. Zur Ordnung und Verzeichnung der Akten und Amtsbücher: Der Ordnungszustand der Akten des Schloßarchivs war vor der Neuverzeichnung wieder ähnlich wie 1760 - kaum ein Faszikel war noch vollständig im Zusammenhang erhalten. So wurde zunächst eine Vorsortierung des rund 4,5 Regalmeter umfassenden Bestands vorgenommen. Dabei mußten zum größten Teil die Akteneinheiten erst wieder gebildet werden, die nicht zuletzt durch die Ordnung des Archivs im frühen 20. Jahrhundert zerstört worden waren. Die mit rotem Stift auf den Aktenstücken vermerkten angeblichen Entstehungsdaten der Schriftstücke, die im Zuge dieser Maßnahme vergeben worden waren, sind übrigens häufig unrichtig. Für den Gesamtbestand wurde eine neue Gliederung erstellt. Eine Orientierung an der Klassifizierung des Repertoriums von 1769 erschien schon wegen der zahlreichen Aktenverluste nicht sinnvoll. Da die Kontinuität der Aktenführung durch die Gutsverwaltung sichtbar bleiben sollte, wurde auf eine Aufteilung in ältere und neuere Akten, etwa orientiert an dem Jahr 1809 mit dem Verlust der Patrimonialgerichtsbarkeit, verzichtet. Bei der Gliederung war zu unterscheiden zwischen den Unterlagen, die den Familienangelegenheiten der Kechler von Schwandorf zuzuordnen sind und denjenigen, die die Gutsverwaltung, die Wahrnehmung der hoheitlichen Rechte und das Verhältnis zu auswärtigen Gemeinden und Herrschaftsträgern betreffen. Dabei ergab sich eine Aufspaltung der Lehensangelegenheiten. Während die Lehenrequisitionen, Lehenbriefe und Mutscheine als Familiensache behandelt wurden, sind die Lehensbeschreibungen im Zusammenhang mit Lagerbüchern und Anschlägen zu finden, da sie detaillierter Auskunft über die gutsherrlichen Rechte und Besitzungen geben. Die Prozesse zu besitzrechtlichen Fragen kamen je nach ihrem Anlaß entweder in die Rubrik Hinterlassenschaften oder strittige Rechte. Die Rechnungsüberlieferung wurde entsprechend ihres Entstehungszusammenhangs aufgeteilt in die Rentamtsrechnungen, die zum Gesamtbesitz der Familie vom Gutsbesitzer zu Unterschwandorf geführten sowie die zum Ertrag des Guts vom jeweiligen Gutsverwalter angelegten Rechnungen. Die Korrespondenz der Amtleute mit dem jeweiligen Gutsbesitzer auf Schloß Unterschwandorf, mit an-deren Familienmitgliedern oder mit den Vormündern wurde zu eigenen Akten zusammengestellt, da diese Schreiben oft die unterschiedlichsten Materien umfassen und so nicht sinnvoll in die Gliederungsrubriken zur Gutsherrschaft eingeordnet werden konnten. Insbesondere bei den Akten zur Gutsverwaltung und zu den Hoheitsrechten wurde, wie dies auch die Registratur des 18. Jahrhunderts schon tat, zwischen Schwandorfer und Talheimer Betreffen unterschieden. Eine gesonderte Aufnahme der Karten erfolgte wegen deren geringer Anzahl nicht; sie verblieben ebenso wie die Bauzeichnungen und andere Handskizzen im Aktenzusammenhang und sind in den Darin-Vermerken ausgeworfen. In den neugegliederten Hauptteil des inzwischen als Depositum im Hauptstaatsarchiv Stuttgart hinterlegten Archivs Unterschwandorf wurden in einem zweiten Schritt die bereits seit längerem im Hauptstaatsarchiv lagernden Akten des Splitterbestands B 100 c Kechler von Schwandorf im Umfang von rund 0,5 Regalmetern eingeordnet. Der so entstandene Gesamtbestand der Akten erhielt die Signatur Q 3/49. Trotz der unterschiedlichen Rechtsverhältnisse der beiden ursprünglich zusammengehörigen Teile des Schloßarchivs wurden die Archivalien angesichts deren enger Verzahnung bis auf die unterste Aktenstufe auch physisch vereinigt. Die Nutzung durch die Forschung ist dadurch wesentlich erleichtert. Der gesamte Akten- und Amtsbuchbestand umfaßt nunmehr 494 Akteneinheiten im Umfang von rund 5 Regalmetern.
Literatur: Otto von Alberti: Württembergisches Adels- und Wappenbuch. 2 Bände. Stuttgart 1899-1916. Beschreibung des Oberamts Nagold. Hrsg. vom Königlichen statistisch-topographischen Bureau. Stuttgart 1862. Otto Bickel: Diedelsheim. Vom ritterschaftlichen Dorf zum Brettener Stadtteil. Bretten 1985. (Brettener stadtgeschichtliche Veröffentlichungen 9). Otto Bickel: Die Freiherren Kechler von Schwandorf. In: Kraichgau. Beiträge zur Landschafts- und Heimatforschung 11 (1989) S. 144-161. Fr. Cast.: Historisches und genealogisches Adelsbuch des Königreichs Württemberg. Stuttgart 1839. Europäische Stammtafeln. Begründet von Wilhelm Karl Prinz zu Isenburg. Fortgeführt von Frank Baron von Loringhoven. Neue Folge. 11 Bände. Hrsg. von Detlev Schwennicke. Marburg 1980-1986. Dieter Hellstern: Der Ritterkanton Neckar-Schwarzwald 1560-1805. Tübingen 1971. J. Kindler von Knobloch: Oberbadisches Geschlechterbuch. Hrsg. von der Badischen Historischen Kommission. 3 Bände. Heidelberg 1898-1919. Gerd Kollmer: Die schwäbische Reichsritterschaft zwischen Westfälischem Frieden und Reichsdeputationshauptschluß. 1979 Das Land Baden-Württemberg. Amtliche Beschreibung nach Kreisen und Gemeinden. Hrsg. von der Landesarchivdirektion Baden-Württemberg. 8 Bände. Stuttgart 1974-1983. Neues Allgemeines Deutsches Adelslexikon. Hrsg. von Ernst Heinrich Kneschke. 9 Bände. Leipzig 1859-1870. Johann Ottmar. Die Burg Neuneck und ihr Adel. Göppingen 1974. Josef Reiter. Das Spitalarchiv in Horb. Stuttgart 1950. (Württembergische Archi-vinventare 20). 0[tto] K[onrad] Roller: Die Ahnentafel der Markgräfin Ursula von Baden-Dur-lach und die Wappen auf dem Sarkophag in der Schloßkirche zu Pforzheim. In: Schauinsland 33 (1906) S. 35-49. Ludwig Schmid: Geschichte der Pfalzgrafen von Tübingen. Tübingen 1853. Ludwig Schmid: Monumenta Hohenbergica. Urkundenbuch zur Geschichte der Grafen von Zollern-Hohenberg und ihrer Grafschaft. Stuttgart 1862. Die Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg. Der Landkreis Tübingen. Amtliche Kreisbeschreibung. Hrsg. von der Staatlichen Archivverwaltung in Verbindung mit dem Landkreis Tübingen. 3 Bände. Tübingen 1967-1984. Wirtembergisches Urkundenbuch. 11 Bände. Stuttgart 1849-1913.
- Bestandssignatur
-
Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Q 3/49
- Umfang
-
509 Büschel (7,00 lfd. m)
- Kontext
-
Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart (Archivtektonik) >> Nachlässe, Verbands- und Familienarchive >> Verbands- und Familienarchive
- Verwandte Bestände und Literatur
-
gedr. Findbuch: Archiv der Freiherren Kechler von Schwandorf, Schloß Unterschwandorf / bearb. von Dagmar Kraus und Heike Talkenberger. -
Stuttgart : Kohlhammer, 1996. - 256 S.
(Inventare der nichtstaatlichen Archive in Baden-Württemberg ; Bd. 22)
- Indexbegriff Person
- Bestandslaufzeit
-
1288-1954
- Weitere Objektseiten
- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs
- Rechteinformation
-
Es gelten die Nutzungsbedingungen des Landesarchivs Baden-Württemberg.
- Letzte Aktualisierung
-
20.01.2023, 15:09 MEZ
Datenpartner
Landesarchiv Baden-Württemberg. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Bestand
Entstanden
- 1288-1954