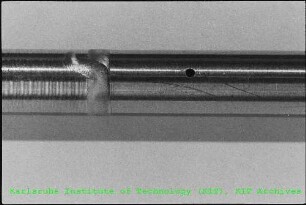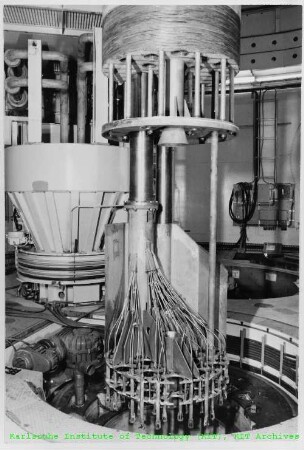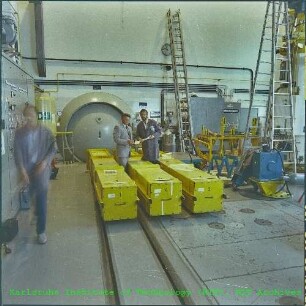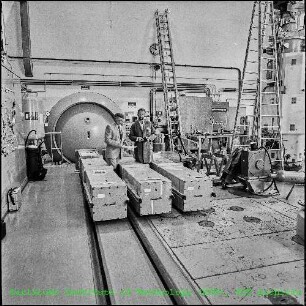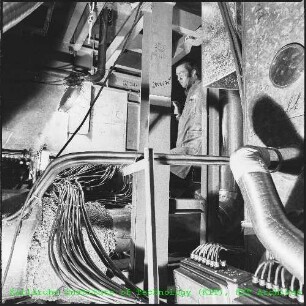Bestand
Kernforschungszentrum Karlsruhe: Kompakte Natriumgekühlte Kernenergieanlage (KNK) (Bestand)
Überlieferungsgeschichte: Bei
der Kompakten Natriumgekühlten Kernenergieanlage handelt es sich um
einen Versuchsreaktor, der auf dem Gelände des Forschungszentrums
in Karlsruhe zunächst als thermischer Reaktor konzipiert worden
war. Der vorliegende Bestand enthält die Projektakten der Kompakten
Natrimgekühlten Kernenergieanlage (KNK), die in einem Raum des
KNK-Gebäudes vom ehemaligen Projektleiter Willy Marth
zusammengetragen worden waren. Ein Teil des Bestandes besteht
sowohl aus Handakten von W. Marth, als auch aus einer privat
zusammengestellten Materialsammlung zum European Fast Reactor (EFR)
und zugehörigen Konferenzunterlagen, die im Findmittel als
Sonderbestand Marth ausgewiesen sind. Durch den Wechsel von W.
Marth am 1. Oktober 1989 zum EFR-Projekt, fanden zusätzlich
EFR-Akten Eingang in diesen Bestand. Durch Hans-Jürgen Goebelbecker
wurde der Wunsch nach einer raschen Bewertung und Übernahme der
Akten an das Landesarchiv Baden-Württemberg-Generallandesarchiv
Karlsruhe (GLA). herangetreten. Ende September 2012 erfolgte die
Einlieferung in das GLA. Bei der Kompakten Natriumgekühlten
Kernenergieanlage handelt es sich um einen Versuchsreaktor, der auf
dem Gelände des Forschungszentrums in Karlsruhe zunächst als
thermischer Reaktor konzipiert worden war. Die Geschichte der
Versuchsanlage lässt sich grob in fünf Phasen einteilen (Anm. 1).
In den Jahren 1957-1974 wurde die Planung, Konzeption und
Errichtung der Anlage erarbeitet. In diese erste Phase fällt auch
die Einbindung in das Projekt Schneller Brüter (PSB). Der von der
Firma Interatom seit 1960 entworfene KNK-Reaktor mit einer
geplanten Leistung von 20 MWe wurde von Anfang an als bedeutsam für
das PSB angesehen, "da an ihm die Natriumtechnologie als eine der
wichtigsten Kühlmöglichkeiten für einen schnellen Brüter unter
vollen Arbeitsbedingungen, erprobt werden und ein Corekonzept
realisiert werden könnte, das bereits verschiedene nicht nukleare
Züge künftiger schneller Reaktoren in sich trägt" (Anm. 2). Ab 1964
erwog man, die Anlage nach einer gewissen Betriebszeit auch zur
Brennelementerprobung für das PSB zu nutzen, indem unter anderem
zahlreiche Bestrahlungsversuche durchgeführt wurden. Hierbei wurde
neben Mischoxid auch Karbidbrennstoff eingesetzt. Nach der
Erteilung des Lieferauftrages für die Anlage 1966, wurde diese Ende
1969 fertig gestellt. Anschließend begann die Inbetriebnahmephase,
die mit dem erstmaligen Hochfahren der Anlage auf 100 % Leistung
1974 abgeschlossen wurde. Im Jahr 1973 übernahm die
Kernkraftwerk-Betriebsgesellschaft mbH (KBG), eine
Tochtergesellschaft des Energieversorgers Badenwerk AG, die
Verantwortung für die Betriebsführung. Im September 1974 kam es zur
Abschaltung der KNK, um die Anlage auf die geplante Umrüstung
vorzubereiten. Die zweite Phase (1968-1977) markiert den Umbau der
nun KNK I benannten Anlage zur KNK II, um ihre Betriebsbedingungen
durch die Umrüstung mit einem schnellen Kern den Anforderungen des
PSB anzunähern. Bei der Brüterentwicklung war man zunehmend auf die
Nutzung von Versuchsreaktoren angewiesen, um diese als Testbett für
die Brennelemententwicklung und -erprobung einsetzen zu können. Die
KNK II-Durchführbarkeitsstudie wurde seitens der Projektleitung
sehr begrüßt, sah man doch den Einsatz eines schnellen Cores in der
KNK als eine wesentliche Voraussetzung bei der Entwicklung von
Brutreaktoren an. Bereits in dieser frühen Umrüstungsphase waren
die Anforderungen an die Sicherheit der Anlage und die Auflagen der
genehmigenden Behörden erheblich gestiegen. So wurde u.a. der Umbau
von KNK I auf KNK II seitens der Genehmigungsbehörden wie der Bau
einer Neuanlage gehandhabt. Daraus ergaben sich massive
Zeitverzögerungen für den regulären Betrieb der Anlage. Im Juni
1974 konnte mit der Firma Interatom der KNK II-Liefervertrag
abgeschlossen werden. Die Brennelemente wurden durch die Fa. Alkem
und die Reaktor Brennelement Union GmbH (RBU) hergestellt. Der
nukleare Betrieb mit dem Erstkern KNK II (KNK II/1) stellt die
dritte Phase des Projektes von 1977-1983 dar. Am 3. März 1979
erreicht die Anlage zum ersten Mal Volllast und wurde am 6.
November 1980 von der Firma Interatom an das Kernforschungszentrum
Karlsruhe (KfK) übergeben, die wiederum erneut die KBG mit der
Überwachung und Regelung des Betriebs beauftragte. Nach Erreichen
der Volllast wurde die KNK II mit Teillast und Schieflast gefahren,
und erzielte wichtige Erkenntnisse zur Lokalisierung defekter
Brennelemente. Mit diesen defekten Elementen wurde ein breit
angelegtes Versuchsprogramm durchgeführt und einzelne Elemente im
Anschluss in der Pilotanlage Millitonne (MILLI) der
Wiederaufarbeitung zugeführt. Für die notwendige Entsorgung der
Kerne der KNK II schloss man im Dezember 1980 eine Vereinbarung mit
dem Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA) für deren
Wiederaufarbeitung in Marcoule. Nachdem die Anlage 1981 den
vertraglich vereinbarten Zielabbrand erreicht hatte und
Reaktivitätsreserven zur Verfügung standen, beantragte man bei den
Genehmigungsbehörden eine Standzeitverlängerung. In die vierte
Phase (1983-1991) fiel der Betrieb des Zweitkerns KNK II (KNK
II/2). Während des Prozesses der Auslegung und Fertigung des
Zweitkerns kam es zu umfangreichen Spezifikationsveränderungen, so
dass sich die neue Kernauslegung erheblich von den bisher Erprobten
unterschied. Dem Hüllmaterial für die Brennstäbe wurden im Rahmen
des Versuchsprogrammes "Hüll- und Strukturwerkstoffe" große
Aufmerksamkeit gewidmet. In diese Phase viel auch eine breit
angelegte Entwicklung neuer Fertigungsverfahren für
Brüterbrennstoff durch die Firma Alkem. Der Betrieb der KNK ergab
weiterhin wichtige Anreize und Impulse für die Arbeiten des PSB.
Durch auftretende Probleme im Zusammenhang mit dem
Schwingungsverhalten von Brennelementen im Kern geriet der
Betriebsverlauf immer wieder ins Stocken. Zusätzlich kam es in den
letzten Betriebsjahren wiederholt zum Betriebsstillstand, der zum
einen durch notwendige Instandhaltungsarbeiten und zum anderen
durch Handhabungsprobleme ausgelöst worden war. Zusätzlich
verursachten nicht eintreffende Genehmigungen weitere
Stillstandszeiten. Die Schlussphase des Projektes vfiel in die
Jahre von 1989-1991. Das Alter der Anlage, die Erfüllung der
gestellten Aufgaben, die steigenden Sicherheitsanforderungen durch
die Genehmigungsbehörden sowie anhängige Klagen gegen weitere
Standzeitverlängerungen beeinflussten die Überlegungen über die
Zukunft der Anlage. Die Beendigung des PSB und die Einstellungen
der Arbeiten am Schnellen Natriumgekühlten Reaktor (SNR 300)
führten, zusammen mit einer veränderten Förderpolitik und
Schwerpunktsetzung für die deutsche Kernforschung auf Landes- und
Bundesebene schließlich zum Beschluss, die KNK-Anlage stillzulegen.
Am 23. August 1991 kam es zur endgültigen Abschaltung.
Sonderbestand Marth: In Europa begann die Zusammenarbeit zur
Errichtung von Brutreaktoren mit über 1000 MWe Leistung im Jahr
1973. In diesem Jahr wurde die sogenannte EVU-Konvention zwischen
EdF, RWE und ENEL unterzeichnet. In ihrer Folge wurde mit der
Errichtung des SUPERPHENIX-Reaktors und den Planungen zum Bau und
Betrieb des SNR 2 begonnen. Im Jahr 1977 kam es zu einer
Kooperation der Reaktorhersteller und Forschungs- und
Entwicklungsorganisationen in den Ländern Frankreich, Deutschland
und Italien, sowie Belgien und den Niederlanden. Nach dem Beitritt
der Engländer im Jahr 1984 wurde 1988 mit der Planung des EFRs,
einem Brüterkraftwerk mit 1500 MWe, begonnen. Die technische
Konzeption der Anlage erstreckte sich über 5 Jahre. Speziell
Deutschland, Frankreich und England sicherten vertraglich zu, das
Projekt durch die Bereitstellung von Forschungsergebnissen auf eine
möglichst breite Basis zu stellen. So sollten beispielsweise die
zukünftigen Arbeiten im Rahmen von PSB vorwiegend zur Entwicklung
des europäischen Großbrüters beitragen. Die Finanzierung des
Reaktorprojektes wurde durch die European Fast Reactor Utility
Group (EFRUG)-Partner gewährleistet, die sich allerdings nicht zu
einer Finanzierung über die wirtschaftlichen Bewertungsphase und
sicherheitstechnischen Analyse hinaus verpflichtet hatten. Zudem
hatten sich England und Deutschland seit Beginn der 1990er Jahre
aus der Finanzierung des F+E-Programms zurückgezogen. Die Ablehnung
der Industriepartner, weitere Mittel für das F+E-Programm zur
Verfügung zu stellen, blieb nicht ohne Auswirkungen auf das
Karlsruher Forschungszentrum, das im Jahr 1993 sämtliche Arbeiten
zum EFR-Projekt einstellte.
Inhalt und Umfang: Der
Bestand umfasst 950 Verzeichnungseinheiten und enthält im
Wesentlichen Akten zur Planung sowie zum Bau und Betrieb der
Versuchsanlage. Dieser Bestand dokumentiert beispielsweise durch
Errichtungs- und Konzeptgutachten, Abnahmeprotokolle und
Bauberichte in großer Ausführlichkeit die Planung und Errichtung
der Anlage und die begleitenden Prozesse. Der Verwaltungsbereich
sowie die interne und externe Organisation des Projektes werden
unter anderem durch den Schriftwechsel der Verwaltungs- und
Entscheidungsebenen und der Beteiligung in Ausschüssen abgebildet.
Innerhalb des im Generallandesarchiv Karlsruhe archivierten
KfK-Materials zu den Versuchsanlagen ist die Dokumentation der
Planungs- und Bauphase der KNK in diesem Umfang einmalig. Eine
weitere Besonderheit der KNK-Anlage stellt die besonders
problematische Genehmigungssituation dar. In der hier vorliegenden
Überlieferung werden die von den Behörden geforderten umfangreichen
Genehmigungsverfahren für alle Phasen des Projektes deutlich. Des
Weiteren geht aus dem Bestand deutlich hervor, inwieweit die KNK
durch ihre Anbindung an das PSB innerhalb des Forschungszentrums
sowie durch die Kooperation mit der Industrie und internationalen
Versuchsanlagen zum wissenschaftlich-technologischen
Kenntnisaustausch beitrug. Die Dokumentation der Versuchsprogramme
und der Brennelemententwicklung unterstreicht dies. Ebenso
ausführlich dokumentiert ist der Bereich der Wiederaufarbeitung.
Einerseits wurden die aus dem Betrieb der Anlage abgebrannten
Brennelemente zur Wiederaufarbeitung nach Marcoule in Frankreich
transportiert, andererseits geht aus einem kleinen Teil der Akten
hervor, in welchem Umfang man sich mit der Wiederaufarbeitung in
eigenen Projekten des Forschungszentrums, wie beispielsweise in der
MILLI und der Wiederaufarbeitungsanlage (WAK), beschäftigte. Im
Zusammenhang mit der Stilllegung der Anlage kam es zur
ausführlichen Beschäftigung mit Entsorgungskonzepten und Fragen der
Abfallbehandlung. In diesem Kontext ist die Kooperation mit der
Industrie ebenfalls gut dokumentiert (siehe das Schrottprogramm der
Fa. Alkem).
Anmerkungen: (1) Marth,
Willy: Die Geschichte von Bau und Betrieb des deutschen
Schnellbrüter-Kernkraftwerkes KNK II. Karlsruhe 1993. (2) GLA 69
KfK-VA Nr. 160; Aufsichtsratssitzung am 2.12.1963, Beschlussfassung
über das KNK-Projekt, S.1.
- Reference number of holding
-
Abt. Generallandesarchiv Karlsruhe, 69 KfK-KNK
- Extent
-
950 Nummern
- Context
-
Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Generallandesarchiv Karlsruhe (Archivtektonik) >> Nichtstaatliches Archivgut >> Archive von Anstalten, Körperschaften und Stiftungen >> Bildung, Kultur und Forschung >> Kernforschungszentrum Karlsruhe
- Other object pages
- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs
- Last update
-
03.04.2025, 11:03 AM CEST
Data provider
Landesarchiv Baden-Württemberg. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Bestand