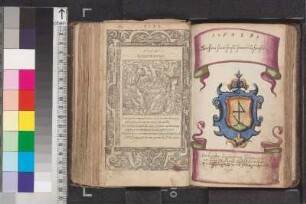On the decay of sunspots
Abstract: Kontext: Sonnenflecken entstehen, wenn starke magnetische Flussröhren an die Oberfläche gelangen. Das starke Magnetfeld in den Flecken reduziert die Konvektion und lässt die Flecken dunkler erscheinen. Direkte Beobachtungen zeigen die Feinstruktur und Dynamik von Sonnenflecken auf der Sonnenoberfäche. Die Struktur der magnetischen Flussröhren in der Konvektionszone, kann jedoch mit direkten Beobachtungen nicht erfasst werden. Sonnenflecken können mehrere Tage, bis zu mehreren Wochen alt werden, während ihre dynamische Zeitskala im Bereich von einer Stunde liegt. Auftriebskräfte können die Flecken in Richtung der Oberfläche stabilisieren, da sich die Flussröhren dort ausdehnen und das Magnetfeld horizontaler wird. Der Zerfallsmechanismus, sowie der Einfluss und die Wechselwirkung der Flecken mit dem umgebenden Plasma sind Teil einer andauernden Diskussion.
Ziele: Die Mechanismen, die einen Sonnenfleck destabilisieren, können nicht direkt beobachtet werden da sie unter der Sonnenoberfläche wirken. Numerische Simulationen ermöglichen den Einblick in Prozesse unter der Oberfläche. Eine Analyse der Struktur, Entwicklung und Stabilität der magnetischen Flussröhre eines Sonnenflecks unter der Oberfläche soll Einblick in den Zerfallsmechanismus eines Sonnenflecks liefern.
Methoden: Wir verwenden wirklichkeitsgetreue MHD-Simulationen eines Sonnenflecks und seiner konvektiven Umgebung. Die Simulationsbox hat eine Grösse von 98x98x18 Mm, dabei werden 700 km der Sonnenatmosphäre und mehr als 17 Mm der Konvektionszone abgebildet. Der analysierte Datensatz umfasst 30 Stunden. Der simulierte Sonnenfleck und die umliegende Region geben an der Sonnenoberfläche das aus Beobachtungen bekannte Aussehen und zeitliche Verhalten wieder. Wir untersuchen die Struktur und Entwicklung der magnetischen Flussröhre unter der Oberfläche. Die Stabilitätsanalyse berücksichtigt die Druckdifferenz zwischen dem Sonnenfleck und seiner Umgebung, sowie die Neigung des Magnetfeldes. Ausserdem wird die Verbindung von `moving magnetic features’ mit der Sonnenoberfläche im Zusammenhang mit der Entwicklung des Flecks analysiert.
Ergebnissen und Fazit: Unter der Sonnenoberfläche ist der Sonnenfleck nicht einfach eine runde Flussröhre. Störungen am Rand der magnetischen Flussröhre verformen diese und geben ihr eine zerklüftete Struktur. Die Ursache ist eine Austauschinstabilität am äusseren Rand der Flussröhre, dabei werden Feldlinien von Regionen mit stärkerem Magnetfeld zu Regionen mit schwächerem Feld transportiert. Etwa 3.5 Mm unter der Oberfläche ist die magnetische Flussröhre am instabilsten und zerklüftetsten. Im Laufe der Zeit werden die Einkerbungen in die Flussröhre tiefer. Die zeitliche Entwicklung zeigt, dass sich die Struktur des Sonnenflecks in einer Tiefe zwischen 6 Mm und 10 Mm unter der Oberfläche am schnellsten entwickelt, mit einer Lebensdauer von weniger als 3 Tagen. Zur Oberfläche hin ist die Entwicklung langsamer. Hier stabilisieren Auftriebskräfte den Sonnenfleck aufgrund der stärkeren Neigung des Magnetfelds. Der kontinuierliche Transport von Feldlinien am äusseren Rand der Flussröhre schwächt das Magnetfeld. Einige Magnetfeldlinien können sich von der Flussröhre des Flecks lösen. `Moving magnetic features', die auf der Sonnenoberfläche beobachtet werden, sind mit den Randbereichen des Sonnenflecks unter der Oberfläche verbunden. Sie sind Indikatoren des Austausch-Prozesses unter der Oberfläche. Darüber hinaus ziehen sie Feldlinien aus dem Sonnenfleck heraus, während sie sich von ihm entfernen. Damit tragen sie zum Verlust von magnetischem Fluss vom Fleck bei, was innerhalb von etwa 4 Tagen zu seinem Zerfall führt. Die Austauschinstabilität zersetzt die magnetische Flussröhre unter der Oberfläche. In Beobachtungen ist dieser Prozess aufgrund der Stabilisierung des Sonnenflecks in Richtung der Oberfläche nicht direkt zu sehen. Im Laufe der Zeit führt der Zersetzungsprozess zu einer Teilung in mehrere Flussröhren und zerstört schliesslich den Sonnenfleck
Abstract: Context: Sunspots are intersections of strong magnetic flux tubes, which penetrate the solar photosphere. They appear as dark patches due to the reduction of convective motions by the strong magnetic field. Observations reveal the fine structure and dynamics of sunspots at the solar surface. The structure of the magnetic flux tube which extends into the solar convection zone remains hidden to real observations. Sunspots can live for days up to several weeks. This is much longer than the dynamical timescale of around an hour. The fanning out of the magnetic field towards the solar surface can stabilise the sunspot due to buoyancy forces. The decay mechanisms and the influence and interaction with the surrounding plasma are part of an ongoing discussion concerning the stability of sunspots.
Aims: Mechanisms destabilising a sunspot cannot be observed directly, since they occur below the solar surface. Numerical simulations enable insight into processes below the surface. A study of the structure, evolution and stability of the magnetic flux tube below the surface should lead to insight into the decay mechanism of a sunspot.
Methods: We make use of realistic MHD simulations of a sunspot and convective surroundings in a simulation domain which covers an area of 98x98 Mm. The vertical extension of 18 Mm covers approximately 700 km of the solar atmosphere and reaches more than 18 Mm into the convection zone. The analysed data set covers 30 hours. The simulated sunspot and the surrounding regions show characteristics and dynamics which agree with observations. We study the structure and evolution of the magnetic flux tube below the surface. A stability analysis is performed by taking into account the pressure difference between the sunspot and its surroundings, and the inclination of the magnetic field. The connection of moving magnetic features, visible at the solar surface, and their relation to the sunspots evolution is studied.
Results and Conclusion: Below the surface, the sunspot is not a simple round flux tube. Perturbations at the boundary of the magnetic flux tube lead to a fluted structure. An interchange instability is responsible for the ragged outer boundary of the sunspot. Field lines are continuously transported from regions of stronger magnetic field to regions of weaker field. The sunspot magnetic flux tube is most unstable at a depth around 3.5 Mm beneath the surface where the raggedness of the sunspot structure is largest. This raggedness increases in time with the indentations becoming deeper. The time evolution shows, that the sunspot structure evolves fastest in between 6 Mm to 10 Mm below the surface with an estimated lifetime of less than 3 days. Towards the surface, the evolution is slower. Buoyancy forces stabilise the sunspot towards the surface, where the magnetic field is more inclined. The continuous transport of field lines at the sunspot boundary leads to a weakening of the magnetic field. Some field lines can detach from the magnetic flux tube. Moving magnetic features which appear at the surface are connected to the regions of interchange. They are tracers of the phenomenon hidden below the surface. In addition, they drag out field lines from the sunspot while they move away from the sunspot. This leads to a magnetic flux loss from the sunspot, which causes its decay within approximately 4 days. Interchange instability leads to a degradation of the sunspot magnetic flux tube below the surface. The stabilisation of the sunspot towards the surface hides this process in observations. In time, the degradation below the surface splits the magnetic flux tube into several smaller ones and eventually destroys the sunspot
- Standort
-
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
- Umfang
-
Online-Ressource
- Sprache
-
Englisch
- Anmerkungen
-
Universität Freiburg, Dissertation, 2019
- Schlagwort
-
Sonnenfleck
Stabilität
Magnetohydrodynamik
Konvektionszone
Simulation
Magnetfeld
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wo)
-
Freiburg
- (wer)
-
Universität
- (wann)
-
2020
- Urheber
- Beteiligte Personen und Organisationen
- DOI
-
10.6094/UNIFR/165760
- URN
-
urn:nbn:de:bsz:25-freidok-1657608
- Rechteinformation
-
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
- Letzte Aktualisierung
-
25.03.2025, 13:49 MEZ
Datenpartner
Deutsche Nationalbibliothek. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Beteiligte
Entstanden
- 2020