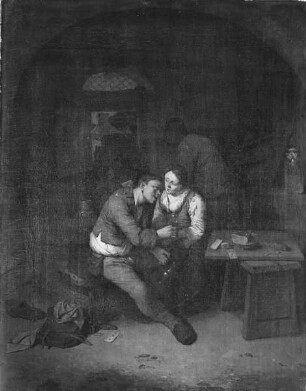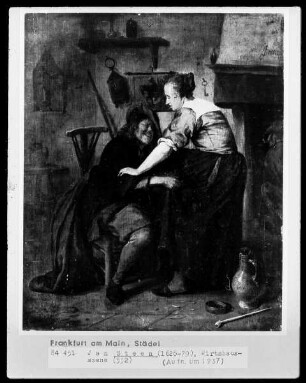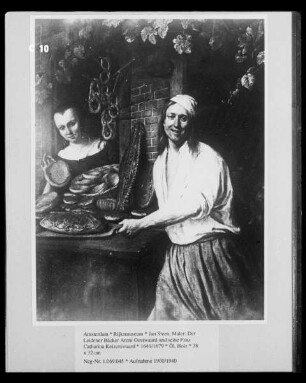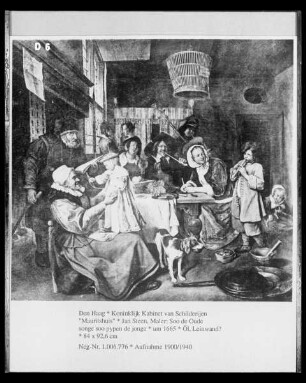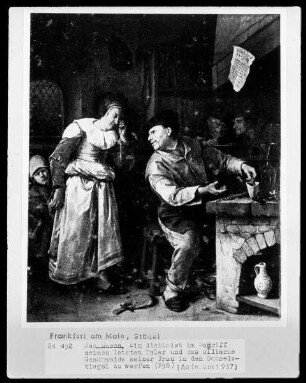Malerei
Antonius und Kleopatra
Kleopatra sitzt mit dem römischen Feldherrn Antonius an einem reich gedeckten Tisch. Während die ägyptische Königin mit der rechten Hand ein Weinglas umkehrt, greift sie mit der anderen nach einer Perle an der linken Seite ihres Haares. Ein Fuß ruht auf einer Glaskugel. Antonius weicht erstaunt zurück und hebt die linke Hand. Hinter ihm steht ein alter Soldat, der, den Kopf in die Hand gestützt, die Szene beobachtet. Neben Kleopatra erscheinen zwei Diener und tragen weitere Kannen herbei. - Die originale Leinwand endet unmittelbar über den Figuren und dem Durchblick in die Ferne in einem unregelmäßig abgeschnittenen flachen Rundbogen. Der Vorhang darüber ist zum größten Teil auf das Holz gemalt, auf das die Leinwand geklebt wurde. Der niedrige und gerundete Abschluß stellt allerdings nicht den ursprünglichen Zustand des Gemäldes dar. Vermutlich wurde die obere Partie beschädigt oder für eine rundbogige Rahmung zurechtgestutzt und später mit Hilfe der Holztafel auf das gegenwärtige Format ergänzt. Dieser Zustand ist bereits im handschriftlichen Inventar und im ersten gedruckten Verzeichnis der Slg. Zschorn erwähnt. Beschädigung und Ergänzung müssen also vor 1789 erfolgt sein. - Hofstede de Groot nennt als mögliche Provenienz eine Reihe von Auktionen des 18. und 19. Jahrhunderts. Diejenigen nach 1789 hat bereits Stechow im Göttinger Katalog ausgeschlossen, da spätestens zu dieser Zeit das Bild in der Slg. Zschorn war. Die übrigen lauten: Auktion Amsterdam, 16. Mai 1696, Nr. 83 (Hoet/Terwesten, Bd. 1, S. 38, Nr. 83: Antonius en Cleopatra van Jan Steen); Auktion Amsterdam, 17. September 1727, Nr. 21 (Hoet/ Terwesten, Bd. 1, S. 320, Nr. 21: De Maeltyd van Cleopatra, door Jan Steen). Die knappen Beschreibungen erlauben keine sichere Identifizierung des Gemäldes, da Steen mehrere Versionen des Themas gemalt hat. Andererseits kann die Herkunft aus einer der beiden Auktionen nicht ausgeschlossen werden. Das Bild der Auktion Antony Sydervelt, Amsterdam, 23./24. April 1766, Nr. 35, kommt nicht in Betracht, da die vorhandene Beschreibung mit dem vorliegenden Exemplar nicht übereinstimmt (Hoet/Terwesten, Bd. 3, S. 517, Nr. 35). - Die Anekdote vom Perlenopfer der Kleopatra wird von Plimus d.Ä. erzählt {Naturalls Historia, 9. Buch, Kapitel LVII, § 119-121): Kleopatra verhöhnt ihren Liebhaber Antonius wegen seines einfallslosen Prunkes und seiner gleichförmigen Gastmähler mit dem Versprechen, sie werde ihm ein Mahl im Wert von 10 Millionen Sesterzen richten. Nachdem sie dem Antonius am anderen Tag ein gewöhnlich reiches Mahl vorgesetzt hatte, fragte dieser die Königin nach dem besonderen Wert dieser Mahlzeit, die sich nicht von den vorhergehenden unterschieden habe. Darauf entgegnete ihm Kleopatra, der Nachtisch allein werde den von ihr angegebenen Wert erreichen. Sie läßt ein Gefäß mit Essig herbeitragen, nimmt eine ihrer einzigartigen Perlen vom Ohr, wirft sie in den Topf. Nachdem die Perle sich aufgelöst hat, trinkt sie das Gefäß leer und greift nach ihrer zweiten Perle. In diesem Augenblick fällt ihr Lucius Plancus, ein Begleiter des Antonius, in den Arm und erklärt, sie habe ihr Wort gehalten. Auf diese Weise rettet er die zweite Perle der Kleopatra. Als literarische Vorlage für diese Komposition kommt neben einer der zahlreichen Ausgaben des Originaltextes auch eine niederländische Übersetzung in Frage (C. Plini Secundi, Des wijdt-vermaerden Natuur-kondigers vijf Boecken, Amsterdam 1662, S. 556-557). Besonders eng ist jedoch die Übereinstimmung mit Jacob Cats Nacherzählung der Anekdote in seinem Gedichtzyklus Proef-Steen van den Trou-Ringh, (Amsterdam 1637, S. 433). Denn im Unterschied zur Überlieferung des Plinius nimmt Kleopatra dort wie im Gemälde die Perle aus ihrem Haarschmuck und wirft sie in ein Glas statt in einen herbeigeschleppten Topf mit Essig (vgl. Ausst. Braunschweig 1983, Nr. 42, mit weiteren Bemerkungen zur Ikonographie und zum Erzählstil des Bildes). Das Gemälde ist die früheste Version von drei weiteren, undatierten Fassungen des Themas (Kirschenbaum, Nr. 85, 86a/b, 86c, Abb. 60, 87, 102). Die Bilder im Besitz des Dienst Verspreide Rijkscollecties und in der Slg. S. Nystad, Den Haag, unterscheiden sich durch Verwendung eines umfänglicheren Querformates und durch eine stark veränderte, um zahlreiche Figuren vermehrte Komposition vom Göttinger Gemälde. In der zweiten Haarlemer Periode des Malers (1665/70) sind eine Reihe seiner Historien entstanden. So auch das bezeichnete, aber undatierte Bild mit der Hochzeit des Tobias im Herzog Anton Ulrich-Museum zu Braunschweig (Kat. 1983, S. 194, Nr. 313; Kirschenbaum Nr. 25a), das von mehreren Autoren in die unmittelbare Nähe des Göttinger Gemäldes gerückt wird. -
- Location
-
Georg-August-Universität Göttingen / Kunstgesch. Seminar und Kunstsammlung der Universität, Göttingen
- Inventory number
-
GG 080
- Measurements
-
Höhe: 67,9 cm (ohne Rahmen)
Breite: 56 cm
- Material/Technique
-
Leinwand (auf Holz aufgezogen); Ölmalerei
- Inscription/Labeling
-
Gravur: JSteen: 1667 (J und S ligiert). (unten links von der Mitte. J und S ligiert.)
- Related object and literature
-
Literatur in Zusammenhang: B. D. Kirschenbaum, „The religious and historical paintings of Jan Steen“. Allanheld u.a., New York, N.Y., 1977. (S. 45, 49f., 70, 145, Nr. 86. )
Beschrieben in: C. Hofstede de Groot, „Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke des hervorragendsten holländischen Maler des XVII. Jahrhunderts ; Vol. 9 - 10“. Chadwyck-Healey, Teaneck [u.a.], 19761983. (Bd. 1, S. 23, Nr. 86.)
Beschrieben in: „European paintings of the 16th, 17th, and 18th centuries : catalogue of paintings. The Cleveland Museum of Art catalogue of paintings ; 3“. The Cleveland Museum of Art, Cleveland, Ohio, 1982. (Nr. 121)
Literatur in Zusammenhang: M. Westermann, „The amusements of Jan Steen : comic painting in the seventeenth century. Studies in Netherlandish Art and Cultural History ; 1“. Waanders, Zwolle, 1997.
Veröffentlicht in: „Die niederländischen Gemälde : mit einem Verz. der Bilder anderer Schulen“. Kunstsammlung der Univ., Göttingen, 1987. (Nr. 82.)
Beschrieben in: J. D. Fiorillo, „Beschreibung der Gemählde-Sammlung der Universität zu Göttingen“. Dieterich, Göttingen, 1805. ( S. 23 f., Nr. 2.)
Literatur in Zusammenhang: J. D. Fiorillo, „Geschichte der zeichnenden Künste in Deutschland und den vereinten Niederlanden : 3. Bd. Sämtliche Schriften ; 8“. Olms, Hildesheim [u.a.], 1997.
Veröffentlicht in: E. Waldmann, „Provisorischer Führer durch die Gemälde-Sammlung der Universität Göttingen“. F. Haensch, Göttingen, 1905. (Nr. 81)
Veröffentlicht in: W. Stechow, „Katalog der Gemäldesammlung der Universität Göttingen“. Lange, Göttingen, 1926. (Nr. 169)
Beschrieben in: C. W. de Groot, „Jan Steen : beeld en woord“. Dekker & Van de Vegt, Utrecht [etc.], 1952. (S. 30-33)
Literatur in Zusammenhang: „Niederländische Gemälde und Zeichnungen des 17. Jahrhunderts : Aus der Kunstsammlung der Universität Göttingen, 12. Febr.- 25. März 1984. Niederländische Gemälde und Zeichnungen des siebzehnten Jahrhunderts. Museum für Kunst und Kulturgeschichte (Dortmund). Information. 2/84“. Museum f. Kunst u. Kulturgeschichte, Dortmund, 1984. (S. 13)
Literatur in Zusammenhang: Wilhelm Martin, Jan Steen. Amsterdam 1954. S. 71, Abb. 83.
Literatur in Zusammenhang: Jan Steen. Katalog der Ausstellung De Lakenhal, Leiden 1926, Nr. 7.
Literatur in Zusammenhang: Wolfgang Stechow, Jan Steen's Merry Company, in: Allen Memorial Art Museum Bulletin, Oberlin College, 15/1958, S. 95f., Abb. 2.
Literatur in Zusammenhang: Kunstsammlung der Universität Göttingen, Katalog der Gemälde (Manuskript, begonnen 1887 durch Konrad Lange), Nr. 48.
Literatur in Zusammenhang: Tobias van Westrheene, Jan Steen. Etude sur l'art en Hollande. Den Haag 1856, Nr. 109.
Literatur in Zusammenhang: Wurzbach, Niederländisches Künstlerlexikon, Bd. 2, S. 657.
Literatur in Zusammenhang: Johann Dominicus Fiorillo,Geschichte der zeichnenden Künste in Deutschland und den vereinigten Niederlanden, Bd. 3. Hannover 1818, S. 201.
Literatur in Zusammenhang: Gerard Hoet, Catalogus of Naamlijst van Schilderijen, met derzelven Prijzen. 's-Gravenhage 1752.
Literatur in Zusammenhang: Riegel, Beiträge zur niederländischen Kunstgeschichte, Bd. 2. Berlin 1882, S. 329.
Literatur in Zusammenhang: Albert Heppner, The Populär Theatre of the Redenjkers in the Work of Jan Steen and His Contemporaries, in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 3/1939-40, S. 36 f.
Literatur in Zusammenhang: Verzeichnis einer Gemählde Sammlung von berühmten mehrenteils Niederländischen Meistern, welche dem Königlichen und Chur Braunschweigischen Rath Johann Wilhelm Zschorn in Celle zugehöret (Manuskript, begonnen 1789), Nr. 9 (Johan Steen).
Literatur in Zusammenhang: Niederländische Malerei aus der Kunstsammlung der Universität Göttingen. Bearbeitet von Gerd Unverfehrt. Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum 1983, Nr. 42.
Literatur in Zusammenhang: Karel Braun, Alle tot en toe bekende schilderten van Jan Steen. Rotterdam 1980, Nr. 283.
Literatur in Zusammenhang: Lyckle de Vries, Jan Steen de kluchtenschilder . Diss. Groningen 1977, S. 63, 165, Nr. 167.
Literatur in Zusammenhang: Andor Pigler, Barockthemen, Bd. 2. Budapest 1974, S. 397.
Literatur in Zusammenhang: Gustav Parthey, Deutscher Bildersaal, Bd. 2, S. 577, Nr. 3. H.
Literatur in Zusammenhang: Gemählde Sammlung des Herrn Ober Appellations Secretair Zschorn in Zelle, in: Annalen der Braunschweig Lüneburgischen Churlande, 3. Jahrgang, 2. Stück. Hannover 1789, S. 324 ff., Nr. 5 (Johann Steen).
- Classification
-
Malerei (Hessische Systematik)
painting (Oberbegriffsdatei)
- Subject (what)
-
die Geschichte von Cleopatra
Ereignisse und Situationen der klassisch-antiken Geschichte (mit DATUM)
männliche Personen der klassisch-antiken Geschichte
- Last update
-
24.04.2025, 12:58 PM CEST
Data provider
Kunstsammlung der Universität Göttingen. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Malerei
Associated
Time of origin
- 1667