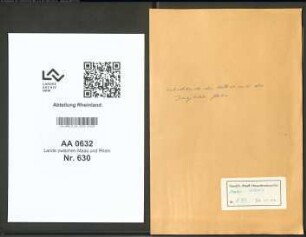Archivale
Streit um Besitz und Nachfolge auf Haus Loersfeld; Auseinandersetzung mit den Gläubigern und mit dem Halbwinner wegen Forderungen
Enthält: Auch nach dem Ableben des Fideikommissbesitzers von Haus Loersfeld, Arnold Theodor (Diedrich) Michael von Leers, kommt es zum Streit um die Nachfolge. Am 18.3.1737 lassen sich die Erben Johann, Wilhelm [?], Conrad und Maria von Leers, Geschwister und Vettern des Verstorbenen, durch eine hochgräfliche Verordnung zu den rechtmäßigen Erbfolgern erklären und die anfallenden Einkünfte und Pachten sichern (Nr. 1). Doch unmittelbar darauf erhebt der Älteste, Ludwig Wilhelm von Leers aus der Leerbacher Linie, den alleinigen Anspruch auf den Fideikommiss und erhält ihn zugesprochen (Nr. 2). Am 30.3. wird er unter den entsprechenden Formalitäten in Anwesenheit des Amtmanns Monschau und einer Abordnung des Gerichts aus den Schöffen Gerard Jaixen und Wilhelm Krafft sowie seinem Anwalt Lic. Gerlach und dem Notar Johann Franz Döring, trotz eines Protests der vorgenannten Erben, offiziell in den Besitz eingeführt (’Immision’). Da das Haus und Gut unter dem Vorbesitzer anscheinend recht heruntergekommen und verschuldet war, beantragt Ludwig Wilhelm im März 1738 um eventueller Schadensersatzansprüche willen, den Besitz gerichtlich und unter Zuziehung von Sachverständigen, einem Zimmermann und einem Maurermeister, begutachten und die Reparaturkosten schätzen zu lassen. Die Kommission aus den Schöffen Adam Werres und Wilhelm Krafft, dem Gerichtsschreibereiverwalter Wolters und den beiden Handwerkern M. Johann Graitz d. J. und Johann Georg Barth ermittelt am 17.3.1738, nachdem sie das Haus von oben bis unten, einschließlich der Halbwinnerwohnung, Stallungen, Scheune, Brau- und Backhaus besichtigt hat, eine Summe von etwa 800-900 Rtlr als Wert des Anwesens. An Gebühren berechnet sie im Übrigen dafür 21 Gulden 4 Albus (Nr. 7). Doch Ludwig Wilhelm stirbt schon um 1738/39, und die Erben streiten sich erneut um die Nachfolge im Familienfideikommiss. Nun sind es die Söhne des jüngeren Bruders von Arnold Theodor Michael von Leers, Johann Philipp zu Tetz: Heinrich und Conrad. Ursache ist die Bestimmung des Fideikommiss-Stifters Dietrich von Leers in seinem Testament vom 2.9.1690, dass zwar die Linien Tetz und Lierbach in der Fideikommissnachfolge alternieren sollten, der Fideikommissinhaber aber unverheiratet sein soll. Da Heinrich, der ältere der beiden Brüder, verheiratet war, wenn auch inzwischen verwitwet, erhält Conrad den Zuschlag und ergreift am 5.10.1739 Besitz von Haus Loersfeld. Heinrich von Leers besteht jedoch auf seinem älteren Recht und darauf, dass er - wieder - ledig war. Sein Ehestand und Vorleben sind jedoch nicht unumstritten: hatte er doch mit einer verheirateten Frau namens Maria Sophia Reifferscheid gen. Zündorff zusammengelebt und ein Kind gezeugt. Die schwangere Frau hatte er dann zunächst bei einem Mann namens Johann Herbach untergebracht. Die Niederkunft war bei Johann Golden in Groß-Habbelrath erfolgt. Er hatte auch die Vaterschaft übernommen, indem er die Pflegekosten bezahlte und das Kind auf seinen Namen taufen ließ. Danach aber ging er ein neues Verhältnis mit einer Frau aus niederem Stand ein, die er noch auf dem Totenbett, das sie zugleich mit dem gemeinsamen Kind ereilte, heiratete. Er bezeichnete sich daher als Witwer (Nr. 31 und 34), was Conrad nicht anerkennt. Eine nicht unwesentlche Rolle in der Auseinandersetzung spielt eine weitere Klausel in der Fideikommissstiftung: wenn es zum Streit komme, sollten drei Schiedsrichter herangezogen werden, und zwar der Propst des Kerpener Stifts, der Landdechant des Dekanats Jülich und der Prior der Kartause Vogelsang. Sie sprachen sich zwar gleich zu Beginn des Streits für Heinrich als rechtmäßigen Nachfolger aus. Doch konnten Propst und Prior sich nicht auf einen Versammlungsort einigen. Conrad von Leers lehnt den Propst ohnehin als befangen ab, weil dessen ehemaliger Küster jetzt von seinem Kontrahenten Heinrich als Halbwinner angestellt wurde. Er wendet sich daher an das Kerpener Gericht, wobei er auch Unterstützung durch den Freiherrn von Brachel, den Ehemann seiner Tante Maria Catharina Constantia von Leers erhält (Nr. 15, 23). Ob sein zwischenzeitlich eingereichter Vergleichsvorschlag, dem Bruder die Hälfte seines Anteils am Haus Tetz zu übertragen, ernst gemeint ist, sei dahingestellt (Nr. 16, 8.11.1740). Heinrich von Leers bleibt schließlich nichts, als die Zuständigkeit des Kerpener Landgerichts als ’incompetentes Forum’ zu bestreiten. Am 18.5.1741 lässt das Gericht die Akten zur Übergabe an einen unparteiischen Rechtsgelehrten zusammenstellen (Nr. 28, 29 - die Akten Nr. 1-9 sind vollständig vorhanden). Dessen Votum (Nr. 31) vom 11.7.1741, für das er übrigens 4 Rtlr Honorar (’pro Sportulis’) berechnet, ist schließlich maßgeblich, dass Conrad von Leers obsiegt und Heinrich, dem die ’Petition’ freigestellt wird, in die Kosten verurteilt wird. Sowohl bei der Besitzergreifung von Haus Loersfeld durch Ludwig Wilhelm von Leers 1737 als auch durch Heinrich bzw. Conrad 1740 hatten sich die Prätendenten den Bestand des Guts durch einen Arrest auf die Pachten, Einkünfte und Renten gegenüber ihren Gläubigern sichern lassen. Bereits seit Januar 1739 streiten sich die Besitzer mit dem Halbwinner Anton Maevis um angebliche Pachtschulden, denen er Aufwendungen für das Haus Loersfeld entgegensetzt (Nr. 40-42). Da in dem langen Streit die Aussicht auf eine Schuldenrückzahlung mehr und mehr schwindet, gehen ab Oktober 1740 auch die Gläubiger, der Kölner Kaufmann Friedrich Brüninghausen, der Scholaster von St. Martinus in Kerpen, Thelen, und die Nachkommen der Leerbacher Linie gegen die Tetzische Linie vor Gericht, um ihre Forderungen geltend zu machen. Im Juni 1742 streiten Heinrich von Leers und Conrad von Leers schließlich noch um die Bewirtschaftung der zum Haus Loersfeld gehörenden Holzung im Brüggener [= Brucker] Busch, die ebenfalls seit Jahren vernachlässigt bzw. nicht genügend beaufsichtigt wurde (s. auch Nr.19/20). Conrad wirft Heinrich und dem von ihm eingesetzten Förster Bernard Becker vor, dass sie z. B. dem Zöllner Adolph Reinermann d. J. aus Mödrath 63 Eichenstämme verkauft hätten, dieser aber eigenen Angaben zufolge nur für 50 à 20 Albus bezahlt habe. Auch an Johann Peter, Bernard Becher und Paul Bohlen, Brüder und Schwäger, habe er Holz zu billig verkauft, anderes für sich nach Köln bringen lassen. Wieder anderes Obergehölz, das ’verhawen oder abgestumpfelt’ war, habe er seinem Förster geschenkt. Dem genannten Reinermann und seinem Vetter Johann Carl Preyll habe er die ganze Winter- und die Sommerfrucht für (nur) 300 Rtlr überlassen. Conrad von Leers' Förster Johann Cremer bietet dagegen 150 Stöcke abgehauener ’Stohlen’, die er im Streit einsetzen wolle. Für die Untersuchung des Falles durch eine Schöffenkommission fallen 17 Rtlr 17 Albus und 4 Heller an Gerichtskosten an. Vorhanden sind vor allem Eingaben der Parteien und Requisitionsschreiben; es fungieren als Anwälte Dr. Gerlach und die Notare Johann Peter Heberer, Everhard Kurten, Caspar Backhausen, Jacob Franz Sassell, Philipp Schmitz, Johann Franz Döring und Hilarius _f46'))) ORDER BY Fn_Bez;
- Reference number
-
Ge, 823
- Notes
-
20.3.1737-30.6.1742
- Context
-
Gericht >> 1.2 Erb- und Besitzstreitigkeiten
- Holding
-
Gericht
- Date of creation
-
1737 - 1742
- Other object pages
- Delivered via
- Last update
-
30.04.2025, 2:53 PM CEST
Data provider
Stadtarchiv Kerpen. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Archivale
Time of origin
- 1737 - 1742