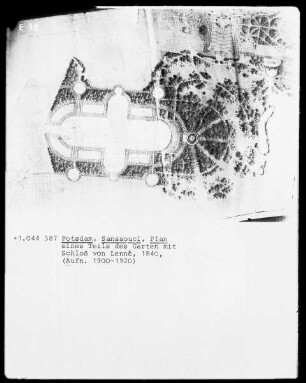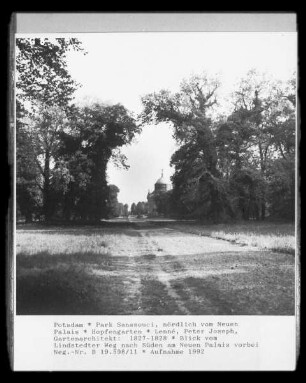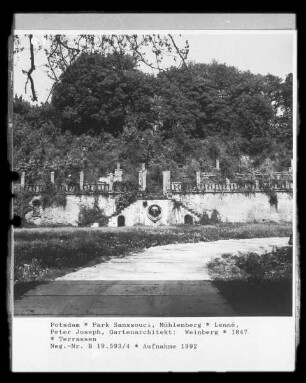Parkanlage
Glienicker Parkanlagen (Schloßpark Klein-Glienicke, Jagdschloßpark, Böttcherberg); Berlin, Steglitz-Zehlendorf
Einen Rundgang durch die Glienicker Parkanlagen beginnt man am besten im Gartenhof des Schlosses, der sich nicht nur zum großen Landschaftspark hin öffnet, sondern auch über eine Pergola einen Blick in den Pleasureground erlaubt. Als intimer Garten ist dieser Blumenhof seit 1987 wieder reich mit Blumenbeeten geziert, aber auch mit Brunnen wie der Ildefonso-Gruppe. Betritt man den Pleasureground durch die genannte Pergola, sieht man zuerst an der Westwand des Schloss die marmorne Skulptur einer Venus Italica von Canova und das ihr zu Füssen liegende buchsbaumgesäumte lilienförmige Teppichbeet, um schließlich vor die nach Süden orientierte Hauptfront des Schlosses zu kommen. Dieser Bereich wird dominiert von der Löwenfontäne mit ihrem reichen Wasserbild sowie dem direkt daneben liegenden Stibadium, zu dem ein eiserner Laubengang hinaufführt, der durch zwei erhaltene Sphinge aus der Zeit des Grafen Lindenau geschmückt wird. Von der halbrunden Sitzbank aus hat man einen weiten Blick über die von Cantian geschlagene Granitschale und den Tiefen See nach Potsdam. Weiter gelangt man - immer wieder tiefe Fernblicke genießend - zur dicht an der Königstraße stehenden Kleinen Neugierde, von der aus man im 19. Jahrhundert vor Blicken geschützt die "Verkehrscirculation" auf der Straße beobachten konnte. Unmittelbar daneben befindet sich seit 1827 eine Brunnenplastik, die so genannte Laitière, eine Bronzefigur des russischen Bildhauers Pavel Petrovitsch Sokolow, nach einer Fabel Lafontaines das Mädchen mit dem zerbrochenen Krug versinnbildlichend. Im weiteren Verlauf erreicht man die Höhe des kleinen Lenné-Hügels mit der vielleicht schönsten Aussicht vom Pleasureground in die Tiefe des Jungfernsees. Außerdem sieht man die Gruppe originaler Säulentrommeln vom Poseidontempel in Kap Sunion, aber auch den im Rasen liegenden Schalenbrunnen von August Stüler sowie einen kleinen Brunnen mit einer Glockenfontäne. Sich langsam der Glienicker Brücke nähernd, stößt man schließlich auf die Große Neugierde, ein Belvedere, von dem aus man heute wieder schöne Aussichten auf Potsdam, Babelsberg und die Villa Schöningen genießen kann. Weiter am Ufer erreicht man das Kasino, von wo aus man das in der Ferne liegende Pfingstbergschloss, aber auch die Türme der Villa Henckel sehen kann. Auf der Gartenseite des Kasinos erinnert noch immer eine Kopie des berühmten Betenden Knaben daran, dass sich hier früher ein Antikengärtchen zur Aufnahme antiker Skulpturen befand. Durch den einen ungehinderten Blick ermöglichenden "invisible fence" an der nördlichen Grenze der Pleasuregrounds hat man, ehe man zum Klosterhof kommt, einen offenen Blick in den Landschaftspark und erkennt dort die zahlreichen, von Lenné besonders geschätzten Rotbuchen. Vorbei am Klosterhof sieht man schon sehr bald die Gewächshäuser und die Orangerie. Durch das noch an die Lindenausche Zeit erinnernde Linden-Oktogon, ein von alten Linden gesäumter Rundplatz, der schon im "Bestandsplan von 1805" (3) dargestellt worden ist, beendet man den Rundgang schließlich wieder am Ausgangspunkt, dem Gartenhof des Glienicker Schlosses.° (...)° Die Verwüstungen des Zweiten Weltkrieges und noch nicht denkmalpflegerisch begründete Nachkriegsinstandsetzungen machten eine grundlegende Restaurierung der nach dem Tode des Prinzen Friedrich Leopold von Preußen in städtischen Besitz gekommenen Park- und Gartenanlagen Glienickes erforderlich. Die seit 1978 in Verantwortung der Berliner Gartendenkmalpflege durchgeführten konservatorischen Maßnahmen (6), haben inzwischen zu einer Wiedergewinnung des Glienicker Pleasuregrounds geführt.° Der nach Entwürfen Lennés für den Prinzen Carl angefertigte Schauplan der Garten- und Parkanlage zu Glienicke um 1825 macht deutlich, wie geschickt es Lenné verstand, nach Vollendung des Pleasuregrounds und nach vollständiger Aufgabe des Hardenbergschen Gutsbetriebes und der Glienicker Ziegelei, aber auch in Fortführung der schon unter dem Staatskanzler begonnenen landschaftsverschönernden Arbeiten, nun auch den großen Landschaftspark durch Nutzung des hügeligen Areals und der Wassernähe zu gestalten. Die lebhafte Topografie des Geländes nutzte Lenné zur Erzeugung laufend wechselnder Raum- und Landschaftsbilder. Die weiträumige, nach und nach mit Baumkulissen durchsetzte Parklandschaft wird durch geschickt geführte Fahrwege erschlossen; die öden Kiefernbestände und landwirtschaftlich genutzten Flächen wurden durch eine Fülle schönster Laubhölzer und unterschiedlichster Wiesenräume ersetzt. Ein wichtiges Erfordernis erfüllte er darüber hinaus in der Schaffung weiter Ausblicke in die Havellandschaft.° Um die umfangreichen Anpflanzungen und Parkwiesen bewässern zu können, regte Lenné schon 1826 den Bau entsprechender Wasserleitungen an, die seit den 1830er Jahren installiert wurden; einige der inzwischen über 140 Jahre alten Eisengussrohre wurden bei gartenarchäologischen Grabungen in den 1980er Jahren entdeckt. Das Havelwasser wurde in hochgelegene künstliche Seen getrieben, wie bei der Teufelsbrücke und der Römischen Bank, von wo aus es als künstlicher Wasserfall, hier Teufelsschlucht, den Berg hinunterfloss oder aber im Sommer zur Überrieselung der Hangwiesen diente. Vom Hofgärtner.- und Maschinenhaus wurden außerdem alle Brunnen und Fontänen in Park und Pleasureground gespeist.° Bauten und Landschaftsbilder im Glienicker Park geben Zeugnis von den höchst ambivalenten Kunstströmungen ihrer Zeit. Nördlich eines von Ost nach West verlaufenden Höhenrückens, die Alpen versinnbildlichend, erwecken ausgedehnte Laubholzbestände mit kleinen Lichtungen den Eindruck eines nordeuropäischen Waldes. In Anlehnung an diese Vegetationsbilder wurde offensichtlich auch der Baustil der Parkgebäude entwickelt. Der Jägerhof und das Jägertor, im "nördlich der Alpen" gelegenen Areal zu denken, sind daher im englisch-gotischen Tudorstil errichtet worden. Der südliche, zum Schloss hin abfallende, großzügig dimensionierte Bereich mit weichen Geländemodellierungen, auf Südeuropa hindeutend, zeigt hingegen neben der an Italien erinnernden Bauweise der Parkbauten - Schloss, Kasino, Gärtner- und Maschinenhaus, Wirtschaftshof, Matrosenhaus - auch eine offenere Behandlung der Parkpartien. (7)° Das topografisch reizvolle, zum Jungfernsee hin gelegene aussichtsreiche Hangufer kann man mittels eines scharf an der Hangkante geführten Panoramaweges erschließen. Schon kurz hinter dem Hofgärtner- und Maschinenhaus genießt man einen Fächerblick von einem ersten Lindenrondell aus, um bald zur romantischen Erlenbrücke, über einer kleinen Schlucht gelegen, zu kommen. Der Weg führt weiter über einen künstlich angelegten Schluchtgraben zum Zeltenplatz, von wo aus man im 19. Jahrhundert ausgezeichnete Blickbeziehungen zum Marmorpalais am Heiligen See oder nach Sacrow hatte. Im weiteren Verlauf gelangt man zum eigentlichen Höhepunkt der Uferinszenierungen, dem großen Wasserfall an der von Ludwig Persius errichteten Teufelsbrücke. Von dort aus kann man nicht nur das tief unter der Brücke rauschende Wasser beobachten, sondern hat zugleich eine weite Aussicht auf den Jungfernsee. Ein weiterer Blick, der einstmals bis zu den Schlössern von Sacrow und der Pfaueninsel reichte, ergibt sich schließlich oberhalb des Jägerhofes, wo einst ein großer Jagdschirm stand. Glienicke wurde damit Teil einer von Lenné strategisch gedachten, landschaftlich wirksamen Gesamtinszenierung, in die nicht nur die Kulisse der Stadt Potsdam, sondern auch zahlreiche in der Nähe der Havelgewässer liegende Schlösser, Brücken, Wasserwerke, aber auch andere Parkarchitekturen wie künstliche Wasserfälle, Pump- oder Maschinenhäuser, später auch Turmvillen miteinbezogen wurden.° Nach dem Ersten Weltkrieg kaum noch gepflegt und zunehmend verwahrlost, konnten schließlich seit den 1980er Jahren auch im großen Landschaftspark von Glienicke erste gezielte gartendenkmalpflegerische Maßnahmen durchgeführt werden. So konnte der sichtbare Verfall zumindest punktuell aufgehalten und die große Erlebnisqualität und Bedeutung des Glienicker Parks wieder deutlich gemacht werden. In den Jahren 2001-03 wurde der in der Nähe des Zeltenplatzes liegende Felsenteich, einschließlich des ihn erschließenden Parkweges grundlegend saniert. Im Zusammenhang mit diesen Arbeiten wurden die Restaurierung des Wasserfalls an der Teufelsbrücke (8) sowie die Herausarbeitung des benachbarten Zeltenplatzes, einschließlich umfangreicher Gehölznachpflanzungen, durchgeführt. (9) Bis 2011 wurde darüber hinaus der Prinzenfriedhof oberhalb des Matrosenhauses restauriert. Dieser kleine Privatfriedhof war 1924 nach Plänen von Ludwig Lesser vom Enkel des Prinzen Carl, Prinz Friedrich Leopold von Preußen, für sich und seine Familie an dem erhöhten und vormals aussichtsreichen Standort des Schlossparks angelegt. 2007 fand Prinz Friedrich Karl III. hier die letzte Ruhe. (10)° _____________° 3) Hellwig, J. G.: Plan des Gutes Klein-Glienicke, 1805, Plankammer der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg.° 6) Krosigk, Klaus von: Die gartendenkmalpflegerische Wiederherstellung Glienickes. In: Lenné Ausstellungskatalog 1989, S. 156 ff.° 7) Weber, Klaus-Konrad: Die "belebende Idee" des Glienicker Parkes. In: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte XV, Berlin 1964, S. 50-59.° 8) Krosigk, Klaus von: Anmerkungen zur Bedeutung und Restaurierung des Persius-Wasserfalls und seines Umfeldes im Landschaftsgarten von Klein-Glienicke. In: Hortus ex machina, Der Bergpark Wilhelmshöhe im Dreiklang von Kunst, Natur und Technik, Internationales Symposium des deutschen Nationalkomitees von ICOMOS, der Museumslandschaft Hessen Kassel und des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen. In: Arbeitshefte des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen Bd. 16, Wiesbaden 2010, S. 116 ff.° 9) Heise, Gabriele/Kaupp, Johanna; Pflege- und Entwicklungswerk Landschaftspark Klein-Glienicke, i.A. des Landesdenkmalamtes Berlin, Gartendenkmalpflege, Berlin 2006.° 10) Krosigk, Klaus von: Beitrag aus Anlass der Restaurierung des prinzlichen Friedhofes im Park von Klein-Glienicke. In: Zuchold, Gerd H.: Der Familienfriedhof im Park von Schloss Glienicke, Die Geschichte der Karl-Linie des Hauses Hohenzollern. In: Zehlendorfer Chronik 18, Berlin 2008, S. 62 ff.°
- Standort
-
Königstraße 35B & 35C & 35D & 35E & 36 & 36A & 36B & 36C / Nikolskoer Weg 3, Wannsee, Steglitz-Zehlendorf, Berlin
- Verwandtes Objekt und Literatur
-
hat Bezug zu: Schloß Klein-Glienicke / Schlossanlage & Parkanlage
hat Bezug zu: Jagdschloß Glienicke / Schloss & Nebengebäude
hat Bezug zu: Loggia Alexandra / Aussichtspavillon & Teepavillon
- Klassifikation
-
Gartendenkmal
- Ereignis
-
Herstellung
- (wer)
-
Entwurf: Lenné, Peter Joseph
Entwurf: Carl von Preußen
- (wann)
-
nach 1683
- Ereignis
-
Umbau
- (wann)
-
nach 1804 & 1816 & 1824-1845 & nach 1845 & 1859-1862 & 1939 & 1979 & 1985
- Letzte Aktualisierung
-
04.06.2025, 11:55 MESZ
Datenpartner
Landesdenkmalamt Berlin. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Parkanlage
Beteiligte
- Entwurf: Lenné, Peter Joseph
- Entwurf: Carl von Preußen
Entstanden
- nach 1683
- nach 1804 & 1816 & 1824-1845 & nach 1845 & 1859-1862 & 1939 & 1979 & 1985