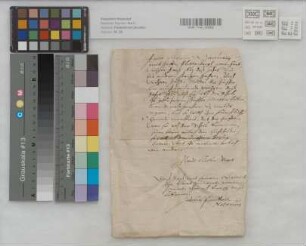Bestand
028 (Bestand)
Erschließungszustand, Umfang: Findbuch (1949, 1964, 1992 ff.)
30 lfm
Verwandte Verzeichnungseinheiten: andere Vereinsarchive
Literaturhinweis: Hermann Stodte, 150 Jahre Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit zu Lübeck begründet 1789, Lübeck 1939; 200 Jahre Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit in Lübeck 1789-1989, Lübeck 1989.
Vorwort: Mit dem Zeitalter der Aufklärung, welches insbesondere geprägt war durch das Bestreben, das Denken mit den Mitteln der Vernunft von althergebrachten, starren und überholten Vorstellungen, Vorurteilen und Ideologien zu befreien und Akzeptanz für neu erlangtes Wissen zu schaffen, gründeten sich im 18. Jahrhundert viele neue Vereine; geselliger Umgang und kritische Diskussionen waren ein unverzichtbares Mittel der Aufklärung. Wie in anderen Städten standen auch in Lübeck am Beginn dieser Vereinsbildung gelehrte Zirkel, Freimaurerlogen und Lesegesellschaften. Insbesondere in den Freimaurerlogen zum Füllhorn und zur Weltkugel war das humanitär-aufklärerische Anliegen maßgeblich. Beide rekrutierten sich überwiegend aus dem Adel des aristokratisch regierten Fürstenbistums und den senatsfähigen Ständen der Gelehrten und Großkaufleute. Doch das Bedürfnis nach einem allgemeineren Wirkungskreis hinsichtlich gemeinnützig-tätigem Handeln einerseits und literarisch-gelehrtem Austausch andererseits bewog nach dem Vorbild der 1765 in Hamburg gegründeten "Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerbe" (bis heute als "Patriotische Gesellschaft" aktiv) auch Lübecker Kreise zur Gründung einer Gesellschaft.
Der Prediger Ludwig Suhl rief im Dezember 1788 gemeinsam mit dem Kaufmann Johann Nonnen, den Notaren und Anwälten Dr. Christian Adolph Overbeck, Matheus Eberhard Kröger, Daniel Hinrich Hasentien, im weiteren Christian Heinrich Siedenburg und Dr. Carl Schnoor sowie dem Prediger Bernhard Eschenburg zur Gründung einer Gesellschaft auf, deren Zweck die wissenschaftliche Unterhaltung und gegenseitige Unterrichtung sein sollte. Die erste Versammlung der vorerst so genannten "Literärischen Gesellschaft" fand am 27. Januar 1789 statt. Die Zusammensetzung des Gründungskreises beschränkte sich auf die vertrauten Stände der sozialen Oberschicht: Domkapitelsadel, Akademiker, Kaufleute (im einzelnen: ein adliger Domkapitular, zehn Juristen, fünf Geistliche, drei Lehrer, zwei Ärzte, vier Kaufleute). Die anfangs 25 Mitglieder kamen wöchentlich zusammen und setzten sich mit dem Zeit- und Stadtgeschehen auseinander; in Vorträgen und Gesprächen behandelten sie Themen unterschiedlichster Wissenschaften, u.a. der Geschichte, Justiz und Verwaltung, Naturwissenschaften und Geographie. Seitdem gilt der Dienstag als Vortragstag.
Das schon anfänglich vorhandene Streben der Gesellschaft, gemeinnützig tätig zu werden, führte zu einer allmählichen Umwandlung der literarischen Gesellschaft in eine gemeinnützige; seit 1793 führte sie den Namen "Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit". Geprägt vom Fortschrittsglauben der Aufklärung war es ihr Wunsch, gesellschaftliche Veränderungen kritisch zu begleiten und voranzutreiben. In den "Verfassungspunkten" von 1795 wurde die erweiterte Zielsetzung und konkrete Aufgabenstellung dargelegt, "den gemeinnützig-thätigen Sinn einmal unter ihren eigenen Mitgliedern, und fürs andere ausserhalb ihres Kreises, (zu) befördern". In diesem Sinne schuf die "Gemeinnützige" in kurzer Zeit viele neue Einrichtungen zum Wohl der Bürger und Einwohner, zur Verbesserung des Bildungsstandes und der Lebensverhältnisse: 1791 die "Rettungsanstalt für im Wasser Verunglückte", 1795 die "Sonntagsschule für Jungen", 1796 die "Industrieschule für Mädchen", beides Einrichtungen vom Typ der Fortbildungs- und Gewerbeschulen für Kinder ärmerer Klassen, 1795 die freie Zeichenschule, 1798 die Schwimmschule. Die 1800 eingerichtete Kreditkasse für Professionisten bot leistungsfähigen Handwerkern und Kleingewerbetreibenden mit zinslosen Darlehen die Möglichkeit zum Aufbau und Ausbau ihrer Betriebe.
Erst 1798/99 vollzog sich endgültig, v.a. auf Anregung von Anton Diedrich Gütschow, der Durchbruch von der Standesgesellschaft zur Bürgergesellschaft; vermehrt traten Kaufleute der Gesellschaft bei, auch Einzelhändler, Chirurgen und Handwerker. Attraktivität und Mitgliederzahl der Gesellschaft stiegen; in dieser patriotisch-gemeinnützigen Organisation fanden Männer unterschiedlicher Stände, Berufe und Konfessionen zusammen, um bis dahin Rat, Bürgerschaft und Kirche vorbehaltene gemeinnützige Aufgaben zu diskutieren und selbst wahrzunehmen.
Eine Zäsur in der Geschichte der Gesellschaft bildeten die Jahre der französischen Besetzung, der wirtschaftliche Rückgang wirkte sich negativ auf die Mitgliederzahl aus. Trotzdem entstanden in dieser Zeit weitere wichtige Einrichtungen der Gesellschaft: 1807 das Lehrerseminar, 1808 die Navigationsschule, 1817 die Sparkasse. 1821 wurde der Ausschuss für das "Sammeln der Quellen und Denkmäler der Geschichte Lübecks" gebildet - er gilt als Keimzelle des "Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterumskunde" sowie als Ausgangspunkt der Sammlungen der Gesellschaft und damit der Lübecker Museen. Nach einem anfänglich misslungenem Versuch der Herausgabe eines eigenen Organs etablierten sich die 1835 begründeten "Neuen Lübeckischen Blätter" als Forum für politische Diskussionen. Heftige politische Debatten der Jahre 1858 und 1859 führten zum Ende der Zeitschrift, welche jedoch bald darauf als die "Lübeckischen Blätter" neu herauskam. Diese Ereignisse waren schon Anzeichen beginnender tiefgreifender politischer Veränderungen in Lübeck: 1864 wurden Verwaltung und Justiz getrennt, die Torsperre aufgehoben, zwei Jahre später die Gewerbefreiheit eingeführt. Die umfassenden Veränderungen bewirkten, dass ehrenamtliche Selbstverwaltung und gemeinnütziges Wirken in vielen Bereichen nicht mehr ausreichten, staatliches Handeln war erforderlich. Viele der vom Verein gegründeten Einrichtungen wurden nun seitens des Lübecker Staates übernommen (u.a. die Navigationsschule schon 1825, 1848 die Auflösung der Sonntagsschule zugunsten der städtischen Fabrikschule, 1865 Verstaatlichung der Rettungsanstalt, 1903 Verstaatlichung des Lehrerseminars). Im Jubiläumsjahr 1898 stießen 132 neue Mitglieder zur Gesellschaft, seit 1892 war im übrigen auch "einzelstehenden Damen" die außerordentliche Mitgliedschaft möglich, offiziell wurde die Gleichberechtigung im August 1919 eingeführt.
Der Verein blieb - trotz einiger Schwerpunktverschiebungen - auch im neuen Jahrhundert ein vom Bürgertum getragener Verein. Da der soziale und Bildungsbereich vermehrt vom Staat getragen wurden, setzte man im Verein eher kulturelle Akzente (Unterbringung der reichhaltigen Sammlungen als Grundstock der verschiedenen Lübecker Museen, Impulse für das öffentliche Bibliothekswesen und den Denkmalschutz). Die 1930er Jahre waren gekennzeichnet von der Herrschaft des Nazi-Regimes und der von ihr verfolgten Gleichschaltungspolitik, wobei der Vorgang der Gleichschaltung in der Lübecker "Gemeinnützigen" leichter und reibungsloser als in vergleichbaren Städten verlief: sie passte sich an. In den "Lübeckischen Blättern" fand schnell nationalsozialistisches Gedankengut Eingang. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges knüpfte man wieder an die Zeit vor 1933 an; die Gesellschaft legte ein Bekenntnis zu Humanität und Toleranz ab. Nach der Stagnation der ersten Nachkriegsjahre wendete sich die "Gemeinnützige" wieder zahlreichen Aufgaben im sozialen und kulturellen Bereich zu. Bewährte Bereiche wurden fortgeführt, neue Bereiche erschlossen (z. B. 1955 Übernahme der Lübecker Mütterschule, 1978 Lübecker Musikschule, Haushilfe für ältere Mitbürger seit 1979). Personelle Gründe, strukturelle Veränderungen, finanzielle Konstellationen u.ä. führten auch in dieser Zeit zu veränderten Aufgabengebieten; dieser stetige Wandel zeigt die fortlaufende Suche der Gesellschaft nach zeitgemäßen Formen für gemeinnützige Tätigkeit auf.
Bis heute prägt die Gesellschaft das Leben der Stadt vielfältig. U.a. verwaltet sie 28 Stiftungen und ihr sind 28 Tochtergesellschaften und -vereine angeschlossen. Die derzeitige Zahl der Mitglieder beträgt rund 2000. Die Gesellschaft ist bis heute kein eingetragener Verein, sondern eine Vereinigung bürgerlichen Rechts, welche ehrenamtlich von einer Vorsteherschaft unter Vorsitz des Direktors geleitet wird, derzeit ist das Frau Antje Peters-Hirt.
Der ältere Aktenbestand, bereits vor dem Zweiten Weltkrieg vom Archiv der Hansestadt Lübeck übernommen, wurde 1949 von Olof Ahlers geordnet und verzeichnet. Die folgenden Ablieferungen (1964 ff.) wurden jeweils angefügt. Die Verwahrung im Archiv der Hansestadt Lübeck geschieht in Form eines Depositums.
2007/08 wurde der gesamte Bestand neu in alterungsbeständige Mappen und Kartons verpackt und umsigniert. Die alte Signatur ist noch zu finden unter "Alte Archivsignatur". Die einzelnen Verzeichnungseinheiten wurden in die EDV-Datenbank des Archivs der Hansestadt Lübeck aufgenommen und neu klassifiziert.
Literatur:
200 Jahre Beständigkeit und Wandel. Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit in Lübeck 1789-1989, Lübeck 1988
Lübeck-Lexikon. Die Hansestadt von A-Z, hrsg. von Antjekathrin Graßmann, Lübeck 2006, S. 119 f. "Gemeinnützige"
Ahasver von Brandt: Das Lübecker Bürgertum zur Zeit der Gründung der "Gemeinnützigen" - Menschen, Ideen und soziale Verhältnisse, in: Der Wagen 1966, S. 18-35
Institute, Einrichtungen und Tochtergesellschaften der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit, sowie sonstige im Bestand erwähnte Vereine und Einrichtungen:
Ausschuss für die 700jahrfeier Lübecks
Ausschuss für die Prüfung der Jahresrechnung der Gesellschaft
Ausschuss für die Prüfung der Jahresrechnung und des Verwaltungsberichtes der Spar- und Anleihekasse
Badeanstalten
Bibelgesellschaft
Buxtehude Werke
Christlicher Verein junger Männer
Denkmalrat
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger
Deutscher Sprachverein
Deutscher Nationalverein der Freundinnen junger Mädchen
Diskontokasse
Evangelischer Krankenpflegeverein
Frauengewerbeschule
Frauenverein von 1813
Freilichtbühne
Freizeitheim für berufstätige junge Mädchen
Gartenbauverein
Geibel-Gesellschaft
Geographische Gesellschaft
Gesangklasse
Gesellschaft Lübecker Theaterfreunde
Gesellschaft zur Förderung des Herderinstituts in Riga
Gesellschaft für soziale Reform
Gewerbeausschuss
Gewerbeschule
Handelsmuseum
Handelsschule
Haushaltungsschule
Heilsarmee
Herberge zur Heimat
Industrieschule
Israelsdorfer Verschönerungsverein
Kaufmännisches Lehrlingsheim
Kindererholungsheim "Bazora"
Kinderhorte
Kinderhospital
Kinderspielplatz
Kirchlicher Hilfsbund von St. Jacobi
Kleinkinderschulen
Landwirtschaftlicher Verein
Literarische Gesellschaft
Lübecker gemeinnütziger Bauverein
Lübecker Jugendausschuss
Lübecker Lehrergesangsverein
Lübecker Mütterschule
Lübecker Ruderclub
Lübecker Rudergesellschaft von 1885
Lübecker Schulbund
Lübecker Verein zum Schutz der Tiere
Lübecker Verkehrsverein e.V.
Lübeckische Gerichtshilfe
Lübeck-Travemünder Rennclub e.V.
Milchkolonie
Museum für Völkerkunde
Museum lübeckischer Kunst- und Kulturgeschichte
Musikausschuss
Naturwissenschaftlicher Verein
Navigationsschule
Nordische Gesellschaft
NS-Kulturgemeinde
Overbeck-Gesellschaft
Patriotische Gesellschaft Hamburg
Photographische Gesellschaft
Plattdütsche Volksgill to Lübeck e.V.
Rettungsanstalten für im Wasser Verunglückte
Schullehreraltenkasse
Schullehrerseminar
Schwimmschule
Seemannskasse
Seidenbauverein
Singakademie
Sonntagsschule
Spar- und Anleihekasse
Speiseanstalt
St.Gertrud-Bücherhalle
Taubstummenanstalt
Trivialschulen
Tuberkuloseheim
Turnanstalt
Vaterländischer Frauenverein
Verein der Musikfreunde
Verein für Ferienkolonien
Verein für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde
Verein für lübeckische Statistik
Verein für volkstümliche Kunst
Verein für volkstümliche Naturkunde
Verein von Kunstfreunden
Verein zur Erforschung der Lokalursachen der Cholera
Verein zur Fürsorge für entlassene Strafgefangene
Verein zur Fürsorge von jugendlichen Krüppeln
Vereinigung Lübecker bildender Künstler
Vereinsbibliothek
Volksbund für deutsche Kriegsgräberfürsorge
Volkshilfe in Volksnot
Volksküche
Waldschule Wesloe
Witwenkasse für Beamte, Offiziere und Ärzte
Zeichenschule
Zentrale für Krankenpflege
Zentrale für private Fürsorge
Lübeck, 23. November 2009
Erwerb 8/2015
ab Signatur 1544
Lübecker Musikschule
Den "Verein Lübecker Musikschule" gab es bis Ende 1977. Bedingt durch zunehmende finanzielle Schwierigkeiten sollte der Verein aufgelöst werden, konnte aber ab 01.03.1978 als Teil der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit weitergeführt werden. Folgendes wurde übernommen: das Personal, der Leiter Professor Günter Behrens, auch der Standort in der Hüxstraße 47. Die Lübecker Musikschule blühte wieder auf. Es wurden die Kinderschauspielschule, das Jugendblas-, das Kammer- und das Salonorchester geschaffen. Ab Mitte der 1980er zog die Musikschule in den Rosengarten Nr. 14-18 um. Der langjährige Direktor der Einrichtung gab frühzeitig seinen geplanten Rücktritt zur Mitte des Jahres 1998 bekannt. Den Posten übernahm Professor Jörg Linowitzki mit Unterstützung der Lehrer Gerhard Torlitz und Olaf Silberbach. Das Team wollte die zu hohen Ausgaben schmälern, traf aber besonders bei der Leiterin des Kammerorchesters auf Widerstand. Das Orchester war sehr bekannt geworden und reiste jährlich ins Ausland, um aufzutreten. Im Frühjahr 2001 konnten Umbau und Erweiterung des Standorts fertig gestellt werden. Gerhard Torlitz wurde als kommissarischer Leiter mit Unterstützung von Olaf Silberbach eingesetzt. Im selben Jahr gab es viele Diskussionen darüber, die Lübecker Musikschule mit der Musik- und Kunstschule zu vereinen.
Professor-Paul-Brockhaus-Stiftung
Die Professor-Paul-Brockhaus-Stiftung wurde am 06.11.1957 als unselbständige Stiftung zur Förderung des Kunsthandwerks in der Hansestadt Lübeck ohne eigenes Kapital gegründet. Die offizielle Rechtsform lautet: "nicht rechtsfähige Stiftung in privater Trägerschaft".
Benannt wurde die Stiftung nach dem langjährigen Mitvorsteher der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit Herrn Professor Paul Brockhaus (geboren am 03.02.1879, gestorben am 02.05.1965). Dieser arbeitete lange Zeit als Lehrer in Lübeck, engagierte sich für Kunst und Kultur und dichtete selbst. Einige Beispiele für sein Engagement sind: Schriftleiter der "Lübeckischen Blätter" (1923-1951), Herausgeber des Jahrbuchs "Der Wagen"(von 1919 bis zu seinem Tod).
Den Vorsitz der Professor-Paul-Brockhaus-Stiftung übernahm zunächst der Namensgeber selbst. Ab 1965 war Heinrich Dose als Vorsitzender tätig. Nach dessen Tod am 12.08.1980 übernahm Susanne Cassebaum zunächst vorläufig den Vorsitz und wurde am 03.02.1981 offiziell vom Ausschuss zur Vorsitzenden gewählt. Bis 1990 blieb sie im Amt, danach übernahm Doktor Ulrich Pietsch für drei Jahre den Posten. Zwischen 1993 und 1995 litt die Stiftung ein wenig. In den "Lübeckischen Blättern" war ein Artikel über Paul Brockhaus und seine Veröffentlichungen während der NS-Zeit publiziert worden. Daraufhin trat der Vorsitzende zurück, Vorstandsmitglieder traten aus und die Stiftung stellte ihre Arbeit ein. Nach einem Brief von Georg Dose, dem Sohn des langjährigen Vorsitzenden Heinrich Dose, wurden wieder Vorstandssitzungen einberufen und Künstler gefördert. In den Vorsitz wurde Doktorin Brigitte Heise zunächst bis 2003 gewählt.
bearbeitet von Lisa Heinemann, April 2015
Eingrenzung und Inhalt: Protokolle, Jahresberichte, Verfassung, Mitglieder, Versammlungen, Vorträge und Vorlesungen, Kassenbücher, Institute und Einrichtungen der Gesellschaft
Verwaltungsgeschichte/biographische Angaben: extra Findbuch!
- Bestandssignatur
-
05.4-Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit
- Kontext
-
Archiv der Hansestadt Lübeck (Archivtektonik) >> 05 Private Archive >> 05.4 Vereins- und Verbandsarchive
- Bestandslaufzeit
-
1789-1993
- Weitere Objektseiten
- Zugangsbeschränkungen
-
Benutzungsbeschränkung: keine
- Letzte Aktualisierung
-
30.06.2025, 10:12 MESZ
Datenpartner
Archiv der Hansestadt Lübeck. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Bestand
Entstanden
- 1789-1993