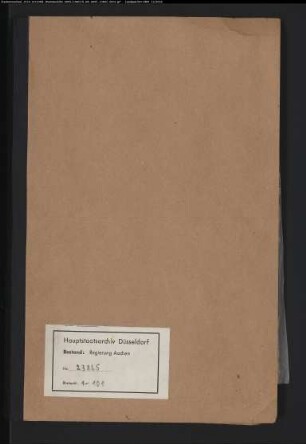Bestand
Generalvikariat Ortsakten Erzbistum Köln, Gebiet Eupen-Malmedy (GvO-E) (Bestand)
Die Gebiete um Eupen sowie um St. Vith gehörten seit alters her zum Bistum Lüttich - mit zwei Ausnahmen: Amel, das erst 1802 von Köln nach Lüttich kam und Manderfeld, das 1802 von Köln an Trier fiel. Weil die Bereiche jedoch nach dem Wiener Kongress 1815 politisch an Preußen gefallen waren, kamen sie 1818 vom Bistum Lüttich zunächst zum noch bestehenden napoleonischen Bistum Aachen. Durch die päpstliche Bulle "De salute animarum" fielen sie zwar 1822 an das wiedererrichtete Erzbistum Köln. 1825 wurden sie aber nach der tatsächlichen Auflösung des Aachener Bistums zum Erzbistum Köln überführt. Ebenfalls kamen Manderfeld und die neu errichtete Pfarrei Schönberg vom Bistum Trier zum Erzbistum Köln. Die geographisch dazwischenliegende wallonische Stadt Malmedy und ihre Umgebung gehörte dagegen schon immer zum Erzbistum Köln und kam erst 1802 durch die unter Napoleon verwirklichte Neuordnung der französischen Bistümer zum Bistum Lüttich und danach auf gleiche Weise wie Eupen und St. Vith zunächst zum Bistum Aachen und anschließend zum Erzbistum Köln. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde im Versailler Vertrag 1919 bestimmt, dass die beiden preußischen Kreise Eupen und Malmedy (zu dem auch St. Vith gehörte) 1920 an Belgien abzugeben sind. Kirchlicherseits wurde zunächst für die beiden Kreise das Bistum Eupen-Malmedy errichtet, das aber schon 1925 im Bistum Lüttich aufging. Der Bestand GvO-E enthält den in den rund 100 Jahren der Zugehörigkeit zum Erzbistum Köln entstandenen Schriftverkehr zwischen den Pfarreien und der erzbischöflichen Behörde in Köln (lediglich in einer Akte befinden sich wenige frühere Rechnungen). Die Akten begannen ursprünglich mit der Überlieferung des napoleonischen Bistums Aachen. Diese Dokumente wurden jedoch herausgelöst und bilden einen der Grundstöcke für den Bestand BAO (siehe unter 12.1: Erstes Bistum Aachen Orte). Aus der Zeit des Kulturkampfes ist fast kein Schriftverkehr außerhalb der Haushaltsunterlagen überliefert, da das Generalvikariat 1876 seine Arbeit einstellen musste und erst 1886 wiederaufnehmen konnte. Die Akten schließen 1920/21, wurden aber in einzelnen Fällen bis 1938 durch Anfragen zu den Akten selbst in der Kölner Erzbischöflichen Behörde ergänzt. Nachdem am 18. Mai 1940 die Kantone durch das Deutsche Reich annektiert worden waren, musste Rom die kirchlichen Verhältnisse neu ordnen. So wurde der Apostolische Administrator von Aachen Dr. Hermann Joseph Sträter am 1. Juli 1940 provisorisch auch zum Apostolischen Administrator für Eupen-Malmedy ernannt. Direkt am nächsten Tag wandte sich Sträter an das Erzbischöfliche Generalvikariat in Köln und erkundigte sich nach den "alten Akten" um "einigen Aufschluß über die Pfarreien, Rektorate, Klöster usw. zu erhalten" (Historisches Archiv des Erzbistums Köln, Gen. I 11). Aus Köln wird ihm versichert, dass die Akten wohlbehalten dort seien und abgeholt werden könnten. Die Überführung nach Aachen - und zwar direkt in das Bischöfliche Diözesanarchiv - geschah jedoch erst ein Jahr später. Für die einzelnen Pfarreien wurden im Kölner Generalvikariat nach Sachthemen geordnete Akten angelegt. Neben den beiden Hauptgruppen Pfarre (Allgemeiner Schriftverkehr) und Kirche (v. a. Haushaltsunterlagen, meist mehrere Bände) gibt es spezielle Sammelakten zu Vikarien, Kirchenangestellten, Kapellen, Stiftungen, Bruderschaften und Gottesdienst sowie vereinzelt auch spezielle thematische Akten. Für Städte, in denen es mehr als eine Kirchengemeinde gab, legte die Kölner Registratur sogenannte "Überhaupt-Akten" an, die sich nicht auf eine einzelne Pfarrei, sondern auf die gesamte Stadt bezogen. Hier ist davon nur die Stadt Eupen (Klöster, Schulwesen) betroffen. Die Bezeichnung der Patrozinien richtet sich nach den Angaben aus dem Handbuch der Erzdiözese Cöln, 21. Ausgabe, hrsg. von dem Erzbischöflichen Generalvikariat, Cöln 1911, da hier fast alle im Bestand vorkommenden Kirchen und Kapellen aufgeführt sind. Die nächste Ausgabe von 1922 nennt nur die Kirchengemeinden und Rektorate, aber nicht die Kapellen und bot sich somit nicht an. Quellen und Literatur: - BDA, GvS, B 20,I. - Doepgen, Heinz: Die Abtretung des Gebietes von Eupen-Malmedy an Belgien im Jahre 1920 (Rheinisches Archiv Bd. 60), Bonn 1966. - Gielen, Viktor: Der Kreis Eupen unter preußischer Herrschaft 1815-1920 (Das Bild der Heimat 6), Eupen 1972. - Grenzerfahrungen. Eine Geschichte der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Bd. 3: Code civil, beschleunigte Moderne und Dynamiken des Beharrens (1794-1919), hrsg. von Carlo Lejeune, Eupen 2017. - Jousten, Wilfried: Errichtung und Auflösung des Bistums Eupen-Malmedy (1921-1925). Eine Studie mit besonderer Berücksichtigung kirchenrechtlicher Aspekte (Quellen und Forschungen zur Geschichte der deutschsprachigen Belgier Bd. 8), Brüssel 2016. - Jousten, Wilfried: Vor 100 Jahren. Die Amtseinführung des Bischofs von Eupen-Malmedy, in: Zwischen Venn und Schneifel. Zeitschrift für Geschichte, Brauchtum und Kultur 57 (2021), S. 198-201. - Kaufmann, Karl Leopold: Der Grenzkreis Malmedy in den ersten fünf Jahrzehnten der preußischen Verwaltung, Bonn 1940. - Kaufmann, Karl Leopold: Der Kreis Malmedy. Geschichte eines Eifelkreises von 1865 bis 1920, Bonn 1961. - Minke, Alfred: 1000 Jahre ostbelgische Kirchengeschichte - Alte Archive erzählen (Staatsarchiv Eupen Ausstellungskataloge Bd. 1), Eupen 1998. - Minke, Alfred: Kleine Pfarrgeschichte Ostbelgiens (Jahrbuch 2009 des Fördervereins des Archivwesens in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens V.o.G), Eupen 2010. - Pabst, Klaus: Zwischenspiel: Das "Bistum Eupen und Malmedy" 1921-1925. Kirche und Nationalismus nach dem Ersten Weltkrieg im Aachener Raum, in: Lebensraum Bistum Aachen. Tradition - Aktualität - Zukunft, hrsg. v. Philipp Boonen (Aachener Beiträge zur Pastoral- und Bildungsfragen Bd. 10), Aachen 1982, S. 26-62. - Zwischen Belgien und Deutschland. Quellen aus dem Stadtarchiv Aachen und dem Staatsarchiv in Eupen zum Staatswechsel Eupen-Malmedy 1919-1925, hrsg. v. Els Herrebout, Thomas Müller, Peter Quadflieg, René Rohrkamp (Aus den Quellen des Stadtarchivs Aachen Bd. 4), Aachen, Eupen 2020, S. 9-27.
- Umfang
-
396 Verzeichnungseinheiten
- Kontext
-
Bischöfliches Diözesanarchiv Aachen (Archivtektonik) >> 02 Bischöfliches Generalvikariat >> 02.04 Orte >> 02.04.01 Orte (Vorgängerbistümer)
- Verwandte Bestände und Literatur
-
Verwaltungsgeschichte/biographische Angaben: Die Gebiete um Eupen sowie um St. Vith gehörten seit alters her zum Bistum Lüttich - mit zwei Ausnahmen: Amel, das erst 1802 von Köln nach Lüttich kam und Manderfeld, das 1802 von Köln an Trier fiel. Weil die Bereiche jedoch nach dem Wiener Kongress 1815 politisch an Preußen gefallen waren, kamen sie 1818 vom Bistum Lüttich zunächst zum noch bestehenden napoleonischen Bistum Aachen. Durch die päpstliche Bulle "De salute animarum" fielen sie zwar 1822 an das wiedererrichtete Erzbistum Köln. 1825 wurden sie aber nach der tatsächlichen Auflösung des Aachener Bistums zum Erzbistum Köln überführt. Ebenfalls kamen Manderfeld und die neu errichtete Pfarrei Schönberg vom Bistum Trier zum Erzbistum Köln.
Die geographisch dazwischenliegende wallonische Stadt Malmedy und ihre Umgebung gehörte dagegen schon immer zum Erzbistum Köln und kam erst 1802 durch die unter Napoleon verwirklichte Neuordnung der französischen Bistümer zum Bistum Lüttich und danach auf gleiche Weise wie Eupen und St. Vith zunächst zum Bistum Aachen und anschließend zum Erzbistum Köln.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde im Versailler Vertrag 1919 bestimmt, dass die beiden preußischen Kreise Eupen und Malmedy (zu dem auch St. Vith gehörte) 1920 an Belgien abzugeben sind. Kirchlicherseits wurde zunächst für die beiden Kreise das Bistum Eupen-Malmedy errichtet, das aber schon 1925 im Bistum Lüttich aufging.
Der Bestand GvO-E enthält den in den rund 100 Jahren der Zugehörigkeit zum Erzbistum Köln entstandenen Schriftverkehr zwischen den Pfarreien und der erzbischöflichen Behörde in Köln (lediglich in einer Akte befinden sich wenige frühere Rechnungen). Die Akten begannen ursprünglich mit der Überlieferung des napoleonischen Bistums Aachen. Diese Dokumente wurden jedoch herausgelöst und bilden einen der Grundstöcke für den Bestand BAO (siehe unter 12.1: Erstes Bistum Aachen Orte). Aus der Zeit des Kulturkampfes ist fast kein Schriftverkehr außerhalb der Haushaltsunterlagen) überliefert, da das Generalvikariat 1876 seine Arbeit einstellen musste und erst 1886 wiederaufnehmen konnte. Die Akten schließen 1920/21, wurden aber in einzelnen Fällen bis 1938 durch Anfragen zu den Akten selbst in der Kölner Erzbischöflichen Behörde ergänzt.
Nachdem am 18. Mai 1940 die Kantone durch das Deutsche Reich annektiert worden waren, musste Rom die kirchlichen Verhältnisse neu ordnen. So wurde der Apostolische Administrator von Aachen Dr. Hermann Joseph Sträter am 1. Juli 1940 provisorisch auch zum Apostolischen Administrator für Eupen-Malmedy ernannt. Direkt am nächsten Tag wandte sich Sträter an das Erzbischöfliche Generalvikariat in Köln und erkundigte sich nach den "alten Akten" um "einigen Aufschluß über die Pfarreien, Rektorate, Klöster usw. zu erhalten" (Historisches Archiv des Erzbistums Köln, Gen. I 11). Aus Köln wird ihm versichert, dass die Akten wohlbehalten dort seien und abgeholt werden könnten. Die Überführung nach Aachen - und zwar direkt in das Bischöfliche Diözesanarchiv - geschah jedoch erst ein Jahr später.
Für die einzelnen Pfarreien wurden nach Sachthemen geordnete Akten angelegt. Neben den beiden Hauptgruppen Pfarre (Allgemeiner Schriftverkehr) und Kirche (v. a. Haushaltsunterlagen, meist mehrere Bände) gibt es spezielle Sammelakten zu Vikarien, Kirchenangestellten, Kapellen, Stiftungen, Bruderschaften und Gottesdienst sowie vereinzelt auch Einzelakten zu verschiedenen speziellen Themen. Für Städte, in denen es mehr als eine Kirchengemeinde gab, legte die Kölner Registratur sogenannte "Überhaupt-Akten" an, die sich nicht auf eine einzelne Pfarrei, sondern auf die gesamte Stadt bezogen. Hier ist davon nur die Stadt Eupen (Klöster, Schulwesen) betroffen.
Die Bezeichnung der Patrozinien richtet sich nach den Angaben aus dem Handbuch der Erzdiözese Cöln, 21. Ausgabe, hrsg. von dem Erzbischöflichen Generalvikariat, Cöln 1911, da hier fast alle im Bestand vorkommenden Kirchen und Kapellen aufgeführt sind. Die nächste Ausgabe von 1922 nennt nur die Kirchengemeinden und Rektorate, aber nicht die Kapellen und bot sich somit nicht an.
Quellen und Literatur:
- BDA, GvS, B 20,I.
- Doepgen, Heinz: Die Abtretung des Gebietes von Eupen-Malmedy an Belgien im Jahre 1920 (Rheinisches Archiv Bd. 60), Bonn 1966.
- Gielen, Viktor: Der Kreis Eupen unter preußischer Herrschaft 1815-1920 (Das Bild der Heimat 6), Eupen 1972.
- Grenzerfahrungen. Eine Geschichte der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Bd. 3: Code civil, beschleunigte Moderne und Dynamiken des Beharrens (1794-1919), hrsg. von Carlo Lejeune, Eupen 2017.
- Jousten, Wilfried: Errichtung und Auflösung des Bistums Eupen-Malmedy (1921-1925). Eine Studie mit besonderer Berücksichtigung kirchenrechtlicher Aspekte (Quellen und Forschungen zur Geschichte der deutschsprachigen Belgier Bd. 8), Brüssel 2016.
- Jousten, Wilfried: Vor 100 Jahren. Die Amtseinführung des Bischofs von Eupen-Malmedy, in: Zwischen Venn und Schneifel. Zeitschrift für Geschichte, Brauchtum und Kultur 57 (2021), S. 198-201.
- Kaufmann, Karl Leopold: Der Grenzkreis Malmedy in den ersten fünf Jahrzehnten der preußischen Verwaltung, Bonn 1940.
- Kaufmann, Karl Leopold: Der Kreis Malmedy. Geschichte eines Eifelkreises von 1865 bis 1920, Bonn 1961.
- Minke, Alfred: 1000 Jahre ostbelgische Kirchengeschichte - Alte Archive erzählen (Staatsarchiv Eupen Ausstellungskataloge Bd. 1), Eupen 1998.
- Pabst, Klaus: Zwischenspiel: Das "Bistum Eupen und Malmedy" 1921-1925. Kirche und Nationalismus nach dem Ersten Weltkrieg im Aachener Raum, in: Lebensraum Bistum Aachen. Tradition - Aktualität - Zukunft, hrsg. v. Philipp Boonen (Aachener Beiträge zur Pastoral- und Bildungsfragen Bd. 10), Aachen 1982, S. 26-62.
- Bestandslaufzeit
-
1778 - 1786, 1826 - 1939
- Weitere Objektseiten
- Geliefert über
- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs
- Letzte Aktualisierung
-
23.06.2025, 08:11 MESZ
Datenpartner
Bischöfliches Diözesanarchiv Aachen. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Bestand
Entstanden
- 1778 - 1786, 1826 - 1939