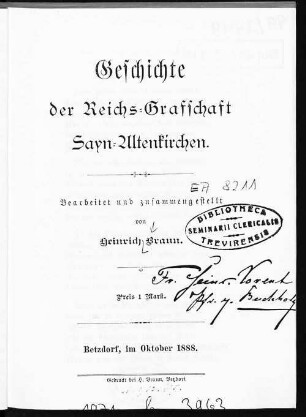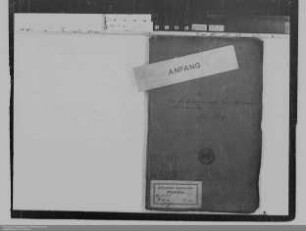Bestand
Reichsgrafschaft Sayn-Altenkirchen, -Hachenburg (Bestand)
Form und Inhalt: Die Grafen von Sayn sind erstmals 1139 belegt. Ihr Name leitet sich von der Burg Sayn ab, die bei Bendorf auf einem Sporn zwischen Sayn- und Brexbach liegt. Im 12. Jahrhundert erwarben die Grafen Güter im Westerwald, an der Sieg, die Vogtei über das Kölner Domstift und die Bonner Stifte sowie Rechte am linken Niederrhein sowie Besitzrechte an Ahr und Mosel. Brun(o) IV. von Sayn war 1205-1208 Erzbischof von Köln. Heinrich III. von Sayn (1202-1246) erwarb durch die Heirat mit Mechtild von Landsberg den reichen Thüringer Besitz am Mittelrhein (Burgen Windeck, Altenwied und Neuerburg, Vogteien des Koblenzer Stifts St. Florin zu Höhn, Obermendig und Schöneberg u.a. mehr). Er stieg infolgedessen zu einem der mächtigsten Dynasten der Region auf. 1220 erwarb er die Herrschaft Freusburg, 1231 die Herrschaft Vallendar.
Nach dem Tod Heinrichs III. fielen seine Territorien über die weibliche Erbfolge an eine Nebenlinie der Grafen von Sponheim-Starkenburg (Hintere Grafschaft Sponheim), womit die älteren durch die jüngeren Grafen von Sayn abgelöst wurden. Mit der Grafschaft Sayn fielen Gebiete auf dem rechten Rheinufer vom Saynbach, im bergischen Land (Homburg) und bis zur Sieg, an der Untermosel (Winningen), an der Ahr (Saffenburg) und am Niederrhein (Hülchrath bei Grevenbroich) an Gottfried von Sponheim-Starkenburg. Dieser vereinbarte 1265 mit seinem Bruder, dass fortan der Rhein die Grenze zwischen den Grafschaften Sponheim-Starkenburg und Sayn bilden sollte; infolgedessen fiel Winningen als einzige saynische Besitzung an die Hintere Grafschaft Sponheim. Gottfried und seine Nachkommen nannten sich in der Folge nur noch Grafen von Sayn. Allerdings gingen beim Übergang der Herrschaft 1247 beträchtliche Gebiete an das Erzstift Köln und verschiedene geistliche Institutionen (u.a. den Deutschen Orden) verloren: Die Grafschaft wurde vom Niederrhein und der Siegmündung abgedrängt und immer mehr auf den Westerwald beschränkt; auch im Oberbergischen büßten sie Besitz ein.
Das neue Grafenhaus spaltete sich 1294 in eine Johann(es)linie (Sayn) und eine Engelbertlinie (Homburg). Unter Graf Gerhard II. (1420-1493) aus der Johannlinie erreichte die Grafschaft eine Blüte, die der unter Heinrich III. fast gleichkam, doch setzte nach seinem Tod ein markanter Verfall ein. Die Engelbertlinie, die den kleineren Besitzanteil des alten Grafenhauses übernommen hatte, erwarb 1357/58/61 die Güter der Grafen von Wittgenstein an der oberen Lahn im westfälisch-hessischen Grenzgebiet und nannte sich fortan Sayn-Wittgenstein.
Heinrich IV. (1573/88-1605/06) aus der Johannlinie besaß neben der von Kurpfalz lehnbaren eigentlichen Grafschaft Sayn die Vogteien zu Urmitz und Irlich als Reichslehen, Burg und Stadt Hachenburg, das Dorf Irlich und das Dorf Flammersfeld als Lehen Kurkölns, das Schloss Friedewald als hessisches und das Schloss Braunsberg als kurpfälzisches Lehen. Hinzu kamen Feste, Burg und Amt Freusburg, die Burg Sayn mit Zubehör sowie Rechte zu Maxsain, Vallendar und Selters als Lehen von Kurtrier nebst den Höfen und Gütern, das halbe Kirchspiel Wissen u.a. mehr. Mit Heinrich IV. erlosch die Johannlinie 1606 im Mannesstamm; schon 1603 hatte dieser den Grafen Wilhelm von Sayn-Wittgenstein zu seinem Erben und Mitregenten angenommen und ihm 1605 die Regierung vollständig überlassen. Kurz zuvor waren Rheinbrohl an Kurtrier abgetreten (1601) und die Herrschaft Freusburg an Kurtrier verkauft worden (1602). Sayn (mit der Burg Sayn am Saynbach bei Bendorf), Mülhofen, Stromberg und Urmitz fielen ebenfalls nach dem Aussterben der Johannlinie an Kurtrier und bildeten fortan das kurtrierische Amt Sayn. Die Vorgänger Heinrichs IV. hatten 1561 die lutherische Konfession in der Grafschaft eingeführt; Graf Wilhelm vollzog bald nach Regierungsantritt die Wende zum Calvinismus, während die an Kurtrier gefallenen Territorien rekatholisiert wurden.
Die 1294 entstandene Engelbertlinie hatte sich 1603 in drei Linien aufgespalten, als Ludwig der Ältere von Sayn-Wittgenstein (1532-1605) auf die Regierung verzichtet und seinen Besitz unter seinen drei älteren Söhnen geteilt hatte: Der bereits als Erbe der Johannlinie erwähnte Wilhelm (1569-1623) begründete die Linie Sayn-Wittgenstein-Sayn, Georg (1565-1631) die Linie Sayn-Wittgenstein-Berleburg, und Ludwig (1571-1634) die Linie Sayn-Wittgenstein-Wittgenstein (ab 1652 Sayn-Wittgenstein-Hohenstein). Wilhelm von Sayn-Wittgenstein-Sayn vererbte seine Territorien seinem Sohn aus erster Ehe, Ernst (1623-1632). Dass nach dem frühen Tod von Ernsts Sohn Ludwig (gest. 1636) Ludwigs Schwestern Ernestine und Johanna (Johanne, Johannetta, Jeanette) das Erbe antreten sollten, nutzte Wilhelms Sohn aus zweiter Ehe, Christian, um selbst das Erbe Wilhelms zu beanspruchen, wobei er auf die Hilfe der Linie Sayn-Wittgenstein zählen konnte. Christian brachte 1642 Altenkirchen, Mehren, Almersbach, Schönberg, Höchstenbach, Maxsain, Burbach und die Vogtei Roßbach in seine Gewalt. Den Gräfinnen, deren Vormundschaft die Gräfin-Witwe Luise Juliane von Erbach innehatte, blieben nur die Kirchspiele Daaden, Flammersfeld, Hamm und Birnbach; das Schloss Friedewald behauptete Luise Juliane als ihr Witwengut. Kurköln wiederum hatte 1636 Stadt und Amt Hachenburg sowie das Kirchspiel Hamm als heimgefallene Lehen eingezogen und dem Bischof von Osnabrück und dessen Brüdern, den Grafen von Wartenberg, überlassen. Die Stadt Bendorf wechselte wiederholt den Besitzer.
Der Westfälische Frieden (1648) verfügte die Wiederherstellung der Grafschaft Sayn: Kurköln trat das Amt Hachenburg 1649 den Gräfinnen ab, und 1651 wurde auch Bendorf zurückgegeben. Ein Vertrag mit Kurtrier regelte 1652 die Rückgabe der Herrschaft Freusburg sowie von Vallendar, Maxsain und Selters als Lehen Kurtriers; die Gräfinnen verzichteten im Gegenzug auf Schloss, Tal und Abtei Sayn, auf die Dörfer Stromberg und Mühlhofen, auf Rheinbrohl, die Vogteien Irlich und Urmitz u.a. mehr. Ein Beschluss des Reichshofrates - neben dem Reichskammergericht das oberste Reichsgericht - vom 3. März 1661 bzw. die daraufhin erfolgende Reichsexekution zwang Christian von Sayn-Wittgenstein, 1662 die Gebiete herauszugeben, die er mit kurpfälzischem Beistand besetzt hatte. Dies betraf u.a. Altenkirchen, das nun von Kurköln den beiden Gräfinnen zu Lehen gegeben wurde.
Die Gräfinnen teilten in einer Folge von Verträgen (1652, 1662/68 und 1671) die Grafschaft: Die Grafschaft Sayn-Altenkirchen (Freusburg, Fischbach, Kirchen, Gebhardshain, Daaden, Altenkirchen, Mehren, Friedewald und Almersbach) bildete Johannas Anteil, die Grafschaft Sayn-Hachenburg (Hachenburg, Kroppach, Hamm, Flammersfeld, Alpenrod, Altstadt, Birnbach, Kirburg, Maxsain, Höchstenbach, Schöneberg und Seelbach) den von Ernestine, die mit dem Grafen Salentin Ernst von Manderscheid vermählt war.
Allgemein ist die Verwaltungsgeschichte der Grafschaft im 16. und 17. Jahrhundert wegen der rasch aufeinanderfolgenden Besitzteilungen und Wittumsverschreibungen, der Kriegsereignisse und wechselnder Okkupationen äußerst unübersichtlich. Selbst die Erbteilungen zwischen 1652-1671, die die Westerwälder Besitzungen in die beiden bis zum Ende des alten Reiches bestehenden Güterkomplexe Sayn-Hachenburg und Sayn-Altenkirchen zerlegten, sagen über die wirklichen Inhaber der jeweiligen Besitzungen nicht allzu viel, da der wechselseitige Gebietsaustausch, die zeitweiligen Verpfändungen an Dritte sowie die kurzlebigen Vergaben in Seitenlinien fortgesetzt wurden. Die Situation wurde dadurch noch komplizierter, dass Sayn-Altenkirchen wie Sayn-Hachenburg durch die Ehen beider Erbinnen an räumlich entfernt residierende Dynastien fielen, was für die Einrichtung vieler kurzlebiger Regierungs- und Justizkommissionen als regionaler Administrationsebene über der lokalen, in Ämtern und Kirchspielen gegliederten Verwaltung sorgte: So fiel Sayn-Altenkirchen durch die zweite Ehe der Erbin Johanna mit Johann Georg I. von Sachsen-Weimar-Eisenach an die ernestinischen Wettiner und wurde fortan durch in Altenkirchen amtierende Statthalter dieser thüringischen Dynastie regiert. 1741 fiel Sayn-Altenkirchen erblich an Brandenburg-Ansbach, eine Nebenlinie des preußischen Königshauses der Hohenzollern. Allerdings machten die Grafen von Sayn-Wittgenstein nach wie vor das Erbrecht der 1636 übergangenen männlichen Linie geltend: Ihr Versuch, sich während des Interregnums im Reich (1740-1742) mit kurpfälzischer Rückendeckung handstreichartig in den Besitz von Sayn-Altenkirchen zu setzen, scheiterte aber dank einer Intervention Friedrichs II. von Preußen zu Gunsten seines ansbachischen Schwagers. 1744 wurde durch Tauschvertrag Bendorf hinzu erworben, während die Vogtei Roßbach damals an Sayn-Hachenburg abgegeben wurde. Der letzte Markgraf entsagte 1791 zu Gunsten Preußens der Herrschaft. 1802/03 kam Sayn-Altenkirchen infolge des Reichsdeputationshauptschlusses an Nassau-Usingen. Durch den Wiener Kongress (1815) wurde das Territorium Teil des preußischen Großherzogtums Niederrhein (1822 Zusammenschluss mit der Provinz Jülich-Kleve-Berg zur Rheinprovinz). 1946 fiel es an das neu gegründete Land Rheinland-Pfalz.
Sayn-Hachenburg fiel durch die Heirat Ernestines mit Salentin Ernst von Manderscheid an eine katholische Dynastie. Über die weibliche Erbfolge gelangte es 1714/15 an das aus Thüringen stammende Haus Kirchberg, das seinen Hauptsitz nach Hachenburg verlegte. Auch hier versuchten die Grafen von Sayn-Wittgenstein, die Entscheidung von 1636 rückgängig zu machen: Ihr 1742 unternommener Versuch, sich in den Besitz von Sayn-Hachenburg zu bringen, scheiterte jedoch. Nach dem Erlöschen des Hauses Kirchberg 1799 fiel der Großteil des Erbes an Nassau-Weilburg. Diesem fielen durch den Reichsdeputationshauptschluss (1803) auch die ehemals saynischen Gebiete zu, die Anfang des 17. Jahrhunderts an Kurtrier gegangen waren. Nassau-Weilburg und Nassau-Usingen schlossen sich 1806 zum Herzogtum Nassau zusammen. Der Wiener Kongress (1815) erkannte die ehemals saynischen Gebiete, die bis 1803 zu Kurtrier gehört hatten, Preußen zu. Die verbleibenden Gebiete Sayn-Hachenburgs verblieben beim Herzogtum Nassau, bis dieses 1866 von Preußen annektiert wurde. Über Preußen fielen die sayn-hachenburgischen Territorien 1946 an Rheinland-Pfalz.
Im Teilungsrezess vom 19. August 1652 wurde die Aufteilung des Sayner Archivs zu Hachenburg nach dem Besitzstand der beiden Zweige bestimmt. In Wirklichkeit entstand eine Dreiteilung, weil das provisorische Gemeinschaftliche Archiv in Hachenburg nicht aufgelöst werden konnte. Das Archiv der Grafschaft Sayn-Hachenburg wurde 1654 durch einen Brand dezimiert, blieb jedoch im Wesentlichen bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu Hachenburg. Wechselvoll dagegen war das Schicksal des Sayn-Altenkircher Archivs: Es befand sich bis 1699 zum größten Teil im Schloss zu Altenkirchen, kleinere Teile im Schloss zu Friedewald. 1699 wurden die wichtigeren Archivalien in das Schloss zu Eisenach transportiert. Sie wurden dort und zeitweise auf der Wartburg verwahrt. Zu Altenkirchen waren Altregistraturteile zurückgeblieben, die durch Neuzugänge anwuchsen.
Als der Übergang von Sayn-Altenkirchen an die Markgrafen von Brandenburg-Ansbach sich abzeichnete, schloss am 24. Dezember 1736 der Herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach mit dem Besitzer der Grafschaft Sayn-Hachenburg, dem Burggrafen von Kirchberg, einen Vertrag, der die Rückführung der Sayn-Altenkirchener Archivalien nach Hachenburg und die getrennte Aufstellung und Verwaltung beider Partikulararchive und des Gemeinsamen Archivs vorsah. Beim Anfall von Sayn-Altenkirchen an Brandenburg-Ansbach 1741 wurde die Hauptmasse der Sayn-Altenkirchener Archivalien jedoch nach Ansbach geschafft. Nachdem die preußischen Könige 1791 in den Besitz Ansbachs gelangt waren, wurde der Aktenbestand zu Ansbach zwischen den dortigen Sayner Administrationskollegien und dem nun zu Berlin geschaffenen Ministerium für die Markgrafschaft einschließlich Sayn-Altenkirchen aufgeteilt. Für die Jahre (1802-1815), in denen Sayn-Altenkirchen zum Herzogtum Nassau gehörte, lassen sich keine Archivalienauslieferungen von preußischer Seite feststellen. Als Preußen 1815 durch Gebietsaustausch mit dem Herzogtum Nassau alle Gebiete von Sayn-Altenkirchen sowie Teile der ehemaligen Grafschaft Sayn-Hachenburg (Flammersfeld, Schöneberg, Birnbach und Hamm) erhielt, befanden sich Sayn-Altenkircher Archivalien an vier verschiedenen Lagerungsorten: zu Berlin und Ansbach, zu Hachenburg im Gemeinschaftlichen Archiv und zu Altenkirchen in der ehemaligen Justizkanzlei. Kurz nach 1815 wurden die Berliner, Ansbacher und Altenkirchener Teile in Koblenz vereinigt, während die Hachenburger Teile zunächst vergessen oder vom bisherigen Besitzer, dem Herzogtum Nassau, verheimlicht wurden. Bald nach Abschluss der Verzeichnung fiel in Koblenz auf, dass die Archivalien zu den 1815 zu Preußen gekommenen Sayn-Hachenburger Gebietsteilen fehlten und bestimmte Aktengruppen des Sayn-Altenkirchener Aktenbestandes nur sehr schwach belegt waren. 1843 erfuhr der Leiter des Koblenzer Staatsarchivs, Archivrat Heinrich Beyer, von der Existenz eines Sayner Gesamtarchivs des Herzogtums Nassau zu Weilburg. 1857 war es ihm möglich, die Aufteilung des Aktenbestand zu Weilburg und des Urkundenbestands zu Idstein zu bewirken. Hingegen verweigerte ihm die nassauische Regierung das Betreten des Zentralarchivs zu Idstein.
Infolge der häufigen Besitzwechsel zwischen den verschiedenen Sayner Linien und der unvollkommenen Aufteilung der Sayner Archivalien zwischen Preußen und Nassau befinden sich sowohl im Landeshauptarchiv Koblenz (bis 1975 Staatsarchiv Koblenz) als auch im heutigen Hessischen Hauptstaatsarchiv zu Wiesbaden umfangreiche Anteil der Sayner Überlieferung, wobei in Koblenz die Sayn-Altenkirchener Überlieferung bzw. das Archivgut zu den Territorien, die spätestens 1815 preußisch wurden, überwiegt.
Die Erschließung des Bestandes geht auf ein 1829/30 erstelltes Akten- und ein 1916 erstelltes Urkunden-Findbuch zurück. 1983 veröffentlichte die Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz ein dreibändiges Findbuch. 2015-2018 wurden die Findbücher in die Datenbank der Landesarchivverwaltung eingegeben. Dabei wurden die Regesten und Titelaufnahmen modernisiert, Fehler korrigiert und Schreibweisen von Orts- und Personennamen vereinheitlicht. Die thematische Untergliederung des Bestandes geht auf die ursprünglichen Findmittel zurück; sie ist nicht immer sachgerecht, und v.a. bilden die Bezeichnungen der obersten Gliederungsebenen deren Inhalt nicht immer gut ab; darum wird im Folgenden versucht, durch Angabe der häufigsten Betreffe in Klammern einen Eindruck vom Inhalt der Hauptelemente des Bestandes zu geben.
Die als Ausfertigung oder Abschrift vorhandenen Urkunden im Bestand entstammen zu einem Drittel dem Mittelalter (bis 1500). Fast zwei Drittel aller Urkunden entfallen auf die Rubrik "Allgemein", was so verschiedene Themen umfasst wie Schulden und Renten, Verkäufe und Vergleiche, Testamente, Märkte, Zölle, Grenzen u.a. mehr. Etwa ein Viertel der Urkunden befasst sich mit Lehen. Weitaus weniger zahlreich ist die Urkunden-Überlieferung zu Ministerialen und Leibeigenen (weitestgehend den Tausch von Leibeigenen betreffend), Kirchen (Stiftungen, Besetzung von Pfarrstellen, Finanzen und Grundbesitz) und Klöstern (Schenkungen, Zehnte, Renten u.a. mehr). Die Akten und Amtsbücher des Bestandes sind fast alle ab 1500 entstanden. Mit jeweils fast einem Fünftel der Gesamtmenge an Akten und Amtsbücher - d.h. mit jeweils zwischen 1200-1300 Archivalien - sind die Bereiche Religion (Besetzung von Pfarreien, Schule, Kirchen- und Schulgebäude, Finanzen, Klöster, Juden) bzw. Wirtschaft und Verkehr (Landwirtschaft, Jagd, Forsten, Fischerei, Mühlen, Manufakturen, Bergwerks- und Hüttenwesen, Post, Zünfte und Bauten) die am stärksten vertretenen Themenfelder. Aber mit jeweils zehn bis fünfzehn Prozent der Gesamtmenge bzw. jeweils 780-1000 Archivalien sind auch die Landeshoheitssachen (Beziehungen zu Nachbarterritorien, Krieg), Familie (Inventare, Domänen, Lehen), Regierung (Verordnungen, Grenzen, Amts- und Gemeindeverwaltung, Beamte) und Finanzen (Rechnungen, Steuern, Zehnt, Schulden) sehr gut vertreten. Die verbleibenden dreißig Prozent der Akten und Amtsbücher verteilen sich auf die Justiz, "Polizeisachen" (Verordnungen, Bauten, Viehhandel, Arme und Landstreicher, Feuerpolizei, Viehzählungen, Vormundschaften u.a. mehr), "Marktsachen" (Getreidepreise, Abhaltung von Märkten, Zölle, Gewerbegenehmigungen, Münzwesen), "Historische Sachen" (Beschreibungen von Orten, Ämtern oder Grafschaften, Erbfolge, Vorbereitende Erhebungen zu den Landesteilungen, Güterschätzungen, Häuserverzeichnisse u.a. mehr) und Medizinalangelegenheiten (Vorsorgemaßnahmen, Hebammen usw.), wobei die Aufzählung den Umfang der Überlieferung in absteigender Reihenfolge wiedergibt.
- Bestandssignatur
-
30
- Kontext
-
Landeshauptarchiv Koblenz (Archivtektonik)
- Verwandte Bestände und Literatur
-
Fabricius, Wilhelm: Erläuterungen zum geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz Bd. 2: Die Karte von 1789. Einteilung und Entwickelung der Territorien von 1600 bis 1794, Bonn 1898 (ND Bonn 1965)
Joachim J. Halbekann: Die älteren Grafen von Sayn, Wiesbaden 1997
Gensicke, Hellmuth: Landesgeschichte des Westerwaldes, Wiesbaden 1958
Köbler, Gerhard: Historisches Lexikon der deutschen Länder. Die deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart, 7. vollständig überarb. Aufl., München 2007
Tavernier, Ludwig: Kulturlandschaft Sayn, Regensburg 2011
Das Hessische Hauptstaatsarchiv Wiesbaden verwahrt den größten Bestand an Sayner Archivalien, wobei die sayn-hachenburgische Überlieferung dominiert (Bestände 340 und 343: "Grafschaft Sayn-Hachenburg" bzw. "Sayn-Hachenburgische Rechnungen") - umgekehrt zum Bestand im Landeshauptarchiv Koblenz, in dem der Sayn-Altenkirchener Anteil überwiegt und der sayn-hachenburgische Anteil sich weitgehend auf Archivalien zu den 1815 an Preußen gefallenen Territorien Sayn-Hachenurgs beschränkt. Im Landeshauptarchiv Koblenz wird die Sayner Überlieferung v.a. durch die Archivalien der Städte Bendorf (Best. 655,064 und 655,064 VK) und Hachenburg (Best. 620) ergänzt.
- Bestandslaufzeit
-
2233 Urkunden (2297 Urkundenregesten): (1093-1139) 1152, 1202, 1204, 1221-1226, 1241-1805; 7095 Akten und Amtsbücher: (1152-1289) 1290, 1300-1860, (19. Jh.) (85 Rgm)
- Weitere Objektseiten
- Letzte Aktualisierung
-
01.04.2025, 13:23 MESZ
Datenpartner
Landeshauptarchiv Koblenz. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Bestand
Entstanden
- 2233 Urkunden (2297 Urkundenregesten): (1093-1139) 1152, 1202, 1204, 1221-1226, 1241-1805; 7095 Akten und Amtsbücher: (1152-1289) 1290, 1300-1860, (19. Jh.) (85 Rgm)