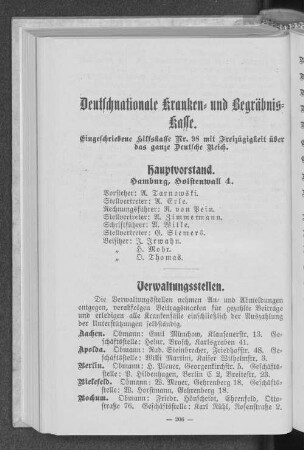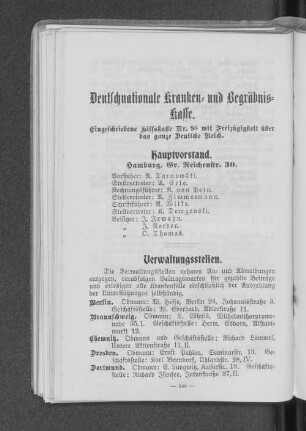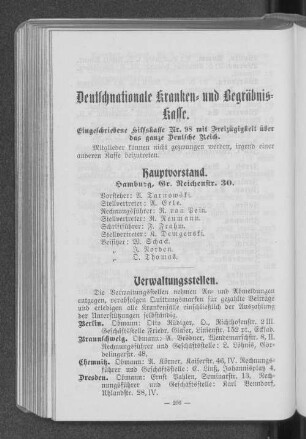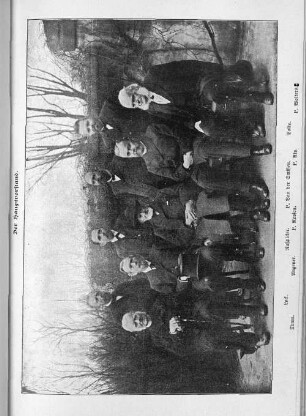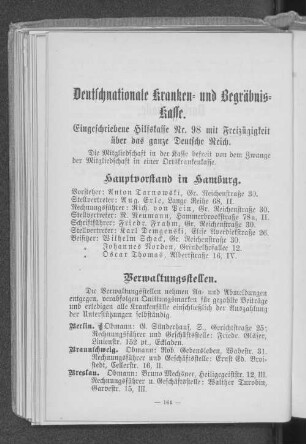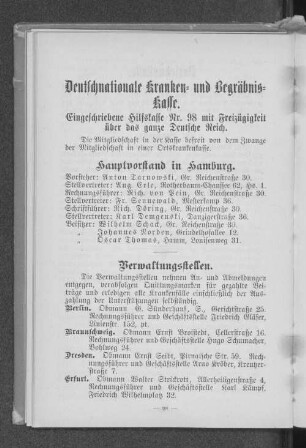Bestand
Hauptvorstand des Preußischen Landesverbands vom Roten Kreuz (Bestand)
Findmittel: Datenbank; Findbuch, 1 Bd.
Vereinsgeschichte
Hauptvorstand des Preußischen Landesvereins vom Roten Kreuz
Am 8. Februar 1864, kurz nach Ausbruch des Deutsch-Dänischen Krieges, wurde der "Preußische Verein zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger" in Berlin gegründet. Bald darauf erfolgte am 4. Januar 1865 die Ratifizierung der ersten Genfer Konvention vom 22. August 1864 durch Preußen. Die Satzung des Vereins wurde kriegsbedingt erst am 3. April 1866 beschlossen (vgl. Preußisches Ministerialblatt der gesamten inneren Verwaltung, 1866, S. 128 ff.). Die staatliche Anerkennung als rechtsfähiger, privatrechtlich organisierter Verein erfolgte am 7. Mai 1866. Kurz darauf wurde am 11. November 1866 mit dem "Vaterländischen Frauenverein" eine weitere Rot-Kreuz-Organisation in Preußen gebildet, die Frauen eine Möglichkeit bot, sich in der Krankenpflege zu engagieren. Beide Vereine bestanden zunächst getrennt voneinander.
Auch in anderen deutschen Staaten entstanden Landesvereine vom Roten Kreuz. Am 20. April 1869 gründeten das preußische Zentralkomitee und 11 weitere Landesvereine das "Centralkomitee der deutschen Vereine zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger". Dieses Zentralkomitee fungierte als Dachorganisation der deutschen Rot-Kreuz-Vereine (für Männer) und benannte sich am 13. Dezember 1879 in "Central-Komitee der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz" um.
Im Oktober 1898 wurde auf der ersten "Reichskonferenz der Landes- und Provinzialvereine vom Roten Kreuz und verwandten Organisationen" in Stuttgart festgelegt, dass die 26 bestehenden Rot-Kreuz-Organisationen der deutschen Bundesstaaten die einheitliche Bezeichnung "Landesverein vom Roten Kreuz" führen sollten. Infolgedessen benannte sich der "Preußische Verein zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger" in "Preußischer Landesverein vom Roten Kreuz" um.
Die Leitung auf Ebene des preußischen Staates erfolgte durch das "Central-Comité des Preußischen Landesvereins vom Roten Kreuz", das seinen Sitz ebenfalls in Berlin hatte. Das Centralkomitee hatte anfangs vor allem die Aufgabe "in Friedenzeiten die für einen Kriegsfall erforderlichen Vorbereitungen zur Pflege von Verwundeten und Kranken zu treffen" und "in Kriegszeiten im Anschlusse an die militärische Sanitätsverwaltung bei der Heilung und Pflege der im Felde verwundeten und erkrankten Krieger mitzuwirken."
Nach dem Ersten Weltkrieg gründeten dann am 25. Januar 1921 alle deutschen Landesvereine vom Roten Kreuz und die Landesfrauenvereine eine neue Dachorganisation, die die Bezeichnung "Deutsches Rotes Kreuz e.V." führte und ihren Sitz in Berlin hat. Im Zuge der Neuausrichtung in der Weimarer Republik wurde der unpolitische und karitative Charakter der Rot-Kreuz-Organisationen stärker betont. In Preußen führte ab ca. 1922 das Zentralkomitee dann die Bezeichnung "Hauptvorstand des Preußischen Landesvereins vom Roten Kreuz."
Auf Grund des großen territorialen Umfangs des Staates Preußen wurden in den Provinzen eigene Provinzialvereine gebildet. Diese übernahmen Mittlerfunktionen zwischen dem Hauptvorstand und den Ortsvereinen. Für den vorliegenden Bestand relevant ist der "Provinzialverein vom Roten Kreuz für Schleswig-Holstein" mit Sitz in Kiel, der im Mai 1934 in "Deutsches Rotes Kreuz - Provinzial-Männerverein Schleswig-Holstein" umbenannt wurde.
Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung im Jahre 1933 erfolgte die schrittweise Gleichschaltung aller Gliederungen des Rotes Kreuzes. Am 28. Februar 1934 gab sich der Landesverein eine neue Satzung. Gleichzeitig erfolgte die Umbenennung in "Deutsches Rotes Kreuz - Preußischer Landes-Männerverein." Der Hauptvorstand selbst erhielt die Bezeichnung "Landesverwaltung."
Durch das "Gesetz über das Deutsche Rote Kreuz" vom 9. Dezember 1937 (RGBl. I, S. 1330) wurde das Deutsche Rote Kreuz e. V., der Reichsfrauenbund, die Vereine und Untergliederungen zu einer gemeinnützigen und rechtsfähigen "Einheit" unter der Bezeichnung "Deutsches Rotes Kreuz" zusammengeschlossen. Durch das Gesetz wurden neben den Dachverbänden, die Landes-, Provinzial-, Kreis- und Ortsvereine, sowie die Sanitätskolonnen des Deutschen Roten Kreuzes aufgelöst. Die Mitglieder der aufgelösten Verbände, Vereine und Untergliederungen wurden als Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes übernommen.
Sanitätskolonnen (Ortsvereine)
Seit den 1880er Jahren entstanden in Preußen und anderen deutschen Staaten Sanitätskolonnen. Diese Rot-Kreuz-Ortsvereine waren freiwillig organisierte Gruppen von Ersthelfern, deren Mitglieder durch Ärzte als freiwillige Helfer und Krankenträger ausgebildet wurden. Voraussetzung für die Aufnahme einer Kolonne in den Preußischen Landesverein war in den 1920er Jahren die Beitrittserklärung von i. d. R. 30 Mitgliedern und die Annahme der vorgedruckten Satzung. Nach Genehmigung durch den Hauptvorstand konnte der Ortsverein das Rote Kreuz als Abzeichen führen und sich ggfs. als eingetragener Verein ins Vereinsregister aufnehmen lassen. Die Sanitätskolonne agierte sodann als eine Unterabteilung des Preußischen Landesverein vom Roten Kreuz und gehörte auch dem Provinzialverein vom Roten Kreuz der betreffenden preußischen Provinz an. Räumlich waren sie für eine Gemeinde zuständig, manchmal auch für mehrere kleine Orte oder für einen Amtsbezirk. In größeren Städten (z. B. Kiel), konnten auch mehrere Sanitätskolonnen tätig sein.
In der Satzung für die Sanitätskolonnen wurde folgender Vereinszweck formuliert: "Der Verein will gemeinnützig sein und sich auf allen Arbeitsgebieten betätigen, die die Verhütung, Bekämpfung und Linderung gesundheitlicher und ähnlicher Notstände bezwecken. Der Verein sieht es als seine besondere Aufgabe Männer deutscher Staatszugehörigkeit ohne Rücksicht auf ihre gesellschaftliche, politische oder wirtschaftliche Stellung oder ihr Religionsbekenntnis für die Zwecke der freiwilligen Krankenpflege auszubilden." Ordentliche Mitglieder konnten männliche, deutsche Staatsangehörige werden, die das 18. Lebensjahr vollendet hatten. Sie mussten unbescholten, körperlich, geistig und "sittlich" für die Krankenpflege geeignet sein und die erforderliche Ausbildung nachweisen. Alle ordentlichen Mitglieder des Ortsvereins waren zugleich Mitglieder des Preußischen Landesvereins. Für Mitglieder im Alter zwischen 14 und 18 Jahren bestand die Möglichkeit eine Jugendgruppe zu bilden. Geleitet wurde die Sanitätskolonne durch einen Kolonnenführer, dem ein Kolonnenarzt zur Seite stand. Zum Vereinsleben gehörten regelmäßige Zusammenkünfte, die u.a. der Vermittlung von Fachwissen dienten. Zur Vertiefung der praktischen Kenntnisse wurden regelmäßig Übungen abgehalten. Die Sanitätskolonnen waren nach dem Vorbild der militärischen Sanitätseinheiten organisiert und operierten von einer, meist zentral bzw. verkehrsgünstig gelegenen Unfallhilfsstelle aus. Ihre wichtigsten Aufgaben waren der Transport von Kranken und die Versorgung von Verletzten.
Im Jahre 1935 erhielten die Sanitätskolonnen neue Satzungen. Bei dieser Gelegenheit wurde noch einmal die Struktur der Ortsvereine verändert. Viele bisherige Sanitätskolonnen wurden in Sanitätshalbzüge bzw. Sanitätszüge umbenannt. Im Jahre 1937 erfolgte dann durch das o. g. "Gesetz über das Deutsche Rote Kreuz" die Auflösung der Ortsvereine. Ihre Mitglieder wurden in das neue geschaffene Deutsche Rote Kreuz übernommen.
Bestandsbeschreibung
Der überlieferte Aktenbestand bildet nur einen sehr geringen Teil des Tätigkeitsbereichs des Hauptvorstandes des Preußischen Landesvereins vom Roten Kreuz ab. Bei dem größten Teil der Archivalien (116 Aktenbände) handelt es sich um Schriftwechsel zwischen dem Hauptvorstand und den verschiedenen Sanitätskolonnen und Sanitäts(halb)zügen in der Provinz Schleswig-Holstein. Jede Akte bezieht sich auf einen einzelnen Rot-Kreuz-Ortsverein und ist inhaltlich relativ gleichförmig aufgebaut. Sie enthält i. d. R. Jahresberichte (u.a. mit Angaben zur Gründung, zum Mitgliederbestand, zur Anzahl der Unfallhilfsstellen, zu den durchgeführten Krankentransporten und Hilfeleistungen durch Mitglieder, Anzahl der Übungen und Lehrgänge), Vorschläge für die Verleihung von Ehrenzeichen, Mitgliederverzeichnisse, Vereinssatzungen und Schriftwechsel mit dem Hauptvorstand (u.a. zum Bezug von Lehr- und Übungsmaterial aus dem "Zentraldepot vom Roten Kreuz" in Neubabelsberg). Zeitlich reichen die Unterlagen von den frühen 1920er Jahren bis zur Auflösung der Sanitätskolonnen und Sanitäts(halb)züge im Jahre 1937.
Drei weitere Akten enthalten den Schriftwechsel zwischen dem Hauptvorstand und dem Provinzialverein vom Roten Kreuz für Schleswig-Holstein, der sich jedoch inhaltlich v.a. auf die Angelegenheiten der verschiedenen Sanitätskolonnen und Sanitäts(halb)züge dieser Provinz bezieht.
Bestandsgeschichte
Es konnte bisher nicht geklärt werden, wann und auf welchem Wege der Bestand ins Archiv gelangt ist. Im "Verzeichnis über die Akzessionen des Preußischen Geheimen Staatsarchivs in den Jahren 1934-1944" von Heinrich Waldmann (1952) ist er nicht aufgeführt. Die Akten können also erst nach dem Zweiten Weltkrieg übernommen worden sein. Ein erster Hinweis findet sich in der sogen. ZBN-Kartei aus dem Jahr 1974. Dort ist der Bestand zwar aufgeführt, es sind aber keine weitergehenden Angaben vorhanden. Eine Durchsicht der Akten des ehemaligen Zentralen Staatsarchiv Merseburg zur Aktenübernahme und Bestandsabgrenzung (Bestand: I. HA Rep. 178 E) erbrachte keine Hinweise. Nach der Übernahme blieb der Bestand zunächst unverzeichnet und damit unbenutzbar. Er gelangte nach der deutschen Wiedervereinigung 1993/94 zusammen mit den anderen in Merseburg verwahrten Akten in das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem. Zwischen 2006 und 2011 erfolgte lediglich eine Umbettung der vorhandenen 7 Aktenpakete in 11 Archivkartons. Hierdurch wurde zwar der Lagerungszustand verbessert, eine Benutzung war aber weiterhin nicht möglich, da lediglich eine summarische und sehr allgemein gehaltene Auflistung des Inhalts vorhanden war. Um diesem Umstand abzuhelfen, wurden die Akten im Jahre 2021 durch den Archivar Guido Behnke geordnet und verzeichnet. Hierbei erfolgten keine Kassationen. Bei der Verzeichnung wurde jedoch festgestellt, dass der in Merseburg vergebene Bestandsname "Hauptvorstand des Preußischen Landesverbands vom Roten Kreuz" nicht korrekt ist, da die preußische Rot-Kreuz-Organisation als Verein organisiert war und auch stets so bezeichnet wurde. Entsprechend erfolgte eine Änderung der Bestandsbezeichnung in "Hauptvorstand des Preußischen Landesvereins vom Roten Kreuz."
Literaturhinweise
Grüneisen, Felix: Das Deutsche Rote Kreuz in Vergangenheit und Gegenwart, Potsdam-Babelsberg 1939, 291 S.
Kimmle, Ludwig: Der Preußische Landesverein vom Roten Kreuz, in: Das Deutsche Rote Kreuz - Entstehung, Entwicklung und Leistungen der Vereinsorganisation seit Abschluß der Genfer Convention i. J. 1864, Berlin 1910, Bd. 1, S. 777-849
Riesenberger, Dieter: Das Deutsche Rote Kreuz - eine Geschichte 1864-1990, Paderborn 2002, 785 S.
Seithe, Horst: Das Deutsche Rote Kreuz im Dritten Reich (1933-1939) - mit einem Abriss seiner Geschichte in der Weimarer Republik, Frankfurt/Main 1933, 279 S.
Verweis auf andere Bestände im GStA PK
XIV. HA, Rep. 414 Westpreußischer Provinzialverband des Roten Kreuzes
Formalangaben
Bestandsumfang 122 AE (1,2 lfm.)
Laufzeit: 1911 - 1938
Letzte vergebene Nr.
Der Bestand lagert im Magazin Westhafen.
Die Akten sind auf gelben Leihscheinen wie folgt zu bestellen:
I. HA Rep. 226, Nr.
Die Akten sind zu zitieren:
I. HA Rep. 226 Hauptvorstand des Preußischen Landesvereins vom Roten Kreuz, Nr.
Berlin, 05.11.2021 (Guido Behnke)
Zitierweise: GStA PK, I. HA Rep. 226
- Bestandssignatur
-
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, I. HA Rep. 226
- Umfang
-
Umfang: 1,2 lfm (122 VE); 1,2 lfm (122 VE)
- Sprache der Unterlagen
-
deutsch
- Kontext
-
Tektonik >> NICHTSTAATLICHE PROVENIENZEN >> Vereine, Verbände, Organisationen >> Wirtschafts-, Sozial- und Wohlfahrtspolitik
- Bestandslaufzeit
-
Laufzeit: 1911 - 1938
- Weitere Objektseiten
- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs
- Letzte Aktualisierung
-
28.03.2023, 08:52 MESZ
Datenpartner
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Bestand
Entstanden
- Laufzeit: 1911 - 1938