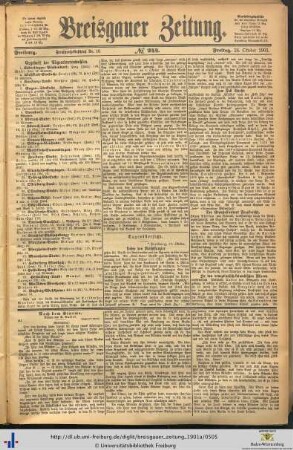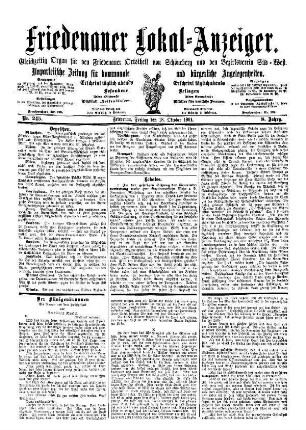Archivbestand
Diapositivsammlung Kirschfeld (Dr. Paul Kirschfeld, Forstpräsident,* 18.10.1901, + 17.4.1990 ) Luft- und Erdbilder hauptsächlich von Baden-Württemberg, aber auch vom übrigen Deutschland, von Europa und aus Übersee (Bestand)
Überlieferungsgeschichte
Lebenslauf von Dr. Paul Kirschfeld, Forstpräsident
Am 5./18. Oktober 1901 wurde Paul Kirschfeld in Riga als dritter von vier Söhnen des Chemikers Leonhard Kirschfeld und seiner Frau Mathilde, geb.Kerkovius geboren. Seine Jugend verbrachte er bis 1910 in Riga, wo er die ersten zwei Schuljahre erlebte. 1910 zogen sie seinem Vater, der schon drei Jahre in Moskau arbeitete, dorthin nach. 1912 übernahm der Vater die Stelle des Chemischen Direktors der Moskauer Filiale der Farbwerke Höchst a. M. In Moskau besuchten die Kinder die deutsche Petri-Pauli-Schule, die erst 1914 russifiziert wurde.
Aus Sicherheitsgründen schickte sein Vater seine Familie nach den Deutschen-Pogrommen 1915 für ein Jahr nach Riga, nach der Frühjahrsrevolution 1917 für vier Monate nach Finnland (Mai bis August) und nach der Oktoberrevolution des gleichen Jahres nach Dorpat, da Riga inzwischen von deutschen Truppen besetzt worden war. Sein Vater blieb stets auf seinem Posten, den er erst 1920 nach der Sozialisierung der Fabrik verlassen konnte.
In Dorpat besuchten die Kinder kurz ein Gymnasium, bis sie nach der Einnahme Dorpats durch deutsche Truppen nach Riga umsiedeln konnten, wo sie im Stadtgymnasium weiterlernten.
Die beiden älteren Brüder waren als Kriegsfreiwillige 1917 und 1918 der Wehrmacht beigetreten, und nach der Invasion der Roten Armee in das Baltikum im Winter 1918 trat auch Paul Kirschfeld als Freiwilliger der Baltischen Landeswehr bei. Seine Mutter floh mit dem vierten Sohn und einer alten, bei ihnen wohnenden Tante nach Dresden.
Er wurde in Libau als MG-Schütze ausgebildet und kam Ende Februar 1919 an die inzwischen weit nach Westkurland vorgeschrittene Front. Den bald darauf beginnenden Vormarsch mit Hilfe deutscher Truppen machte er in vorderster Front bis zur Erreichung der Grenze der Sowjetunion im März 1920 mit.
Als Unterprimaner konnte er im April 1920 noch als Soldat in einem Kurs der Landeswehr das Notabitur bestehen und wurde dann im Mai entlassen. er begab sich zu seiner Mutter nach Dresden. Da ihm die Mittel zum Studium zunächst fehlten, nahm er eine Stelle als Gehilfe des Knechts der Landeshaushaltungsschule Großgraupa bei Pirna an.
Nach Ankunft seines Vaters aus Moskau Ende 1920 und seiner Einstellung als Chemiker bei den Farbwerken in Höchst konnte er im Sommersemester 1921 mit dem Studium der Forstwissenschaft in Freiburg beginnen. er studierte in Freiburg 7 Semester und in Gießen 1 Semester und legte sowohl die Staatliche Forstliche Vorprüfung, wie auch die Hauptprüfung in Freiburg ab. Die Semesterferien benutzte er zu seiner praktischen Ausbildung bei Forstämtern der Fürstlich Fürstenbergischen Verwaltung Donaueschingen, der Stadt Frankfurt a.M., der von Langen-Steinkellerschen Forstverwaltung Birkholz bei Friedeberg/Neumark und dem Badischen Forstamt Ühlingen.
Nach Abschluß seiner Studien im Frühjahr 1925 war er ein Semester Assistent am Forstzoologischen Institut der Universität Freiburg (Prof. Lauterborn), sodann von Anfang August bis Ende Dezember 1925 als Forsteinrichter bei der Lauenburgischen Landeskommunalverwaltung des Kreises Herzogtum Lauenburg in Koberg tätig.
Von Januar 1926 an arbeitete er bei den Staatlichen Forstämtern Roßfeld, Rosenfeld und Rosenstein-Stuttgart als Referendar, doch als Auslandsdeutscher ohne Anrecht auf Anstellung in der Württ. Staatsforstverwaltung oder einer Kommunalverwaltung in Württemberg.
Im Frühjahr 1927 legte er in Stuttgart als Externer die Große Forstliche Staatsprüfung ab.
Paul Kirschfeld wurde darauf Forsteinrichter bei der Fürstlich Fürstenbergischen Forstverwaltung, ein Jahr später bei der Waldinspektion Freudenstadt im Schwarzwald. Vom 1. März bis 30. September 1929 war er Assistent am Bodenkundlichen Institut der Universität Freiburg (Prof. Heibig).
Am 1. Oktober 1929 übernahm er die Leitung der Freiherrlich von Stauffenbergischen Forstverwaltung Wilflingen bei Riedlingen. Nunmehr konnte er seine Verlobte Friedel Willig aus Freiburg heiraten. Der Stauffenbergischen Forstverwaltung schlossen sich, bald nachdem er ihre Leitung übernommen hatte, auch die Freiherrlichen Forstverwaltungen von Freyberg-Allmendingen, von Cotta-Dotternhausen und von Ulm-Erbach an. Die forstlichen Verhältnisse im Bereich dieser vier Verwaltungen waren selten vielgestaltig: in den Waldungen fanden sich sämtliche Baumarten Deutschlands und die mannigfaltigsten Boden- und Standortsverhältnisse unseres Landes zwischen Oberem Neckar, nahe den Schwarzwald-Vorbergen, und der Riß in Oberschwaben.
Während dieser Zeit befaßte er sich auch mit Fragen der Fortbildung der Forstangestellten und Waldarbeiter der Privatverwaltungen. Die von ihm geleiteten Studienfahrten und Lehrgänge waren immer gut besucht und fruchtbar. Seine ersten literarischen Arbeiten erschienen in diesen Jahren im Forstarchiv und im Deutschen Forstwirt. Auch erwarb er den Dr. phil. nat. 1933 an der Universität Freiburg mit der Arbeit "Das Wirtschaftssystem der Badischen Staatsforstverwaltung, untersucht aufgrund der FED 1924 und anderer Schriften".
In der Wilflinger Zeit wurden ihm zwei Kinder in Freiburg geboren: Helga im März 1931, Kuno im April 1934.
Am 1. Januar 1938 übersiedelte die Familie nach Berlin, wo er Forstsachverständiger beim Reichskommissar für die Preisbildung wurde. er mußte alle Fragen der Preisbildung und Preisüberwachung des Rohholzes bearbeiten, worüber die "Verordnung über die Preisbildung für Rohholz im Forstwirtschaftsjahr 1938" mit Erläuterungen erschien. Die während seiner Tätigkeit beim Reichskommissar gewonnenen Erkenntnisse legte er in einem Artikel im Deutschen Forstwirt nieder: "Gebundener Holzpreis und Selbstkostenrechnung".
Am 1. April 1939 übernahm er die Leitung der Forstabteilung der Landesbauernschaft Württemberg in Stuttgart. Damit war er für die Betreuung des gesamten Privatwaldes zuständig und der Forstdirektion unterstellt. 1943 wurde die Forstabteilung der Forstdirektion eingegliedert, und er wurde damit württembergischer Staatsforstbeamter und Referent für den Privatwald. Doch wurde er schon am 1. Juli 1943 zur Wehrmacht eingezogen. Da er nach Untersuchung bei der Truppe sofort GVH geschrieben wurde, meldete er sich als Dolmetscher für Russisch bei der zuständigen Stelle und wurde nach Prüfung in den Osten geschickt, wo er in Reval und später in Libau als Dolmetscher bei einer Turkmenen-Hiwi-Einheit tätig war.
Nachdem die Einheit im März 1945 nach Deutschland verlegt worden war, geriet er in englische Gefangenschaft, aus der er schon im August entlassen wurde, so daß er zu seiner Familie zurückkehren konnte.Er fand sie in Wald in Hohenzollern wieder.
Die Rückmeldung bei der Forstdirektion in Tübingen führte ihn im November 1945 zum Forstamt Riedlingen als Vertreter des noch nicht zurückgekehrten Amtsvorstands. Am 1. Juni 1946 wurde er zum Amtsvorstand des Forstamts Biberach ernannt. Im Juni 1951 wurde er als Referent für Waldbau und Bezirksreferent für den Forstverband Biberach in die Forstdirektion Tübingen berufen und am 1. Dezember 1956 als Referent für forstliche Produktion (Waldbau, Forsteinrichtung, Forstschutz, forstl. Versuchswesen) zum Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten nach Stuttgart versetzt.
Seine Familie war mit ihm nach Berlin und von dort nach Stuttgart umgezogen. Ausgebombt im Februar 1944 (zu der Zeit Soldat in Reval), zog sie zunächst nach Hechingen, dann nach Wilflingen und schließlich nach Wald in Hohenzollern, wo er sie wiederfand. Bald zog die Familie nach Biberach um, von dort nach Bebenhausen, als er Referent in Tübingen wurde. Dort blieb seine Familie auch wohnen, als er nach Stuttgart versetzt worden war. Während der Zeit in Biberach, Tübingen und Stuttgart entfaltete sich eine rege literarische (vgl. Schriftenverzeichnis) und Vortragstätigkeit. Letztere diente vor allem dem Schwäbischen Albverein und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. er mußte aber auch häufig vor Forstbeamten Vorträge über Probleme der heimischen Forstwirtschaft halten, Kurse für Lehrer an der Staatlichen Akademie Calw (Wald und Schule) leiten und war auch in der Volkshochschule Tübingen tätig. Eine besondere Aufgabe war die Herausgabe der Abschlußarbeit der von Baron von Hornstein, Orsenhausen, begründeten Arbeitsgemeinschaft Oberschwäbische Fichtenreviere und einer Monographie "Die Forstwirtschaft in Baden-Württemberg", die aus Anlaß der Tagung des Deutschen Forstvereins 1960 in Stuttgart erschien und 1965 in 2. Auflage herausgegeben wurde.
Schon bald schien ihm das Luftbildmaterial so wertvoll zu werden, dass er etwa 1970 an das Hauptstaatsarchiv in Stuttgart herantrat, mit dem Vorschlag, einstmals die ganze Sammlung als Stiftung zu übernehmen. Er wurde gebeten, eine Auswahl der Bilder vorzuführen, und erhielt nach der Vorführung die Zusage der Übernahme der Sammlung.
Inhalt und Bewertung
Nach Ende des zweiten Weltkrieges entwickelte sich sehr bald ein reger fachlicher, grenzüberschreitender Verkehr, zunächst mit der Schweiz, dann mit Schweden und den übrigen nordischen Staaten, endlich auch mit England und Frankreich. Die Reisen wurden teils vom Forstverein organisiert, teils von den Landesforstverwaltungen. Der Ablauf dieser Reisen war dann natürlich forstfachlich bestimmt, aber Landschaft und geschichtliche Bauten führten immer zu einer Vertiefung der Gesamtdarstellung der Landeskulturen. Bei einigen Reisen (Schweden, England) hat Paul Kirschfeld versucht, die Dia-Folgen aufzugliedern nach Fachgebieten (Land- und Forstwirtschaft, Waldbau, Forstschutz, Holztransport usw.) und Landschaften und historischen Städten und Bauten.
Nach Schweden und Finnland organisierte er im Anschluß an eine forstfachliche Reise eine rein private Reise mit seiner Familie. Auch auf dieser Reise suchte er die Kollegen auf, die die Fachreise geführt hatten, wodurch sich eine Vertiefung der fachlichen Eindrücke ergab, aber auch Gelegenheit geboten wurde, Verkehrswege zu wählen, die der großen Fachgesellschaft verwehrt waren, z. B. eine mehrtägige Dampferfahrt über den Saimasee in Finnland.
Eine besondere Förderung seiner Auslandsreisen ergab sich auch dadurch, daß er vom Ministerium mit der Führung von ausländischen Gästen durch Baden-Württembergs Wälder beauftragt wurde. So konnte er den Leiter der Isländischen Forstverwaltung, den Leiter der Forstwirtschaft der Australischen Papierindustrie, die große Wälder besitzt, Kollegen aus Indien, Nepal, USA und Frankreich führen und wurde immer wieder eingeladen.
Die Einladungen nach Island und Australien konnte er einlösen und intensiv nutzen und erhielt dadurch eingehende Eindrücke in die dortigen Verhältnisse.
So schwebt die Forstwirtschaft über allen Dia-Serien, aber Landschaft und Kultur sind stets mitberücksichtigt. Nur in der Sowjetunion war es unmöglich, forstliche Studien zu treiben, so daß dort nur zufällige Waldbilder gelungen sind.
Die fachliche Unterteilung der Dia-Folgen hat sich nicht bewährt; die chronologische Dia-Folge machte es viel leichter, die etwa gesuchten Bilder wiederzufinden. Allerdings wird dem Nichtbeteiligten dadurch eine Gesamtschau aufgezwungen, die aber vermittels Durchsehens der Bilderverzeichnisse sehr erleichtert werden dürfte.
Während seiner Tätigkeit beim Ministerium ereignete sich eine schwere Sturmkatastrophe im Herbst 1961. Als Waldbaureferent war er daran interessiert, den Umfang der Schäden zu überprüfen. Das schien ihm aus dem Flugzeug besonders gut möglich zu sein. Da die Kosten von der Verwaltung nicht übernommen wurden, nahm er einen Tag Urlaub und flog von Echterdingen mit seinem Sohn in das Hauptschadgebiet im Oberland. Die Luftaufnahmen zeigten die großen Sturmflächen eindrucksvoll, aber noch interessanter waren die nicht betroffenen Waldbilder, sowohl was den Mischwald von Nadel- und Laubbäumen betrifft, als auch die Hiebsführungsbilder. Außerhalb des Waldes war die wachsende Bebauung und die Zerschneidung der Landschaft durch Straßen für den Naturfreund erschütternd! So konnte er das Fliegen nicht mehr lassen und es sammelten sich Bilder aus der ganzen Fülle eindrucksvoller Landschaften im vielgestaltigen, schönen Baden-Württemberg an. Sein Interesse galt nicht nur Baden-Württemberg und Luftbildern, sondern auch vielen Ländern Europas und in Übersee. Besonders nach seiner Pensionierung wurden ihm lange Reisen möglich.
In seiner Jugend hatte ihm sein Patenonkel das Buch "Im australischen Busch" von Richard Semon geschenkt. Dieses Buch weckte sein Interesse für diesen Kontinent. Die Worte "kein anderer Erdteil ist von deutschen Reisenden so stiefmütterlich behandelt worden, wie Australien" im Vorwort waren besonders geeignet, sein Interesse zu steigern. So plante er für die Zeit nach der Pensionierung vor allem Reisen nach Australien. Es wurden drei Reisen, mit einer Gesamtdauer des Aufenthalts von sieben Monaten. er habe den ganzen Kontinent mit seiner Frau so gründlich kreuz und quer und drum herum bereist, wie wohl nur wenige andere Reisende.
Über seine Reisen durch Baden-Württemberg und durch viele Staaten dieser Erde hat er zahlreiche Artikel geschrieben und noch mehr Vorträge mit Lichtbildern gehalten. Artikel und Vorträge scheinen geeignet, einen Eindruck des gegenwärtigen Geschehens in der Landschaft und der daraus erwachsenden Gefahren zu zeigen. Seine schriftlichen Arbeiten und die Texte seiner Vorträge gehören somit auch zu der Sammlung.
Dia-Sammlung
1. Umfang, Hauptbetreffe:
Die Sammlung umfaßt nach einer Aufstellung von Dr. Kirschfeld vom 29. Juni 1982 18 280 Dias. 6 650 Dias betreffen Baden-Württemberg (Positionen 1, 2, 3, 5 der Aufstellung) und sind regional gegliedert (nach Regierungsbezirken, innerhalb dieser nach naturräumlichen Einheiten). 2 580 Dias sind nach Sachgebieten gegliedert und zeigen sowohl Motive aus Baden-Württemberg wie aus anderen Teilen Deutschlands und Mitteleuropas (Positionen 4 und 6). 9 050 Dias sind das Ergebnis von Reisen (Position 7) in Europa und in Übersee (eine Weltumrundung zu Schiff, drei Reisen nach Australien, weitere nach Neuseeland, Ostasien, USA, Südafrika, Türkei).
2. Art der Bilder (Luft-, Erdbilder):
Die Abteilung Baden-Württemberg enthält zu zwei Dritteln Luftbilder (4 300 Stück), zu einem Drittel Erdbilder (2 350 Stück}, die übrigen Abteilungen beschränken sich auf Erdbilder. Die Luftbilder sind in der Regel bereits freigegeben. In Ausnahmefällen ist dies jedoch noch zu erwirken.
3. Formate, Erhaltungszustand, Erschließung:
Als Formate begegnen nebeneinander 6 x 6 cm (gerahmt 7 x 7 cm, vor allem Luftbilder aus Baden-Württemberg) wie auch 24 x 36 mm(gerahmt 5 x 5 cm, die Reisen nur in diesem Format). Die Qualität der Farben hat da und dort bereits nachgelassen. Alle Bilder sind gerahmt, beschriftet und signiert, außerdem einzeln in Listen verzeichnet (auf Blättern in Leitzordner die Luftbilder 7 x 7 cm aus Baden-Württemberg, auf kleinen Karteikärtchen die übrigen Aufnahmen). Maßgebend für die Klassifikation der Bilder sind bei den Aufnahmen aus Baden-Württemberg arabische Ziffern nach dem Dezimalsystem (1 bis 4 für die vier Regierungsbezirke; 11 bis 14, 21 bis 24, 31 und 32, 41 bis 44 für die gewählten Einheiten innerhalb der Regierungsbezirke), bei Sachgebieten und Reisen Großbuchstaben oder Buchstabenkombinationen (W = Weltreise, Fr = Frankreich). Die Signaturen bestehen jeweils aus einer solchen Notation und der laufenden Nummer des Bildes innerhalb der durch die Notation bestimmten Gruppen. Hinzu kommt bei den Luftbildern die Nummer der einschlägigen Topographischen Karte 1: 50 000 sowie die Freigabenummer des Regierungspräsidiums Tübingen (von Ausnahmen abgesehen). 5. Möglichkeiten der Auswertung:
Die Dia-Sammlung diente als Grundlage einer ausgedehnten Vortragstätigkeit. Über Australien hat Dr. Kirschfeld im Laufe der Jahre rund 150mal gesprochen. In Bezug auf Baden-Württemberg ist eines der Hauptthemen, die er in seinen Vorträgen behandelte, der fortschreitende Verbrauch an Wald und Feld für Bauvorhaben aller Art (Wohnsiedlungen, Gewerbegebiete, wissenschaftliche Einrichtungen, Kernkraftwerke, Kläranlagen, Wasserwerke wie Stauseen, Pumpstationen, Flußregulierun gen, schließlich Straßenbauten, dabei auch Versuchsstrecken, z.B. bei Boxberg). Zahlreiche Motive wurden in kürzeren und längeren Abständen mehrmals aufgenommen. Die Bilder spiegeln daher die Entwicklung und ermöglichen Vergleiche zwischen früherem und späterem Stand.
Übersicht über die Luftbild- und Diasammlung Dr. Paul Kirschfeld
1. Luftbildsammlung Baden-Württemberg 3100 Dias (Format 7x7 cm)
2. Luftbildsammlung Baden-Württemberg 1200 Dias (Format 5x5 cm)
3. Erdbilder Baden-Württemberg 750 Dias (Format 7x7 cm)
4. Dias verschiedener Sachgebiete 480 Dias (Format 7x7 cm)
5a Erdbilder aus Baden-Württemberg 1100 Dias (Format 5x5 cm)
5b Erdbilder Tübingen 500 Dias (Format 5x5 cm)
6. Dias verschiedener Sachgebiete 2100 Dias (Format 5x5 cm)
7a Reisen in Europa, Ostasien, Türkei 4400 Dias (Format 5x5 cm)
7b Reisen nach Australien, Neuseeland
USA, Südafrika 4650 Dias (Format 5x5 cm)
Gesamt 18 280 Dias
- Reference number of holding
-
Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, J 315
- Context
-
Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart (Archivtektonik) >> Sammlungen >> Bildsammlungen
- Other object pages
- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs
- Rights
-
Es gelten die Nutzungsbedingungen des Landesarchivs Baden-Württemberg.
- Last update
-
13.11.2025, 2:39 PM CET
Data provider
Landesarchiv Baden-Württemberg. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Bestand