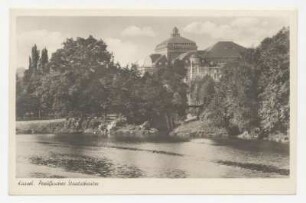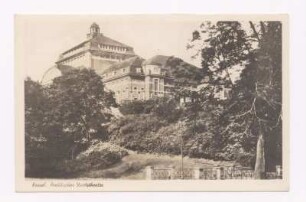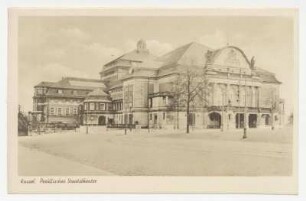Bestand
A Rep. 167 (Noten) Königliche Schauspiele/Preußische Staatstheater (Bestand)
Vorwort: A Rep. 167 Königliche Schauspiele/Preußische Staatstheater
1. Geschichte des Opernhauses
"Fridericus Rex Apollini et Musis". So lautet die Inschrift am Portikus der von König Friedrich II. Apollo und den Musen gewidmeten Königlichen Hofoper. Apollon, dem Gott der Künste, insbesondere der Musik, der Dichtkunst und des Gesangs und den Musen, den Schutzgöttinnen der Künste.
Kurz nach seiner Thronbesteigung am 31. Mai 1740 verwirklicht sich der kunstsinnige junge König einen Jugendtraum und lässt nach Plänen von Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff das Königliche Opernhaus errichten. Am 22. Juli 1741 erfolgt der erste Spatenstich, am 5. September 1741 die Grundsteinlegung, die letzten Bauarbeiten können erst 1743 ausgeführt werden. Das Haus gilt als erstes frei stehendes Theatergebäude. Der Musentempel wird noch vor der endgültigen Fertigstellung bei heftigem Schneegestöber am 7. Dezember 1742, es ist ein Freitag, mit der Uraufführung der Oper "Cleopatra e Cesare" von Carl Heinrich Graun, dem ersten preußischen Hofkapellmeister, eröffnet. Unter der Leitung des Komponisten erklingen die Stimmen der Sängerinnen und Sänger Giovanna Gasparini, Stefano Leonardi, Benedetta Emilia Molteni, Giovanni Triulzi, Anna Lorio Campolungo, Antonio Uberi (Porporino), Gaetano Pinetti, Paolo Bedeschi (Paulino) und Ferdinando Mazzanti. Das Orchester besteht aus der aufgestockten Rheinsberger Kapelle.
Das Opernhaus ist als Mehrzweckgebäude konzipiert. Opernaufführungen finden nur während der drei Wintermonate, dem sogenannten Karneval, zweimal in der Woche statt. Ansonsten werden die Räumlichkeiten für Hoffeste, Redouten, Aufführungen französischer Komödianten oder auch für Proben genutzt.
In den Jahren 1756 bis 1763, während des Siebenjährigen Krieges, wird das Opernhaus geschlossen.
1760 kommt es zur Beschädigung des Daches durch eine russische Kanonenkugel. Kulissenteile werden dadurch erheblich in Mitleidenschaft gezogen.
1781 besucht Friedrich II., fünf Jahre vor seinem Tod, zum letzten Mal die Hofoper. Da das Haus nicht mehr den gewachsenen Anforderungen entspricht, entschließt sich der neue König, Friedrich Wilhelm II., das Opernhaus erneuern zu lassen. 1786 erfolgt der Umbau nach Plänen von Carl Gotthard Langhans, dem späteren Architekten des Brandenburger Tores.
Am 11. Januar 1788 findet die Eröffnung des Hauses mit der Uraufführung der Oper "Andromeda" von Johann Friedrich Reichardt statt.
Unter der Leitung von Generaldirektor August Wilhelm Iffland vereinen sich 1811 die Hofoper und das Nationaltheater zu den Königlichen Schauspielen. Diesen Namen behalten sie bis 1918 bei.
In der Nacht vom 18. zum 19. August 1843 gerät, vermutlich bei einem Gewehrfeuer in dem Ballett "Der Schweizersoldat", ein glimmender Gewehrpfropfen in einen Haufen Kleider und entzündet diese. Das Opernhaus brennt bis auf die Grundmauern nieder.
Der Neubau, nach den Plänen von Carl Ferdinand Langhans, wird am 7. Dezember 1844 mit der Oper "Ein Feldlager in Schlesien" von Giacomo Meyerbeer wiedereröffnet.
In den Jahren 1882 bis 1910 kommt es zu einigen baulichen Veränderungen. Unter anderem werden der "Eiserne Vorhang" sowie Nottreppen und der Bühnenturm eingebaut, das Haus erhält eine elektrische Beleuchtung. Während der Baumaßnahmen wird es zeitweilig geschlossen.
1918 erfolgt die Umbenennung des "Königlichen Opernhauses" in "Opernhaus Unter den Linden", aus der "Königlicher Kapelle" wird die "Kapelle der Staatsoper", und das "Königliche Schauspielhaus" erhält den Namen "Schauspielhaus am Gendarmenmarkt". Opernhaus und Schauspielhaus werden dem Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung unterstellt. Richard Strauss und Oberregisseur Georg Droescher übernehmen die Leitung. 1919 wählt man Max von Schillings zum neuen Intendanten. Als Intendant des Schauspielhauses fungiert Leopold Jessner.
Jedes Haus hat einen eigenen selbständigen Direktor, dem ein Beamter für Verwaltungsfragen zugeordnet wird. Der Regisseur Franz Ludwig Hörth und Erich Kleiber teilen sich die Intendanzgeschäfte, Otto Klemperer wird Direktor der Oper am Königsplatz, Hörth Operndirektor und beide Häuser gelangen, zusammen mit den Häusern in Kassel und Wiesbaden, unter die Generalintendanz von Heinz Tietjen.
1924 entfernt man die störenden Rettungsgalerien und die "Oper am Königsplatz" wird der Staatsoper als zweites Haus angeschlossen. Das Ensemble muss nun beide Häuser bespielen.
Eine der legendärsten Vorstellungen findet am 14. Dezember 1925 statt. Unter dem Dirigat von Erich Kleiber, der Regie von Franz Ludwig Hörth und der Ausstattung von Panos Aravantinos wird die Oper "Wozzeck" von Alban Berg Unter den Linden uraufgeführt.
1925 beruft man Heinz Tietjen zum Leiter der Städtischen Oper und der Staatsoper und 1928 zum Generalintendanten der Linden- und Krolloper.
1926 erfolgt ein völliger Umbau der Staatsoper, Ausweichspielstätten sind in dieser Zeit die Krolloper und das Schauspielhaus.
Die neugegründete Krolloper eröffnete am 19. November 1927 ihren Spielbetrieb.
Am 28. April 1928 wird die Staatsoper nach dem Umbau mit Wolfgang Amadeus Mozarts "Die Zauberflöte" wiedereröffnet, am Pult Erich Kleiber.
Viele namhafte jüdische Ensemblemitglieder müssen das Haus nach 1933 verlassen, sie erhalten, bis auf einige Ausnahmen, am 1. Juni 1933 für den Schluss der Spielzeit ihre Kündigung.
Am 10. Mai 1933 werden auf dem Opernplatz öffentlich zehntausende Bücher von jüdischen, marxistischen und pazifistischen Schriftstellern verbrannt.
Auf Beschluss des Preußischen Staatsministeriums vom 18. Januar 1934 überantwortet sich Hermann Göring, Preußischer Ministerpräsident von 1933 bis 1945, die Verwaltung und Leitung der Preußischen Staatstheater.
In der hellen Mondnacht vom 9. zum 10. April 1941 werfen englische Bomber ihre Spreng- und Brandbomben vor allem im Zentrum Berlins ab. Dazu heißt es:
"Unter den Linden 7 (Staatsoper), von einer größeren Anzahl Brandbomben getroffen. Theatergebäude ausgebrannt. Bühnenhaus stark in Mitleidenschaft gezogen. Schwerer Sachschaden entstanden. Feuer von Feuerschutzpolizei gelöscht. Auf dem Platz westlich der Oper 30 Brandbomben abgelöscht. 1 Toter (rauchvergiftet), Theaterwart. 1 Verletzter (rauchvergiftet) im Krankenhaus eingeliefert" (LAB A Rep. 001-02, Nr. 698).
Innerhalb von nur einem Jahr und acht Monaten werden die Schäden behoben und das Haus am 12. Dezember 1942 mit Richard Wagners "Die Meistersinger von Nürnberg" unter Wilhelm Furtwängler neu eröffnet.
Die letzte Premiere in der Lindenoper vor dem Ende des II. Weltkrieges findet am 7. Juni 1944 statt. "Andreasnacht" (Bruder Lustig), eine Oper von Siegfried Wagner unter der musikalischen Leitung von Johannes Schüler gelangt zur Aufführung.
Am 1. September 1944 tritt die Verfügung des Reichsbevollmächtigten für den totalen Kriegseinsatz, Joseph Goebbels, vom 24. August 1944 in Kraft, die den "Totalen Kriegseinsatz der Kulturschaffenden" anordnet. Das bedeutete die Schließung fast aller deutschen und österreichischen Theater.
Dann das Inferno: "Starke amerikanische Jagd- und Bomberverbände unternahmen in den Vormit-tagsstunden des 3. Februar 1945 bei klarem Himmel einen Angriff auf die Reichshauptstadt. Etwa 700-800 Maschinen überflogen in 4 Wellen das Stadtgebiet und warfen, zumeist in dichter Massierung, eine große Anzahl von Spreng- und Brandbomben ab. Nach den bisherigen Feststellungen sind etwa 4 000 Sprengbomben, 150 000 Stabbrandbomben, 500 Flüssigkeitsbomben niedergegangen. Der Schwerpunkt des Angriffs lag innerhalb des Stadtbahnringes. Am schwersten betroffen wurden die Bezirke Kreuzberg, Mitte, Horst Wessel, Wedding." (LAB A Rep. 001-02, Nr. 703)
So steht es nüchtern im Bericht der Hauptluftschutzstelle der Stadtverwaltung Berlin. 791 Tote, 388 Verwundete, 339 Vermißte, 27. 071 Obdachlose allein im Stadtbezirk Mitte.
Und: Die Lindenoper war in Schutt und Asche versunken.
Geschichte des Schauspielhauses
(Französisches Komödienhaus, Nationaltheater, Schauspielhaus)
Französisches Komödienhaus
1774 bis 1776 - Nach Plänen von Johann Boumann wird das "Französische Komödienhaus" auf dem Gendarmenmarkt erbaut. Der König unterhält es als Hoftheater.
22. April 1776 - Eröffnung, Eine Truppe französischer Schauspieler bringt Singspiele und Ballette zur Aufführung.
1778 - Die Schauspieler werden vom König entlassen.
1778 bis 1786 - Das Haus steht leer, dient zeitweise als Lagerraum einer Pfropfenfabrik.
5. Dezember 1786 Wiedereröffnung nach Renovierung als "Nationaltheater". Die Schauspielertruppe von Karl Theophil Döbbelin bespielt das Haus. Opern, Schauspiele oder Ballett werden gegeben.
1. August 1787 - Umbenennung in "Königliches Nationaltheater".
1787 - Berufung einer Generaldirektion (von Beyer, Johann Jacob Engel, Karl Wilhelm Ramler).
19. Mai 1789 - Wolfgang Amadeus Mozart besucht eine Aufführung seiner Oper "Die Entführung aus dem Serail".
1796 - Auseinanderbrechen der Generaldirektion.
18. Oktober 1796 - August Wilhelm Iffland wird Direktor des Königlichen Nationaltheaters.
Nationaltheater
1. Januar 1802 - Einweihung des Neubaus von Carl Gotthard Langhans, genannt der "Koffer", mit dem Stück "Die Kreuzfahrer" von August von Kotzebue.
1804 - Friedrich von Schiller besucht mehrere Aufführungen.
18. Juni 1811 - August Wilhelm Iffland wird Generaldirektor der Königlichen Schauspiele, zu denen bis 1918 neben dem Schauspielhaus auch die Lindenoper gehört.
3. August 1816 - Uraufführung der Oper "Undine" von Ernst Theodor Amadeus Hoffmann mit dem Bühnenbild von Karl Friedrich Schinkel.
29. Juli 1817 - Brand und Zerstörung des Gebäudes.
19. November 1817 - Auftrag zum Neubau.
1818 - Karl Friedrich Schinkel legt Entwürfe vor.
Schauspielhaus
26. Mai 1821 - Einweihung des Schauspielhauses (Königliches Schauspielhaus). Gespielt wird "Iphigenie" von Johann Wolfgang von Goethe.
18. Juni 1821 - Uraufführung der Oper "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber unter der Leitung des Komponisten.
27. November 1826 - Berliner Erstaufführung der Sinfonie Nr. 9 von Ludwig van Beethoven. Dirigiert wird das Konzert von Carl Moeser, Solisten sind Fräulein Carl, Frau Türrschmidt, Carl Adam Bader, Eduard Devrient.
4. März 1829 - Gastspiel des Violinvirtuosen Niccolo Paganini.
15. Mai 1838 - Berliner Erstaufführung von "Faust" I von Johann Wolfgang von Goethe.
13. April 1842 - Felix Mendelssohn Bartholdy dirigiert seine Schauspielmusik zu "Antigone".
18. Januar 1843 - Gastspiel Franz Liszts.
7. Januar 1844 - Richard Wagner dirigiert die Berliner Erstaufführung seiner Oper "Der fliegende Holländer".
1847 und 1848 - Die "Schwedische Nachtigall", Jenny Lind, gibt Konzerte.
1848 - Truppen des General Friedrich von Wrangel besetzen das Schauspielhaus, in dem die Nationalversammlung Preußens tagt.
1870 bis 1894 - Theodor Fontane schreibt Kritiken zu Premieren und Gastspielen.
1919 - Umbenennung in Staatstheater (Preußische Staatstheater).
1919 bis 1930 - Leopold Jessner ist Intendant des Staatlichen Schauspielhauses in Berlin bzw. Generalintendant der Schauspielbühnen des Staatstheaters Berlin.
1923 bis 1932 - Das Schillertheater in Berlin-Charlottenburg gehört bis zu seiner Reprivatisierung zu den Preußischen Staatstheatern.
1933 - Franz Ulbrich wird Intendant.
1934 bis 1945 - Am 26. Februar 1934 Berufung von Gustaf Gründgens zum Intendanten des Theaters am Gendarmenmarkt und 1937 zum Generalintendanten aller preußischen Staatstheater.
15. November 1941 - Uraufführung von Gerhart Hauptmanns "Iphigenie in Delphi".
29. Juli 1944 - "Die Räuber" von Friedrich von Schiller ist die letzte Vorstellung vor der Schließung.
22. April 1945 - Letzter Konzertabend vor der Zerstörung. Es finden Opern-Abende und Kammerkunst-Veranstaltungen statt.
Geschichte der Krolloper
(Krolls Etablissement, Krolls Theater, Neues Operntheater, Neues Königliches Opern-Theater, Krolloper, Oper am Königsplatz, Oper am Platz der Republik)
1842 - König Friedrich Wilhelm IV. stellt dem Breslauer Restaurateur zur "Errichtung eines Wintergartens für das gebildete Publikum" ein Grundstück zur Verfügung. Nach den Plänen der Architekten Ludwig Persius und Carl Ferdinand Langhans wird das Gebäude errichtet. Eduard Knoblauch führt den Bau aus.
15. Februar 1844 - Eröffnung als "Krolls Etablissement". Auguste Kroll erbittet eine Theaterkonzession und das Haus erhält eine Sommerbühne. Der Architekt Eduard Titz schafft "eine zierliche Kunststätte aus Holz". Lustspiele, Possen und sogar Opern werden gegeben.
1. Februar 1851 - Ein Brand vernichtet das Gebäude. Es wird innerhalb eines Jahres wieder aufgebaut, wiederum durch Eduard Titz.
8. Juni 1851 - Erstes Galakonzert nach dem Brand.
1855 - Schließung des Hauses aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten.
12. Mai 1855 - Nach baulichen Veränderungen öffnet es wieder.
1862 - Zwangsversteigerung und Wiedereröffnung. Im Winter werden Schwänke und Possen gegeben, im Sommer bespielt ein eigens zusammengestelltes Opernensemble, die Sommeroper, die Bühne. Sinfonie- und Militärkonzerte folgen.
1894 - Der Brauereibesitzer Julius Bötzow übernimmt das Etablissement. Er betreibt darin eine Restauration und bietet zusätzlich Konzertveranstaltungen an.
1895 - Wirtschaftliche Probleme zwingen Bötzow, mit den Königlichen Schauspielen einen Vertrag einzugehen, der es diesen ermöglicht, das Haus als Ausweichspielstätte zu nutzen. Anschluss von "Krolls Theater" als Zweitbetrieb der Lindenoper. Somit bespielte das Ensemble also zwei Häuser.
1. August 1895 - Zur Eröffnung wird die Oper "Die lustigen Weiber von Windsor" von Otto Nicolai gegeben.
11. April 1896 - Bötzow überlässt die Räumlichkeiten und das Inventar der preußischen Staatskasse.
Das nun staatliche Theater wird unter der Generalintendanz der Königlichen Schauspiele umgebaut und als "Krolls Theater", "Neues Operntheater" und später "Neues Königliches Opern-Theater geführt".
In den Wintermonaten kann das Haus von Gesellschaften und Theaterensembles gepachtet werden.
30. März 1914 - Letze Vorstellung vor dem geplanten Abriss. Nach dem Ausbruch des I. Weltkrieges ruhen die Abrissarbeiten. Das Geld fehlt.
1920 - Die Gesellschaft der "Volksbühne am Bülowplatz" schließt einen Vertrag über die Verpachtung des Grundstücks mit dem preußischen Staat, in dem sie sich verpflichtet, die Bauarbeiten bis zum Umbau zu einem Volksopernhaus weiterzuführen. Da die finanziellen Mittel wiederum nicht ausreichten, bittet man das Finanz- und Kultusministerium um Unterstützung. Im Gegenzug erhält die Volksbühne 25 Jahre die Hälfte der Karten für jede Vorstellung, um sie kostengünstig an eigene Mitglieder abgeben zu können.
1922 - Gründung der Kroll-Wirtschaftsbetrieb GmbH.
1. Januar 1924 - Wiedereröffnung der Oper am Königsplatz mit "Die Meistersinger von Nürnberg" unter Erich Kleiber. Anschluss der Oper als zweites Haus der Staatsoper. Das Ensemble muss also zwei Häuser bespielen.
1925 - Heinz Tietjen wird zum Leiter der Städtischen Oper und der Staatsoper und 1928 zum Generalintendanten der Linden- und Krolloper berufen. Otto Klemperer und später Ernst Legal fungieren als Operndirektoren.
1926 - Die Staatsoper wird völlig umgebaut, Ausweichspielstätten sind in dieser Zeit die Krolloper und das Schauspielhaus.
1926 - Umbenennung der Krolloper in "Oper am Platz der Republik".
19. November 1927 - Die neugegründete "Oper am Platz der Republik" eröffnet ihren Spielbetrieb mit der Oper "Fidelio" unter Otto Klemperer. Sie bekommt als Alternative zur Lindenoper eine eigene künstlerische Leitung, bleibt finanziell aber der Generalintendanz der Lindenoper unterstellt.
3. Juli 1931 - Letzte Vorstellung ist Wolfgang Amadeus Mozarts "Die Hochzeit des Figaro" unter Fritz Zweig.
1933 - Nach dem Reichstagsbrand finden die Sitzungen des Reichtages in der Kroll-Oper statt.
1. September 1939 - Adolf Hitler ruft am 1. September 1939 den Beginn des II. Weltkrieges aus.
1941 bis 1942 - Dient nach der Zerstörung der Staatsoper wieder als deren Ausweichspielstätte.
26. April 1942 - Der Reichstag tagt hier ein letztes Mal.
1943 - Zerstörung nach einem Bombenangriff.
1957 - Endgültige Beräumung des Geländes.
Geschichte des Schiller-Theaters
1894 - Gründung der Schiller Theater AG. Als Spielorte des Schiller-Theaters Ost und des Schiller-Theaters Nord wird das Wallner-Theater sowie das Woltersdorff-Theater genutzt.
1905 bis 1906 - Bau des eigenen Hauses nach Plänen des Münchener Theaterarchitekten Max Littmann (Schiller-Theater AG und die Stadt Charlottenburg).
1. Januar 1907 - Eröffnung mit "Die Räuber" von Friedrich von Schiller. Das Theater wird von der Schiller Theater AG unter dem Direktor Raphael Löwenfeld mit einem eigenen Ensemble betrieben.
1921 bis 1932 - Zweite Spielstätte des Preußischen Staatstheaters Berlin.
Mai 1933 - Als Preußisches Theater der Jugend im Verbund der Preußischen Staatstheater dem Ministerpräsidenten Hermann Göring unterstellt.
Dezember 1933 - In den Besitz der Stadt Berlin überführt.
1937 bis 1938 - Umbau des Hauses.
1938 - Wiedereröffnung als Schiller-Theater der Reichshauptstadt unter dem Intendanten Heinrich George mit "Kabale und Liebe" von Friedrich von Schiller.
1943 - Zerstörung durch Brandbomben.
2. Bestandsgeschichte
Nach Kriegsende gelangten noch erhaltene Akten und Materialien aus der Arbeit der Königlichen Schauspiele (Opernhaus, Schauspielhaus, Schiller-Theater, Krolloper) und Unterlagen des
Theatermuseums Berlin in die Staatsoper. In den 1950er Jahren wurden zahlreiche Akten an
das Deutsche Zentralarchiv in Merseburg abgegeben. Schließlich betraute man den Dramaturgen, Spielleiter und Journalisten Erdmann H. Treitschke mit der Aufgabe, sich des Archivs anzunehmen. Später waren drei Mitarbeiter für die Unterlagen zuständig.
1993-95 wurde gemäß den Bestimmungen des Archivgesetzes des Landes Berlin und mit
Zustimmung der damaligen Senatsverwaltung für kulturelle Angelegenheiten die Entscheidung getroffen, das Archiv aufzulösen. Man einigte sich darauf, die Bühnenbild- und Kostümentwürfe sowie alle anderen bildlichen Darstellungen künstlerischen Inhalts dem Berlin Museum zu überlassen. Dazu gehörte auch die umfangreiche Fotosammlung. Personalakten, Lohn- und Gehaltsunterlagen sowie Bücher verblieben in der Staatsoper. Die Altakten des Verwaltungsarchivs die älter als 7 Jahre waren, Besetzungszettel, Programmhefte, Noten, Textbücher, archivalische Überlieferungen anderer Theater etc. gingen an das Landesarchiv Berlin.
Später wurden z.B. Personalunterlagen sowie der umfangreiche Aktenbestand des Stellvertretenden Intendanten für Ökonomie, Planung und Technik an das Landesarchiv abgegeben.
So sind die erhaltenen Archivalien der Königlichen Schauspiele/Preußische Staatstheater und der Deutschen Staatsoper Berlin auf verschiedene Orte in der Stadt verteilt (Staatsoper Unter den Linden, Landesarchiv Berlin, Stadtmuseum Berlin, Geheimes Staatsarchiv Preußischer
Kulturbesitz).
Aufgrund der Generalintendanz der Königlichen Schauspiele, später Preußische Staatstheater, befinden sich im Bestand zahlreiche Unterlagen sowohl zum Schauspielhaus als auch zur Kroll-Oper und zum Schillertheater.
Auch Dokumente aus Nachlässen sind Bestandteil der Überlieferung (z. B. Wilhelm Taubert, Walther Pittschau).
Verschiedenes Sammlungsgut des Theatermuseums Berlin, dessen Direktor ab 1939 Rolf Badenhausen war, befindet sich im Bestand. So ist zu erklären, dass eine umfangreiche Theaterzettelsammlung Berliner, aber auch Österreichischer Bühnen darin enthalten ist. Auch die Sammlung von Unterlagen verschiedener Kriegsgefangenentheater aus dem I. Weltkrieg dürfte ihren Ursprung im Theatermuseum haben.
"Iffland-Akten"
Im Jahre 2014 übernahm das Landesarchiv Berlin 34 erhaltende Bände mit rund 7.000 Schriftstücken des künstlerischen und administrativen "Archivs" von August Wilhelm Iffland (1759 bis 1814), durch die ein tiefgehender Einblick in seine Arbeit möglich wird. Die Akten wurden in die Repositur A Rep. 167 eingegliedert und in den letzten beiden Jahren vollständig digitalisiert. Zurzeit werden sie konservatorisch und restauratorisch bearbeitet.
In enger Zusammenarbeit mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften konnte ein Projekt zur formalen und inhaltlichen Erschließung mit Einbindung der Digitalisate in eine Webpräsentation entwickelt werden. Die Ergebnisse dieses Projekts werden nach und nach auf der Webseite der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften zur Verfügung gestellt.
Auf der Internetseite des Landesarchivs Berlin kann über die entsprechenden Links durch die auf-bereiteten Akten geblättert werden.
Im Bestand A Rep. 167 befinden sich u.a.: Akten der Intendanz (u.a. Schriftwechsel Iffland, Verwaltung, Finanzen, Angebote von Kompositionen und Libretti).- Textbücher.- Zeitschriften.- Besetzungslisten.- Rezensionen/Zeitungsausschnitte.- Besetzungszettel.- Programmhefte.- Kontrollbücher.
Der Bestand A Rep. 167 ist vollständig erschlossen und umfasst ca. 7695 Akten (97,5 lfm, ohne die "Iffland-Akten"), die den Zeitraum von 1758 bis 1945 dokumentieren. Einzelne Archivalien datieren bis 1703 zurück bzw. reichen bis in das Jahr 1960. Es erfolgte keinerlei Kassation von Unterlagen.
Benutzung
Die Benutzung ist mittels Findbuch und Datenbank möglich.
Ein Teil der Theaterzettel wurde verfilmt.
Einige Akten sind auf Grund archivgesetzlicher Bestimmungen bzw. EU-Datenschutz-Grundverordnung für die Benutzung befristet gesperrt (z. B. Honorarangelegenheiten, Angaben zur Religion etc.). Eine Verkürzung der Schutzfristen kann auf Antrag erfolgen. Dazu bedarf es der besonderen Zustimmung des Landesarchivs Berlin. Im Bestand befinden sich Unterlagen die dem Urheberrecht unterliegen wie z. B. Fotos.
Der Bestand ist wie folgt zu zitieren:
Landesarchiv Berlin (LAB) A Rep. 167 Königliche Schauspiele/Preußische Staatstheater, Nr. xxxx
3. Korrespondierende Bestände
LAB A Rep. 167 (Noten) Königliche Schauspiele/Preußische Staatstheater
LAB A Rep. 167 (Porträts) Königliche Schauspiele/Preußische Staatstheater
LAB C Rep. 167 Deutsche Staatsoper
LAB C Rep. 904-093 Grundorganisation der SED - Deutsche Staatsoper
LAB D Rep. 871 Staatsoper Unter den Linden (1990-)
Sammlung von Glasplattennegativen (unverzeichnet)
Sammlung von Schriftplakaten (unverzeichnet)
4. Literatur- und Quellenverzeichnis
BERLIN STAATSOPER UNTER DEN LINDEN (Hrsg): Diese kostbaren Augenblicke - 275 Jahre Staatsoper Unter den Linden, Hanser, Carl, Verlag GmbH & Co. KG, 12/2017
FETTING, HUGO: Die Geschichte der Deutschen Staatsoper, Veröffentlichung der Deutschen Akademie der Künste, Henschelverlag Berlin, 1955
KAPP, JULIUS: Geschichte der Staatsoper, Hesses Verlag Berlin, 1937
OTTO, WERNER: Die Lindenoper - Ein Streifzug durch ihre Geschichte, Henschelverlag Berlin, 1980
QUANDER, GEORG (Hrsg): Apollini et Musis - 250 Jahre Opernhaus Unter den Linden, Frank-furt/M.; Berlin: Propyläen, 1992
RÖSLER, WALTER; HAEDLER, MANFRED; MARCARD, MICAELA VON: Das Zauberschloß Unter den Linden: die Berliner Staatsoper; Geschichte und Geschichten von den Anfängen bis heute, Berlin - Edition q, 1997
Berlin, Februar 2019 Annette Thomas
- Reference number of holding
-
A Rep. 167 (Noten)
- Context
-
Landesarchiv Berlin (Archivtektonik) >> A Bestände vor 1945 >> A 4 Preußische und Reichsbehörden mit regionaler Zuständigkeit >> A 4.1 Preußische Behörden >> A Rep. 167 Königliche Schauspiele/Preußische Staatstheater
- Related materials
-
Verwandte Verzeichnungseinheiten: LAB A Rep. 167 (Noten) - Königliche Schauspiele/Preußische Staatstheater
LAB A Rep. 167 (Portraits) - Königliche Schauspiele/Preußische Staatstheater
LAB C Rep. 167 Deutsche Staatsoper
LAB C Rep. 904-093 Grundorganisation der SED - Deutsche Staatsoper
LAB D Rep. 871 Staatsoper Unter den Linden
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Stiftung Stadtmuseum Berlin
- Other object pages
- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs
- Rights
-
Für nähere Informationen zu Nutzungs- und Verwertungsrechten kontaktieren Sie bitte info@landesarchiv.berlin.de.
- Last update
-
22.08.2025, 11:21 AM CEST
Data provider
Landesarchiv Berlin. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Bestand