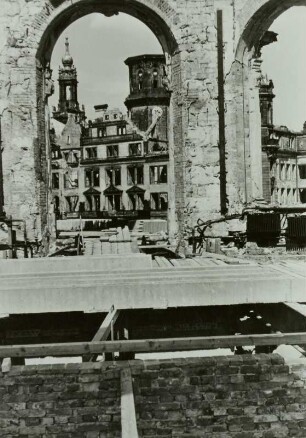Ruine
künstliche neogotische Schloßruine; Berlin, Steglitz-Zehlendorf
An der Südwestseite der Pfaueninsel wendet sich das Schloss mit seiner Schaufront zum Wasser. Der Standort war so bestimmt, dass von einem vom Potsdamer Marmorpalais kommenden Boot die markante, leuchtend weiße Doppelturmfassade bereits aus der Ferne als verlockendes Ziel erkennbar war. Im Näherkommen erweist sich das Gebäude als Ruine. Einem Turm fehlt die Kuppel, am zweigeschossigen Mitteltrakt deuten abgebrochene Steine an den Fensteröffnungen auf verlorene Stockwerke, die durch eine Brücke zwischen den Türmen ersetzt sind. Unmittelbar vor dem Schloss offenbart sich jedoch die Täuschung. Die Ruine ist eine künstliche Ruine; die aus großen Steinquadern gemauerten Wände sind aus Holz, die Fugen aufgemalt; auch die Landschaft im Torbogen mit Fallgitter erkennt man nun als illusionistisches Gemälde.° Nach den Vorbildern italienischer Landschaftsveduten und englischer Parkarchitekturen, die durch Stichwerke auch in Preußen bekannt waren, wurde das damals als "königliches Landhaus" bezeichnete Schloss 1794-95 von Johann Gottlieb Brendel für Friedrich Wilhelm II. und seine Mätresse Wilhelmine Encke errichtet. (1) Der kubische zweigeschossige Baukörper, dem an seinen westlichen Ecken zwei Rundtürme angefügt sind, ist als Fachwerkbau mit Ziegelausfachung und einer Verkleidung aus Eichenbohlen ausgeführt; hinter den Resten der scheinbar ruinösen Stockwerke verbirgt sich ein flaches Zeltdach. Die mit sandhaltiger Ölfarbe gestrichenen Fassaden sind durch schlichte Rundbogenfenster sowie eine schmale Tür an der Südseite gegliedert. (2) Die höheren Fenster am Obergeschoss entsprechen der größeren Raumhöhe und kennzeichnen es als Beletage für die königlichen Wohnräume; sie werden über eine Wendeltreppe im Südturm erschlossen. Der nördliche Turm birgt im Erdgeschoss das so genannte Otaheitische Kabinett, im Obergeschoss das Arbeitszimmer des Königs. Die bauzeitliche Holzbrücke zwischen den Türmen wurde 1806-07 durch die heutige Eisenbrücke in gotischen Formen ersetzt. Vom massiv gemauerten Keller führt ein unterirdischer Gang zum Havelufer; er ermöglichte einst den direkten Zugang zum Wasser. (3)° Äußere Gestaltung und Konstruktion des Schlosses sind geprägt durch seine Funktion als malerischer Kulissenbau für den Landschaftspark wie auch als Lustschloss und Ziel sommerlicher Vergnügungsfahrten. Trotz der beinahe provisorisch wirkenden Bauweise war im Inneren für die insgesamt neun größeren Räume großer Wert auf eine außergewöhnliche und kostbare Ausstattung gelegt worden. Diese ist weitgehend unverändert erhalten und dokumentiert in allen Bereichen größtes handwerkliches Können. Bodenbeläge in edlen Hölzern oder schlesischem Marmor, Tapeten aus Papier sowie Wandbespannungen aus bedruckten Stoffen, aufwendige Holzvertäfelungen, Wand- und Deckenmalereien, Kamine, Spiegel, bis hin zu Möbeln und Kronleuchtern aus der Zeit um 1795 befinden sich in einem bemerkenswert guten Erhaltungszustand. (4) Zum materiellen, künstlerischen und historischen Wert der Raumausstattungen tritt beim Otaheitischen Kabinett eine symbolische Bedeutung hinzu. Der runde Raum ist von den Malern Peter Ludwig Lütke und Philippe Burnat an Decke und Wänden als Südsee-Bambushütte mit Palmen und illusionistischen Ausblicken auf eine exotisch verfremdete Havellandschaft ausgemalt. Otaheiti, ursprünglicher Name der in den 1760er Jahren entdeckten Südseeinsel Tahiti, wurde mit Kythera, der mythologischen Liebesinsel der Göttin Aphrodite, gleichgesetzt. (5) In diesem Sinne tritt in der Ausgestaltung des Otaheitischen Kabinetts die Grundidee für die Pfaueninsel als Rückzugsort für das Liebespaar Friedrich Wilhelm II. und Wilhelmine besonders hervor.° _________________° 1) Horvath 1802, S. 47: "Das königliche Landhaus stellet ein altes verfallenes römisches Landhaus vor (.)." Zum Entwurf und seinen Vorbildern siehe auch: Kopisch, August: Die Königlichen Schlösser und Gärten zu Potsdam, Berlin 1854; Wyrwa, Ulrich: Die Pfaueninsel. In: Geschichtslandschaft Berlin 1992, S. 486; Seiler/Koppelkamm 1993, S. 8 ff.° 2) Die Holzverkleidung und das illusionistische Wandbild wurden 1974-75 erneuert, nachdem 1909-11 die Außenwände mit Beton bedeckt worden waren und Schaden genommen hatten. Vgl. Bewahrt, wiederhergestellt, erneuert, Restaurierungsführer durch die preußischen Schlösser, hrsg. v. Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Leipzig 2006, S. 40 f.° 3) Seiler 2010, S. 36. Der Gang wurde zum Wasserholen und als heimlicher Zugang genutzt, nicht, wie oft vermutet, als Zugang zur Küche. Der Gang ist heute zugemauert.° 4) Genaue Beschreibungen der einzelnen Räume und Ausstattungsstücke siehe: Seiler 1993, S. 55 ff.; Seiler/Koppelkamm 1993, S. 8 ff.; Bewahrt, wiederhergestellt, erneuert, Restaurierungsführer durch die preußischen Schlösser, hrsg. v. Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Leipzig 2006, S. 40 f.; Inselwelt 2010, S. 23 ff.; Seiler 2010, S. 29 ff.° 5) Der Franzose Louis-Antoine de Bougainville nahm auf seiner Weltumseglung 1766-69 die Insel Tahiti als "Île de la Nouvelle Cythère" für Frankreich in Besitz. (Vgl. Falckenstein, Karl: Geschichte der geographischen Entdeckungsreisen, Bd. 3, Dresden 1828, S. 146.) Am preußischen Hof war das Motiv der fernen Insel als irdisches Paradies durch das Gemälde "Einschiffung nach Kythera" von Antoine Watteau geläufig; so wurde die Pfaueninsel damals auch als "märkisches Kythera" bezeichnet. Das Gemälde hatte Friedrich II. 1763 erworben. Vgl. Pieper, Jan: Das Arkanum Pfaueninsel. In: Daidalos, 12 (1992), H. 46, S. 79 f. Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau hatte bereits 1783-84 im Wörlitzer Park auf dem Eisenhart einen Südseepavillon für Orginalstücke aus "Otaheiti" erbauen lassen, die er 1775 von den Weltreisenden Johann Reinhold und Georg Forster als Geschenk erhalten hatte. Vater und Sohn Forster hatten Kapitän Cook als Wissenschaftler auf seiner zweiten Südseereise 1772-75 begleitet, anschließend hatte Georg Forster durch Vortragsreisen die Lebenswelt der Südsee in Deutschland bekannt gemacht.°
- Standort
-
Pfaueninselchaussee 100 / Pfaueninsel, Wannsee, Steglitz-Zehlendorf, Berlin
- Verwandtes Objekt und Literatur
- Ereignis
-
Herstellung
- (wer)
-
Entwurf: Brendel, Johann Gottlieb David
Entwurf: Krüger, Friedrich Ludwig Karl
Entwurf: Brendel, Johann Gottlieb David
Bauherr: Friedrich Wilhelm II.
- (wann)
-
1794-1797
- Ereignis
-
Umbau
- (wann)
-
1806-1807
- Ereignis
-
Umbau
- (wann)
-
1807
- Letzte Aktualisierung
-
04.06.2025, 11:55 MESZ
Datenpartner
Landesdenkmalamt Berlin. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Ruine
Beteiligte
- Entwurf: Brendel, Johann Gottlieb David
- Entwurf: Krüger, Friedrich Ludwig Karl
- Bauherr: Friedrich Wilhelm II.
Entstanden
- 1794-1797
- 1806-1807
- 1807