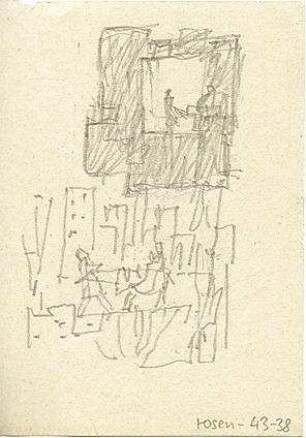Forschungsbericht
Modellprojekt Integrales Wassermanagement : Untersuchungen zur Optimierung der Effekte Einfacher Intensivdachbegrünung auf Gebäude- und Stadtklima, Wasserhaushalt und Vegetationsvielfalt im urbanen Umfeld durch Bewässerung mit aufbereitetem Grauwasser
Zusammenfassung: Die zunehmende Urbanisierung führt zu Veränderungen des lokalen und globalen Wasserhaushalts (DWD 2014A; BMU 2003) mit negativen Auswirkungen auf Mensch und Natur. Mit einem gesteigerten Grad der Versiegelung nimmt der Oberflächenabfluss bei Niederschlagsereignissen zu während sich die Verdunstung und die Versickerung im Verhältnis verringern. Neben den gewässerökologischen Folgen wirken sich diese Veränderungen auch nachteilig auf das Stadtklima aus (MKULNV 2011). Eine reduzierte Verdunstung und Wasserverfügbarkeit in den Böden sowie die erhöhte Wärmeabsorption von Gebäuden und Verkehrsflächen verstärken den Effekt städtischer Hitzeinseln zusehends. Regional und global lassen Klimaprojektionen eine Zunahme von sommerlichen Hitze- und Trockenperioden erwarten mit der Folge kritischer Veränderungen der Vegetations-bedingungen und stadtklimatischer Situationen (DWD 2014B, SEIDEL, A., 2012). Der aus stadtklimatischer Sicht unabdingbaren Erhaltung und Förderung grüngeprägter, unversiegelter Flächen stehen jedoch Nachverdichtungstendenzen mit hoher Ausnutzung der Grundstücke entgegen. In diesem Zusammenhang kann Dachbegrünungen zur Kompensation der Flächen- und Funktionsverluste eine bedeutende Rolle zukommen. Effekte wie die Erhöhung der Biodiversität (OBERNDORFER ET AL. 2007), ein erhöhtes Retentionsvermögen bei Starkniederschlägen, Minderung von Luftverschmutzung (CURRIE, BASS 2008) sowie thermische Isolation von Gebäuden (TAM, WANG, LE 2016) sind hier zu nennen. Für die Gebäudeklimatisierung gibt es umfangreiche Erkenntnisse zum isolierenden und amplitudendämpfenden Effekt von Gründächern. In welchem Umfang eine Bewässerung zu einer aktiven Kühlung des Gebäudes beitragen kann, wurde bislang jedoch nicht untersucht. In Bezug auf die Regenrückhaltefunktion und die Abflussverzögerung sind Dach-begrünungen bereits heute eine wichtige, anerkannte Komponente naturnaher Regenwasserbewirtschaftungskonzepte. Es liegen Anhaltswerte für die Rückhaltung von Regenwasser zwischen 40% bis 60% bis hin zu über 90% in Abhängigkeit von der Aufbaudicke vor (KOLB 2003, FLL 2018). Grundsätzlich ist festzustellen, dass mit größeren Aufbaudicken auch höhere Werte der Rückhaltung erreicht werden. Demgegenüber wird bei mittleren Aufbauhöhen, aber schlechtem Deckungsgrad der Vegetation nur ein geringer Wasserrückhalt erreicht (SALCHEGGER, H., 2010). Im Umkehrschluss könnte eine positive Beeinflussung des Deckungsgrads der Vegetation bspw. durch Bewässerung, die Rückhaltung fördern. Untersuchungen zeigen, dass insbesondere nach längeren Trockenperioden die Wasseraufnahmefähigkeit des nahezu ausgetrockneten Substrats zunächst sehr gering ist, durch eine kontinuierliche Grundfeuchte jedoch möglicherweise erhöht werden kann (FEHMER, D., ANLAUF, DR. R., REHRMANN, P., 2011). Ziel des Projektes ist es zu untersuchen, ob sich prognostizierte bzw. unter unterschiedlichen Versuchsbedingungen aus vorangegangenen Forschungsprojekten sektoral und bisher überwiegend nur für Extensivbegrünungen (mit xeromorphen Arten) nachgewiesenen Effekte für eine einfache Intensivbegrünung in einer typischen, gebauten Dachbegrünungssituation unter realen klimatischen Bedingungen durch eine Bewässerung mit aufbereitetem Grauwasser verstetigen und steigern lassen. Grauwasser ist nach EN 12056-1 als fäkalienfreier, gering verschmutzter Teil des häuslichen Abwassers definiert und fällt beispielsweise beim Duschen, Händewaschen oder auch in der Waschmaschine an. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der erforderlichen Quantitäten zur Erzielung möglichst großer Synergien der Effekte bzw. zur möglichen Optimierung eines Teilaspektes nach Bedarf im Anwendungsfall. In Langzeitversuchen wird dafür eine einfache Intensivdachbegrünung unter realen Einbaubedingungen und dem Einfluss wechselnder hydraulischer Belastungen in drei Standortbedingungen untersucht. Mit dem Einsatz von vorbehandeltem Grauwasser als nachhaltige Bewässerungsoption wird darüber hinaus die durch den Stoffeintrag bedingte Einflussnahme auf die Leistungsfähigkeit des Bodenkörpers beschrieben. Die Versuche dienen dem Aufbau einer Datengrundlage zur Validierung eigener erhobener Daten mit bereits vorhandenen, unter Laborbedingungen gewonnenen Forschungsergebnissen und deren möglicher Ergänzung. Folgende Fragestellungen sollen im Projekt betrachtet werden: Welche Flächengröße einer einfachen Intensivbegrünung lässt sich mit einem typischen Anfall von Grauwasser bewässern, um eine geschlossene, vitale Vegetationsdecke unter realen klimatischen Bedingungen zu erzielen? Wie wirken sich verschiedene durch Substratkennwerte gesteuerte Bewässerungsregime auf das Gesamterscheinungsbild und den Pflegeaufwand der Pflanzung, die Transpirationsleistung der Pflanzung, auf die kleinklimatische Situation (insbesondere die nächtliche Kühlwirkung), auf die Regenrückhaltung, auf Transport-, Abbau- und/oder Akkumulationsprozesse und auf die Gebäudekühlung bzw. Dämmwirkung aus. Wie wirken sich Transport-, Abbau- und/oder Akkumulationsprozesse einzelner Wasser-inhaltsstoffe insbesondere von Tensiden auf die Rückhaltekapazität eines Bodenkörpers aus und welchen Einfluss hat die Passage der Dachbegrünung auf die Emissionsbilanzen und Belastungsspitzen? Bereits in den Zwischenberichten vorgestellte Themenbereiche, wie beispielsweise die Beschreibung des Messsystems, die Pflanzenauswahl oder die Festlegungen der zu untersuchenden Parameter der Bonituren werden in diesem Bericht nicht erneut aufgeführt, soweit in Aufbau und Funktionsweise keine Änderungen vorgenommen wurden
- Location
-
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
- Extent
-
1 Online-Ressource (178 Seiten)
- Language
-
Deutsch
- Notes
-
Illustrationen
Literaturverzeichnis: Seite 162 - 166
- Event
-
Veröffentlichung
- (where)
-
Dresden
- (who)
-
Deutsche Bundesstiftung Umwelt
- (when)
-
2023
- Creator
- Contributor
- URN
-
urn:nbn:de:101:1-2024032817285764640574
- Rights
-
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
- Last update
-
14.08.2025, 10:44 AM CEST
Data provider
Deutsche Nationalbibliothek. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Forschungsbericht
Associated
- Lohaus, Irene
- Meyer, Sören
- Walter, Richard
- Helm, Björn
- Herr, Laura Elisa
- Freudenberg, Peggy
- Deutsche Bundesstiftung Umwelt
- Technische Universität Dresden
- Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Time of origin
- 2023