Bestand
Kunstkammer (Kunstkabinett) (Bestand)
Inhalt und Bewertung
Akten der herzoglichen bzw. königlichen Münz-, Medaillen-, Kunst- und Altertümersammlung, 1966 vom Landesmuseum übergeben.
Gliederung: Inventare und Verzeichnisse, Erwerbungen und Abgaben, Organisation und Verwaltung.
1. Geschichte der Institution: Kunst- und Wunderkammern waren frühe Vorläufer des modernen Museums, die in der Spätrenaissance aufkamen. Fürsten und reiche Privatiers sammelten darin kostbare oder zumindest kuriose Kunst- und Naturobjekte, um die Welt im Kleinen abzubilden, zu ordnen und begreifbar zu machen. Eine solche Kunstkammer, die neben Kunstwerken, Altertümern und Pretiosen aller Art auch zoologische, botanische und mineralische Naturalien umfasste, begründete um 1596 in Stuttgart Herzog Friedrich I. von Württemberg. In den folgenden Jahren entstanden daneben weitere Objektsammlungen mit Schaucharakter, die teils neben ihr bestanden, teils zeitweise in sie integriert wurden. Davon seien hier nur einige genannt: die Rüstkammer, um 1611/12 im Neuen Bau eingerichtet, deren Reste nach der Vernichtung des Neuen Baus durch einen Brand 1757 in die Kunstkammer übernommen wurden; die Schilderei- und Malereikammer, die 1670 aus den Beständen der Kunstkammer herausgelöst wurde; schließlich das Münzkabinett, begründet auf Basis der 1728 erworbenen Münzen- und Bronzensammlung des Herzogs Friedrich August vopn Württemberg-Neuenstadt. Diese zeitweise mit der Kunstkammer verbundenen Sammlungen wurden zur materiellen Grundlage der Bestände der heutigen staatlichen Museen in Stuttgart, insbesondere des Landesmuseums Württemberg, des Rosenstein-Museums und des Linden-Museums. Aus der Frühzeit der Kunstkammer haben sich kaum schriftliche Zeugnisse erhalten, die ihren Bestand dokumentieren: Hier zeigt sich die verheerende Zäsur des 30-jährigen Krieges, in dem ein großer Teil der Objekte verloren ging. Eine kontinuierliche Überlieferung, die Rückschlüsse über den Objektbestand und die Verwaltung der Kunstkammer erlaubt, setzt erst mit der Ernennung des ersten hauptamtlichen Kunstkammer-Verwalters bzw. Antiquars, Johann Betz, im Jahre 1654 ein. Von jetzt an wurde mindestens bei jedem Amtsantritt eines neuen Antiquars anlässlich der Übergabe eine allgemeine Inventur durchgeführt (im 18. Jahrhundert als "Sturz" bezeichnet). In der Folgezeit gelang der Erwerb bedeutender Sammlungen (Guth von Sulz 1654, Schaffalitzky von Muckendell 1674, im 18. Jahrhundert außerdem Sammlungen aus dem vormaligen Besitz der Nebenlinien Württemberg-Neuenstadt und Württemberg-Mömpelgard), welche die Kriegsverluste teilweise wieder aufwogen. Die innere Gliederung der Sammlung wurde dabei immer wieder verändert, sei es aus pragmatischen Gründen (z. B. Raumnot), sei es aus einem sachlich-wissenschaftlichen Anspruch heraus. Als besonders langlebig erwies sich die Gliederungssystematik des langjährigen Antiquars Johann Schuckard (im Amt 1690 bis 1723/25), die bis in die 1760er Jahre beibehalten wurde. Auf dieser Systematik basieren daher auch sämtliche Inventare aus diesem Zeitraum. Nach einigen umzugsbedingten Umstellungen in der Regierungszeit Herzog Karl Eugens wurde die Sammlung 1791 in ein Kunst- und ein Naturalienkabinett aufgeteilt und damit die spätere Verteilung auf die oben genannten Museen vorweg genommen. Vorgesetzte Behörde war spätestens seit 1729 das Oberhofmarschallamt und ist es wohl bis 1806 geblieben, wenn auch das "Württ. Adreßbuch" die Kunstkammer bzw. das Kunstkabinett zwischen 1779 und 1794 nicht unter dem Hofstaat aufführt. 1807 - 1817 hat das Münz- und Kunstkabinett dann offenbar nacheinander dem Oberschlossdepartement, der Oberschlossintendanz, der Generaloberintendanz und der Generaloberhofintendanz unterstanden, bis es 1817 mit der öffentlichen Bibliothek und den anderen Kabinetten unter der "Königlichen Direktion der wissenschaftlichen Sammlungen" organisatorisch vereinigt und dem Kultministerium unterstellt wurde. 1862 trat neben das Münz- und Kunstkabinett die ebenfalls dem Kultministerium unterstehende "Staatssammlung vaterländischer Kunst- und Altertumsdenkmale", auch "Museum vaterländischer Altertümer" o.ä. und vor allem abkürzend "Königliche Altertümersammlung" genannt. In deren Verwaltung ging 1909 das Münz- und Kunstkabinett über. 1922 wurde die Sammlung in eine vor- und frühgeschichtliche und eine kunst- und kulturgeschichtliche Abteilung (Schlossmuseum) aufgegliedert.
2. Geschichte des Bestandes: Der vorliegende Bestand stellt den Teil der Registratur des ehemaligen Schlossmuseums dar, der während des 2. Weltkrieges nach Bebenhausen ausgelagert wurde. Hier erlitten die Archivalien Wasserschaden, konnten jedoch größtenteils konserviert werden. Die restliche Registratur ist dagegen 1944 in Stuttgart verbrannt. Das Württ. Landesmuseum übergab den Restbestand mit Schreiben vom 22. Juli 1966 (Tgb. Nr. 3513) dem Hauptstaatsarchiv Stuttgart unter der Bedingung, dass das Landesmuseum die Archivalien jederzeit, auch in den Räumen des Museums, benützen könne, und dass ihm deren Benützung bis 1976 vorbehalten bleibe. Der Bestand war zwar in Büschel eingeteilt, doch herrschte keine eigentliche Ordnung, so dass eine völlige Neuordnung erforderlich war. Der Versuch der Archivare Dr. Uhland und Dr. Füchtner, beim Ordnen der Archivalien in den Jahren 1966/67 über die früheren Ordnungen des Bestandes ein zusammenhängendes Bild zu gewinnen, blieb ohne Ergebnis. Unter den jetzt in Büschel 180 vereinigten Verzeichnissen von Akten und Inventaren befindet sich kein Repertorium und kein Aktenplan des Gesamtbestandes aus älterer Zeit. Die auf den Archivalien zu findenden alten Signaturen gehören verschiedenen Systemen an. Auch aus der Aufbewahrung der Akten ließ sich kein Ordnungsplan erschließen. Die seit der Mitte des 18. Jahrhunderts auftretenden Signaturen bestehen aus Großbuchstaben (z. B. O. oder Lit. O) oder arabischen oder römischen Zahlen, die als Nummern, Beilagen etc. bezeichnet sein können. Aber erst für den "Sturz" (Inventur) von 1776 wird ein Plan einigermaßen erkennbar: Den Inventaren werden vor allem Consignationen oder Verzeichnisse, aber auch Abgabedekrete, Denkschriften u. ä. als "Urkunden" beigefügt. Die zum "Sturz" herangezogenen Akten oder doch einen großen Teil von ihnen hat man anscheinend als "Beilagen" zur "Sturzrelation" durchnummeriert. Außerdem scheint man das große Alphabet, das schon zuvor zur Kennzeichnung der Inventare diente, zur Signierung der "Urkunden" noch einmal verwendet zu haben - denkbar ist allerdings auch, dass die betreffenden "Urkunden" von 1776 erst 1784/85 Großbuchstaben als Signaturen erhalten haben. Für 1784/85 ist nämlich das Vorhandensein von "Beilagen" und "Urkunden" zur "Sturzrelation", die mit Großbuchstaben gekennzeichnet sind, nachweisbar. 1791/92 werden dann alle "Beilagen" einschließlich des Gesamtinventars durchnummeriert. Zu beachten ist, dass eine Beilage zu mehreren "Stürzen" herangezogen werden konnte. Daher braucht eine Signatur nicht aus dem gleichen Jahr wie die signierten Akten zu stammen, auch wenn die Signatur dem Ordnungsgrundsatz der Zeit entspricht. Faszikelumschläge des 19. Jahrhunderts lassen darauf schließen, dass im Kunstkabinett u. a. "Decrete" und "Rechnungen" als Serien geführt wurden. Auch die Staatssammlung scheint Serien bevorzugt zu haben, wobei innerhalb der Serie Akten mit demselben Betreff zusammengezogen werden konnten. 1832 gab der Oberhofrat, Nachfolgebehörde des Oberhofmarschallamts, Akten der Kunstkammer und des Münzkabinetts, die sich in seiner Registratur vorgefunden hatten, an das Münz- und Kunstkabinett ab (vergleiche Büschel 180, 11 und Büschel 182). Um 1925 wurden ein Verzeichnis der Kunstkammerakten und ein Verzeichnis der Inventare von 1624 bis 1807 angelegt (vergleiche Büschel 181). Die Kunstkammerakten wurden in Faszikel und innerhalb der Faszikel in Vorgänge eingeteilt und dementsprechend durch zweigliedrige Signaturen arabischer Zahlen gekennzeichnet (z. B. 3.5). Die Inventare wurden durchnummeriert, wobei die Nummern aber auf den Archivalien nicht eingetragen worden zu sein scheinen. Ordnungsgrundsatz war die Chronologie, er wurde jedoch nicht streng eingehalten. Die Verzeichnisse sind überdies nicht vollständig. Entstehungszeit und Bedeutung der selten vorkommenden, aus dem Großbuchstaben F und einer nachgestellten arabischen Zahl bestehenden Signaturen waren nicht zu klären.
3. Einrichtung des Bestandes: Da bei der Einrichtung des Bestandes in den Jahren 1966/67 nicht auf eine ältere Ordnung rekurriert werden konnte, wurden die Büschel loser Akten soweit erforderlich aufgelöst und die Akten neu gruppiert. Ihre Gliederung sucht die einzelnen Bereiche der Verwaltungstätigkeit der Kunstkammer und ihrer Nachfolgeinstitutionen voneinander zu sondern und die wichtigeren Ereignisse ihrer Geschichte zu berücksichtigen. Als Element der Gliederung dienen auch die Unterfaszikel. Auf die Wasserschäden des Bestandes wurde nur in besonders schweren Fällen hingewiesen. Als nicht zu den Akten der Kunstkammer gehörig wurden in den Bestand A 21, Oberhofmarschallamt eingereiht: 1) Handakten des verstorbenen Hof- und Domänenrats Wiedenmann (1 Schriftstück), o.D. (18. Jh.) 2) Aufstellung des beim Sturz 1773 in der herzoglichen Konditorei fehlenden Geschirrs und Mobiliars (1 Schriftstück), 1774. 3) Akten betr. Stürze des beweglichen Inventars zum herzoglichen Hof gehöriger Gebäude und Stellen (1 Faszikel), 1794 - 1797 und o.D. (um 1795). Der Bestand A 20 a umfasst 205 Büschel mit 2,10 lfd. m. Die Neuordnung und Neuverzeichnung erfolgte im Winter 1966 und Frühjahr 1967 durch Staatsarchivassessor Dr. Füchtner unter Aufsicht von Oberstaatsarchivrat Dr. Uhland. Die Retrokonversion des Findbuchs bzw. die Umformung der maschinenschriftlichen Vorlage für die internetgerechte Präsentation dieses Bestands des Hauptstaatsarchivs Stuttgart sowie die Überarbeitung der Indexangaben wurde von Herrn Christian Artes unter Anleitung von Dr. Franz Moegle-Hofacker im Februar 2008 abgeschlossen.
4. Neuerschließung und objektbezogene Indexierung des Bestandes: Auf der Basis des Inventars von 1967 wurde im Rahmen eines Projekts zur beständeübergreifenden Erschließung und Indexierung der Archivalien zur württembergischen Kunstkammer von Niklas Konzen unter Betreuung von Herrn Dr. Peter Rückert bis Dezember 2012 eine grundlegende Neuerschließung des Bestands vorgenommen. Das Projekt wurde von der Stiftung Kulturgut gefördert und unter Trägerschaft des Landesmuseums Württemberg in Kooperation mit dem Hauptstaatsarchiv Stuttgart von 2010 bis 2012 realisiert. Gegenstand der Überarbeitung war eine Vertiefung der Erschließungstexte um Informationen mit Bezug zu den erwähnten Objekten. In die Erschließung aufgenommen wurden unter anderem die Erwähnung von Objekten bzw. Objektklassen, Objektmaterialien sowie von Personen, die am Herstellungs-, Erwerbs- oder Veräußerungsprozess beteiligt waren (z. B. Hersteller bzw. Künstler, Händler, Vorbesitzer, Hofangehörige mit Bezug zur Kunstkammer). Dabei wurden auch Schlagworte für Objekt- und Materialarten sowie die relevanten Personen und Orte erstellt, um diese über die erweiterte Volltextsuche recherchierbar zu machen. Zugleich wurde mit dem sachthematisch gegliederten Online-Inventar "Württembergische Kunstkammer" ein alternativer Zugang für die beständeübergreifende Suche in den Archivalien des Hauptstaatsarchivs geschaffen. Eine nähere Erläuterung zur Definition der verwendeten Sachindizes findet sich in der Einführung zum sachthematischen Inventar.
Literatur: Einschlägige Titel zur württembergischen Kunstkammer: Baum, Julius. Die kunsthistorischen Bestände der Königlichen Altertümersammlung, In: Festschrift (wie unten), S. 23 ff. Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens der königlichen Altertümersammlung in Stuttgart 1912. Stuttgart 1912. Fleischhauer, Werner. Die Geschichte der Kunstkammer der Herzöge von Württemberg in Stuttgart. Stuttgart 1976. Ders. Kunstkammer und Kronjuwelen: Württembergisches Landesmuseum Stuttgart. Stuttgart 1977. Ders. Das Württembergische Landesmuseum (Schwäbisches Heimatbuch 1949, S. 144 ff.). Ders. Rede zur Wiedereröffnung des Museums am 29. September 1956 (Das württembergische Museum 3, 1956 S. 60 ff.). Frey, Ansprache bei der Eröffnung des neuen Teils der staatlichen Landeskunstsammlungen im ehemaligen Kronprinzenpalais (Württemberg 1930, S. 364 ff.). Goessler, Peter. Die Königliche Altertümersammlung in Stuttgart und ihr archäologischer Bestand von 1862 - 1912. In: Festschrift (wie oben), S. 3 ff.). Ders. Die Königliche Münz- und Medaillensammlung in Stuttgart (a.a.O. S. 35 ff.). Stälin, Christoph Friedrich. Zur Geschichte und Beschreibung alter und neuer Büchersammlungen im Königreich Württemberg ...., § 2. Königliche Münz-, Kunst- und Altertümersammlung in Stuttgart (Württ. Jahrbücher für vaterländische Geschichte, Geographie, Statistik und Topographie, Jahrgang 1837, S. 335 ff). Warth, Manfred. Über Mineralien und Fossilien der Stuttgarter Kunstkammer: Bemerkenswertes aus Inventarien des 17. und 18. Jahrhunderts. Stuttgart 1974.
- Reference number of holding
-
Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, A 20 a
- Extent
-
205 Büschel (3,00 lfd. m)
- Context
-
Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart (Archivtektonik) >> Altwürttembergisches Archiv >> Auslesebestände über die Landesverwaltung, Kabinett und Hofbehörden >> Hofverwaltung
- Other object pages
- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs
- Rights
-
Es gelten die Nutzungsbedingungen des Landesarchivs Baden-Württemberg.
- Last update
-
20.01.2023, 3:09 PM CET
Data provider
Landesarchiv Baden-Württemberg. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Bestand

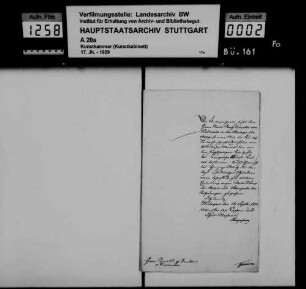
![[Kunstkabinett].](https://iiif.deutsche-digitale-bibliothek.de/image/2/a718318c-a33e-4ec2-bc86-ae463cdeb3a4/full/!306,450/0/default.jpg)