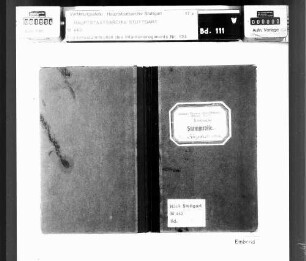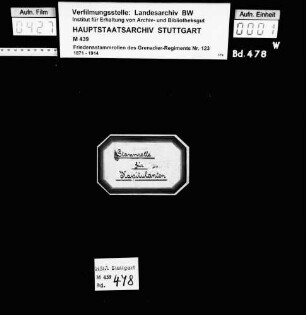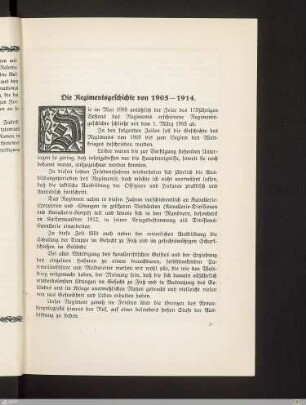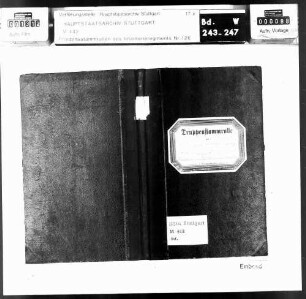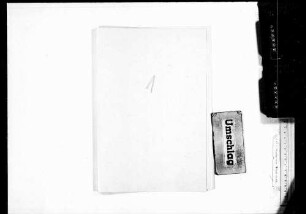Bestand
Amt Eving (1905-1914) (Bestand)
Vorwort: BESTAND 22 - Amt Eving (1905-1914)
Inhalt und Umfang
Der vorliegende Bestand 22, Amt Eving, umfaßt Akten und Amtsbücher der Amtsverwaltung Eving sowie Protokollbücher der Amts- und Gemeindevertretungsorgane, teilweise mit Vor- und Nachprovenienzen mit Laufzeiten zwischen 1823 bis 1927. Die Laufzeit der überwiegenden Masse der Archivalien deckt sich jedoch mit der Zeit des Bestehens des Amtes Eving: 1905 bis 1914. Der Bestand enthält Sachakten, Rechnungs- und Protokollbücher und umfaßt 346 Archiveinheiten oder 7,5 lfd. Meter. Provenienz ('Registraturbildner') des Bestandes ist die Amtsverwaltung Eving. Bei verschiedenen Protokollbüchern treten die Amts- und Gemeindevertretungsorgane als Provenienz auf.
Aktenführung
Die Akten, Lagerbücher u. ä. des Amtes Lünen in Kirchderne waren 1905 den beiden neugeschaffenen Ämtern Eving und Kirchderne überwiesen worden; die vorhandenen generellen Akten, die Standesamtsregister u.ä. verblieben beim Amt Eving, das auch die Gesetzbücher und die Handbücher übernahm (Best.22 Nr.340).
Es konnte anhand eines Teiles des Aktenbestandes festgestellt werden, daß es sich bei den Amtsakten um ein 2 - 3 schichtiges, in Fach und Nummer sachlich gegliedertes Registraturschema gehandelt hat. Die in der Altregistratur reponierten Akten waren ebenfalls nach einem dreigliedrigen Ordnungsschema, und zwar nach Abschnitt, Fach und Nummer geordnet.
Über die Einrichtung der Meldekartei des Einwohnermeldeamtes des Amtes Eving gibt der Bericht über die Verwaltung des Amtes Eving 1905 - 1914 aus dem Jahr 1914 ausgeführt detaillierte Auskunft.
Übernahme, Ordnung und Erschließung
Die Übergabe der Akten und Amtsbücher des Amtes und der Gemeinden des Amtes Eving an die Dortmunder Stadtverwaltung erfolgte nach der Eingemeindung nach Dortmund 1914.
Die Akten des Amtes Eving trugen im Stadtarchiv früher die Archivkennziffer "E", die der Gemeinden die Ziffern 22 (Eving), 23 (Kemminghausen), 24 (Lindenhorst) und 25 (Holthausen). Sämtliche Aktenbestände der auf Dortmunder Gebiet existierenden Amtsverwaltungen trugen die Bestandskennziffer 17.
Hinweise zur Benutzung
Die Archivalien werden im Stadtarchiv unter Angabe der Signatur, die sich aus der Bestands- sowie der laufenden Nummer zusammensetzt (Beispiel: Bestand 22 Nr.45), zur Einsichtnahme bestellt und sind bei Verwendung in Publikationen, Ausstellungen u. ä. mit Angabe des Archivs, der Bestands- und der laufenden Nummer zu zitieren (Beispiel: Stadtarchiv Dortmund, Bestand 22 Nr.45).
BEHÖRDENGESCHICHTE
Verwaltungsbezirk und Amtssitz
Am 1. April 1905 erfolgte die Teilung des Amtes Lünen in die Ämter Derne (mit den Gemeinden Altenderne-Niederbecker, Altenderne-Oberbecker, Beckinghausen, Gahmen, Horstmar , Hostedde und Kirchderne) und Eving (mit den Gemeinden Brambauer, Brechten, Eving, Holthausen, Kemminghausen, Lindenhorst und Lippholthausen). Das Amt Derne blieb vorläufig am bisherigen Amtssitz des Amtes Lünen in Kirchderne, während für das Amt Eving ein Privathaus angemietet wurde, worin die Geschäftsräume des Amtes solange verblieben, bis das schon im Rohbau befindliche Amtshaus fertig gestellt war. Der Einzug in das neue Amtshaus erfolgte am 1. Juli 1906.
Im Jahre 1907 bemühte sich die angrenzende Stadt Dortmund erneut um die Eingemeindung der Gemeinden Eving und Lindenhorst, nachdem schon im Jahre 1903 deswegen erfolglose Verhandlungen zwischen den betroffenen Gemeinden geführt worden waren. Die Verhandlungen wurden jedoch schleppend geführt und ruhten dann vollständig. Als die Stadt Dortmund dem preußischen Innenminister im Jahr 1910 einen Plan über beabsichtigte umfangreiche Eingemeindungen vorlegte, fand dieser die Zustimmung des Innenministers, so daß auf dieser Grundlage die Verhandlungen erneut aufgenommen wurden. Am 8. April 1911 fand im Sitzungssaal des Amtshauses eine gemeinschaftliche Versammlung der Gemeindevertretungen von Eving, Lindenhorst, Kemminghausen und Holthausen sowie einem Vertreter der Stadt Dortmund unter dem Vorsitze des Landrats Freiherrn von Rynsch statt. Die Gemeindevertretungen beschlossen zur Führung der Verhandlungen Kommissionen zu wählen. Die Gemeinde Holthausen schied später aus dem Eingemeindungsplan der Stadt Dortmund aus. Ende 1912 waren die Verhandlungen zum Abschluß reif und die Gemeindevertretungen beschlossen alle einstimmig die Vereinigung der Landgemeinden mit der Stadtgemeinde Dortmund.
Verfassung und Verwaltung
Die gesetzliche Grundlage für die Verwaltung des Amtes Eving war die westfälische Landgemeindeordnung vom 19.03.1856. Die westfälischen Amtsbezirke waren Verwaltungseinheiten zwischen den Gemeinden und den Kreisen. Das Amt war unterste Instanz der staatlichen Verwaltung und zugleich Kommunalverband. Als unterster staatlicher Verwaltungsbezirk war es in erster Instanz der Aufsicht des Landrates und in zweiter Instanz der Bezirksregierung in Arnsberg unterstellt; für die Bearbeitung der übertragenen Selbstverwaltungsangelegenheiten bildete das Amt einen Kommunalverband mit den Rechten einer Gemeinde.
An der Spitze des Amtes stand der Amtmann und mindestens ein Stellvertreter (Beigeordneter). Der Amtmann vertrat das Amt nach außen und war ausführendes Organ des Amtes. Er hatte die Verwaltung der Amtsangelegenheiten, ferner die Beaufsichtigung der zum Amt gehörenden Gemeinden, insbesondere ihres Haushalts- und Rechnungswesens sowie der Verwaltungstätigkeit des Gemeindevorstehers und alle örtlichen Geschäfte in Landesangelegenheiten zu besorgen. Zu den Landesangelegenheiten gehörte insbesondere die Verwaltung der Polizei, die Tätigkeit als Hilfsbeamter der Staatsanwaltschaft und als Standesbeamter. In der 1886 erlassenen westfälischen Kreisordnung war dem Kreisausschuß das Vorschlagsrecht für die Besetzung der Amtmannsstellen übertragen worden. Die Ernennung des Amtmanns, dessen Dienstvorgesetzter der Landrat war, stand allein dem Oberpräsidenten zu.
Das Amt wurde in seinen Kommunalangelegenheiten durch die Amtsversammlung vertreten, zu der die Vorsteher der einzelnen Gemeinden des Amtes und die von den Gemeindeversammlungen gewählten Amtsverordnungen gehörten. In allen Selbstverwaltungsangelegenheiten war die Amtsversammlung beschließendes Organ. Die Wahl der Amts- und Gemeindevertreter erfolgte bis zur Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts 1918 nach dem preußischen Dreiklassenwahlrecht.
Amtmann, Amtsbeigeordnete:
Bonnermann, Paul, Amtmann des Amtes Eving vom 1. April 1905 ab, vorher Amtmann des Amtes Lünen seit 1. April 1893;
Große-Leege, Eberhard, Gutsbesitzer in Eving, Amtsbeigeordneter;
Grävinghoff, Wilhelm, Gutsbesitzer in Eving, Amtsbeigeordneter.
Mitglieder der Amtsversammlung:
Aus der Gemeinde Braubauer:
1. Schulte-Baukloh, Gemeindevorsteher
2. Eickler, Friedr., Dachdecker
3. Overthun, Theodor, Landwirt
4. Roß, Wilhelm, Grubeninspektor
5. Neuhäuser, Wilhelm, Schuhmacher
6. Haarmann, Bergassessor und Bergwerksdirektor
7. Große-Oetringhaus, Landwirt
8. Dr. med. Sybrecht, Arzt
Aus der Gemeinde Brechten:
1. Gröning, Gemeinde-Vorsteher
2. Wolf, Gastwirt
3. Romberg, Wilhelm, Landwirt
Aus der Gemeinde Eving:
1. Grävinghoff, Wilhelm, Gemeindevorsteher
2. Baukloh, Wilhelm, Landwirt
3. Bockemühl, Gustav, Expedient
4. Rose, Heinrich, Steiger a. D.
5. Hoffmann, Wilh., Landwirt
6. Thäle, Wilh., Maschinensteiger
7. Winterkamp, Richard, Landwirt
8. Dr. med. D`ham Sanitätsrat
9. Heuner, August, Schreinermeister
10. Hoffmann, Justus, Inspektor
Aus der Gemeinde Holthausen:
1. Kuckelke, Wilhelm, Gemeindevorsteher
2. Suhr, Wilhelm, Landwirt
Aus der Gemeinde Kemminghausen:
1. Grube, G., Gemeindevorsteher
2. Middeldorf, Wilhelm, Landwirt
Aus der Gemeinde Lindenhorst:
1. Thüner, Wilhelm, Gemeindevorsteher
2. Nierhoff, Diedr., Rentner
3. Husemann, Karl, Bauunternehmer
4. Böcker gent. Kellerhoff, Wilh., Landwirt
Aus der Gemeinde Lippolthausen:
1. von Rürleben, Otto, Gemeindevorsteher und Rittersgutbesitzer
2. Rüping, Heinr., Landwirt
Die Gemeinde wurde in ihren Angelegenheiten durch die Gemeindeversammlung und den Gemeindevorsteher vertreten. Als Gebietskörperschaften des öffentlichen Rechts hatten die Gemeinden ihre Aufgaben in eigener Verantwortung zu verwalten (z.B. Finanz- und Vermögensangelegenheiten, Wege- und Straßenbau, Bau und Unterhaltung von Schulen, Feuerlöscheinrichtungen, Armenverwaltung) und als unterster staatlicher Verwaltungsbezirk hatten sie Aufgaben auf dem Gebiet der inneren Verwaltung, der Finanz- und Vermögensverwaltung, der Militärverwaltung und der Justizverwaltung zu übernehmen. Die Gemeindeversammlung, die beschlußfassendes Organ in allen Gemeindeangelegenheiten war und die Verwaltung überwachte, setzte sich aus Gemeindeverordneten zusammen, die auf sechs Jahre gewählt wurden. Alle zwei Jahre schied ein Drittel aus. Der Gemeindevorsteher hatte unter der Aufsicht des Amtmanns die Gemeindeangelegenheiten zu verwalten und die Ortspolizei zu handhaben. Er war für alle Angelegenheiten, die zum Geschäftskreis des Amtmanns gehörten, dessen Hilfsorgan und Hilfsbehörde. Seine wichtigsten Aufgaben waren die Vorbereitung der Gemeindebeschlüsse und ihre Ausführung, der Vorsitz in der Gemeindeversammlung, die Beanstandung rechtswidriger Gemeindebeschlüsse, die Verwaltung der Gemeindeanstalten und des Gemeindevermögens sowie die Vertretung der Gemeinde nach außen. Der Gemeindevorsteher wurde von der Gemeindeversammlung auf sechs Jahre gewählt. Nach dreijähriger Dienstzeit konnte er auf 12 Jahr gewählt werden. Seine Wahl bedurfte der Bestätigung durch den Landrat. Bei der Aufstellung des Gemeindehaushaltsplanes, der Rechnungslegung und Kassenrevision wirkte der Amtmann mit. Alle Anweisungen an die Gemeindekasse sowie Urkunden bedurften der Unterschrift des Amtsmannes. Auch der Schriftverkehr in Gemeindeangelegenheiten mit Dritten, besonders mit Behörden, und soweit es sich nicht um unmittelbare Entscheidungen handelte, führte der Amtmann, wie auch sämtliche Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde vom Amt für die Gemeinde mitgeführt werden konnten.
Gemeindevorsteher
1. Grävinghoff, Wilhelm, Eving
2. Kuckelke, Heinrich, Holthausen
3. Grube, Gust., Kemminghausen
4. Thüner, Wilhelm, Lindenhorst
5. von Rürleben, Lippolthausen
6. Schulte-Baukloh, Heinrich, Brambauer
7. Gröning, Wilh., Brechten
Gemeindeverordnete
Gemeinde Brambauer:
1. Rumpff, Kaspar Bureaubeamter
2. Eickler, Fr., Dachdecker
3. Schulte-Tockhaus, Landwirt
4. Roß, Wilh., Inspektor
5. Bierkämper, Bergmann
6. Haarmann, A. Berg-Assessor
7. Dr. med. Sybrecht Gust., Arzt
8. Brüggemann, Wilhelm, Wirt
9. Trelle, Diedr., Betriebsführer
10. Kopiejewski, Bergmann
11. Waszynski, Anton
12. Große-Oetringhaus, Landwirt
Gemeinde Brechten:
1. Wolf, Fr. Wirt
2. Brinkmann, Wilh., Bergmann
3. Romberg, Wilh., Landwirt
4. Lüdeking, Hermann, Bergmann
5. Geißler, Gustav, Bergmann
6. Frielinghaus gt. Beckmann, Landwirt
Gemeinde Eving:
1. Baukloh, W., Landwirt
2. Vogt, August, Bergmann
3. van Elsbergen, Guts-Inspektor
4. Winterkamp, Richard, Landwirt
5. Dr. med. D`ham, Sanitätsrat
6. Bockenmühl, Gustav, Versandmeister
7. Hofmann, Justus, Inspektor
8. Rose, Heinr., Steiger a. D.
9. Heuner, August, Schreinermeister
10. Jungesblut, Fr. Bergmann
11. Meier, Heinr., Bergmann
12. Schreer, Wilhelm, Bergmann
13. Thäle, Wilh., Maschinensteiger
14. Hollkott, Karl, Markenkontrolleur
15. Fischer, August, Bergmann
Gemeinde Holthausen:
1. Wibbeling, Gustav, Landwirt
2. Westermann, Heinrich, Landwirt
3. Suhr, Wilh., Landwirt
4. Berchem, Diedr., Bergmann
5. Große-Oetringhaus, Richard, Landwirt
6. Lehmhaus, Heinrich, Kanalarbeiter
Gemeinde Kemminghausen:
1. Middeldorf, Wilhelm, Landwirt
2. Holtkamp, H., Versicherungs-Inspektor
3. Schulte-Uebbing, Landwirt
4. Pfingsten, Georg, Bergmann
5. Pohl, Reinholt
6. Haarmann, Karl, Landwirt
Gemeinde Lindenhorst:
1. Heyn, Gustav, Gastwirt
2. Nierhoff, Diedr, Landwirt.
3. Sträter, Wilhelm, Fahrhauer
4. Schröder, Wilhelm, Maschinensteiger
5. Dr. med. Poth, H., Arzt
6. Geldmacher, Georg, Betriebsführer
Gemeinde Lippolthausen:
1. Haumann, Heinr., Landwirt
2. Schulte-Tockhaus, Landwirt
3. Rühenbeck, Wilh., Landwirt
4. Greining, Wilh., Landwirt
5. Neuhoff, Heinr., Landwirt
6. Rühenbeck, Fritz, Wirt
Für bestimmte Bereiche kommunaler Angelegenheiten wurden Ausschüsse gebildet, um die Gemeindevertretung zu beraten und zu entlasten. Sie setzte sich aus Mitgliedern der Gemeindevertretung und fachkundigen Ortseinwohnern zusammen. Den Vorsitz führte der Gemeindevorsteher.
Das Amt Eving stellte nach der Errichtung aus dem Wahlverband der Amtsverbände zwei Kreistagsmitglieder: Gutsbesitzer W. Grävinghoff in Eving und Betriebsinspektor W. Thüner in Lindenhorst. Bei der 1911 stattgefundenen Ergänzungswahl wurden beide wieder gewählt. Aus dem Wahlverband der größeren ländlichen Gutsbesitzer gehörte Bergwerksdirektor Karl Haarmann in Brambauer noch dem Kreistag an. Das Amt war Mitglied des Westfälischen Landgemeindetages und des Verbandes Rhein.-Westfälischer Gemeinden.
Amtspersonal
1. Heuner, Fritz, Amtsrentmeister
2. Putsch, Wilhelm, Amtsbaumeister
3. Baltes, Constanz, Sparkassenrendant
4. Meyer, Gustav, Amtstierarzt
5. Schübbe, Wilhelm, Polizeikommissar
6. Bassfeld, Heinr., Amtssekretär
7. Demtröder, Emil, Amtssekretär
8. Hellkötter, Fritz, Amtssekretär
9. Perband, Karl, Sparkassen-Gegenbuchführer
10. Steinfort, Kassenassistent
11. Kreinberg, Polizeiwachtmeister
12. Steineck, Polizeisergeant
13. Dittmar, Polizeisergeant
14. Boß, Polizeisergeant
15. Kramer, Polizeisergeant
16. Mais, Polizeisergeant
17. Kötting, Polizeisergeant
18. Schmidt, Polizeisergeant
19. Hellmann, Polizeisergeant
20. Kroniger, Polizeisergeant
21. Braß, Polizeisergeant
22. Siedentop, Polizeisergeant
23. Thriene, Vollziehungsbeamter
24. Hanebeck, Vollziehungsbeamter
25. Floer, Vollziehungsbeamter
26. Lemke, Amtsdiener
Die Amtsbeamten traten nach der Eingemeindung 1914 teils in den Dienst der Stadt Dortmund und teils verblieben sie beim Amt Brambauer.
Einwohnermeldeamt
Anläßlich der Teilung des Amtes Lünen bezw. Neubildung des Amtes Eving wurden die Meldekarten der Bewohner des Amtsbezirks Eving zwar aus dem Bestande des vorhandenen Materials des alten Amtes Lünen übernommen, jedoch wurde das Meldeamt für das Amt Eving völlig neu eingerichtet. Die Beschreibung der neuen Karten erfolgte auf Grund des vorhandenen alten Kartenmaterials so daß eine Neuaufnahme des Personenstandes nicht erforderlich war. Für jeden Einwohner waren Doppelkarten vorhanden und zwar wurde diese Karte gemeindeweise nach Straßen- und Hausnummern und die zweite Karte nach dem Alphabet geordnet aufbewahrt. Die Karten über Abmeldungen waren nur in einer Ausfertigung vorhanden und wurden alphabetisch geordnet aufbewahrt. Da die zum Amt Eving gehörende, im Jahre 1908 8550 Einwohner zählende Gemeinde Brambauer räumlich weit vom Amtssitz entfernt lag, wurde im November 1908 für die Einwohner von Brambauer zur Erleichterung im Verkehr mit dem Meldeamt die Einrichtung getroffen, dass polizeiliche An- und Ummeldungen für diese Gemeinde auch bei den dort vorhandenen Polizeistationen vorgenommen werden konnten.
Armenverwaltung
Das öffentliche Armenwesen in den beiden größeren Gemeinden Brambauer und Eving wurde von besonderen Kommissionen, welche von der Gemeindevertretung gewählt waren, verwaltet. Diese Einrichtung bestanden in Brambauer seit dem 01.11.1909, in Eving seit dem 01.04.1900. Als Armenvorsteher fungierten in Brambauer der Kolonieverwalter Anthe, in Eving der Landwirt Baukloh. In den übrigen Gemeinden bestanden keine besonderen Armenkommissionen und die Beschlußfassung über Armensachen erfolgte durch die Gemeindevertretungen.
Wohlfahrtspflege
Das im Jahre 1895 errichtete Kaiser-Wilhelm-Hospital, ein Verbandskrankenhaus der politischen Gemeinden Eving und Lindenhorst, war bereits im Jahre 1912 durch Anbau vergrößert worden. Als sich das Fehlen einer besonderen Isolierabteilung für Infektionskranke immer mehr bemerkbar machte und eine Vergrößerung des Krankenhauses auch ohnehin erforderlich wurde, beschloß der Krankenhausverband einen Erweiterungsbau. Hierbei wurde auch das schon lange erwünschte Säuglingsheim geschaffen. Der Erweiterungsbau, der 4 getrennte Abteilungen für Infektionskranke und das Säuglingsheim umfaßte, wurde im Jahre 1910 und 1911 ausgeführt. Die Eröffnung des Säuglingsheims fand am 26.09.1911 statt.
Nachdem der Landwirt Heinrich Ferige schon im Jahre 1902 ein Grundstück zur Größe von 67,64 ar für den Krankenhausbau geschenkt hatte, wurde der Bau des Gemeindekrankenhauses Brambauer (Wilhelm-August-Viktoria-Hospital) im Jahre 1905 von der Gemeindevertretung beschlossen. Die Bauarbeiten wurden in den Jahren 1906 und 1907 ausgeführt. Am 15.10.1907 erfolgte die Eröffnung des Krankenhauses.
Die Verhandlungen über die Schaffung eines Volksparks für die Gemeinde Brambauer begannen im Jahre 1908. Am 31.12.1908 wurde in Mengede ein Waldgrundstück zwischen Kaiser- und Brechtenerstraße gelegen für die Gemeinde angekauft. Die Größe des Volksgartens betrug ca. 6 Hektar. Die Lungenfürsorgestelle für das Amt Eving war eine Nebenstelle der Zentrale in Dortmund. Ein Fürsorgeausschuß, an dessen Spitze der Landrat und der Kreisarzt standen, übte die Leitung der im Kreise eingerichteten Fürsorgestellen aus. Die Fürsorgestelle wurde am 01.11.1910 eröffnet.
Am 1. Januar 1908 wurde die Kollektivberufsvormundschaft für uneheliche Kinder im Amte Eving eingeführt, nachdem die Amtsversammlung unterm 25.10.1907 die Einführung beschlossen hatte. Als Berufsvormund wurde Amtmann Bonnermann gewählt.
Mit gleichem Tage trat auch das den ganzen Amtsbezirk umfassende Waisenamt in Wirksamkeit.
Nachdem sich die preußische Staatsregierung Anfang 1911 entschlossen hatte, eine planmäßige Ausgestaltung der Jugendfürsorge einzuleiten, "um die körperlichen und sittlichen Kräfte der schulentlassenen Jugend zu entwickeln und für das Leben zu festigen", wurden am 25.04.1911 im Amtsbezirk Eving Ortsausschüsse für nationale Jugendpflege gebildet. In diese Ortsausschüsse wurden die Gemeindevorsteher, Geistlichen, Lehrer und sonstige für die Jugendpflege geeignete Personen gewählt. Durch Bildung von Arbeitsausschüssen im Februar 1913 wurde die Organisation noch weiter ausgebaut. Vorsitzende der Arbeitsausschüsse waren die jeweiligen Vorsitzenden der Ortsausschüsse mit Ausnahme in Eving, wo Pfarrer Thiele den Vorsitz im Arbeitsausschuß führte. In den Ortsausschüssen hatten sich zusammen 15 Vereine mit 976 Mitgliedern der nationalen Jugendpflege angeschlossen. Seitens der Gemeinden wurden den Vereinen Sport- und Spielplätze sowie die Turnhallen der Schulen unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
Bauwesen
Hochbau
Wenn auch zur Deckung des Wohnungsbedarfs für die Bergarbeiterschaft die Bergwerksgesellschaften durch Schaffung von Arbeiterkolonien bemüht waren, so blieben doch andere aus der schnellen und starken Bevölkerungszunahme sich ergebenden Verpflichtungen zu lösen. Schulen und Krankenhäuser mußten gebaut, Wegebauten, Kanalisationen ausgeführt werden. Daneben blieben die baupolizeilichen Geschäfte zu erledigen. Sämtliche Arbeiten wurden von einem Amtsbaumeister und zwei Technikern ausgeführt.
Durch die Baupolizeiverordnung für den Regierungsbezirk Arnsberg vom 16. März 1910 war den Kreis und Ortspolizeibehörden die Befugnis eingeräumt worden, eine Zonenbebauung einzuführen.
öffentliche Bauten (1905 bis 1913)
In Brambauer: Gemeindekrankenhaus mit Infektionsbaracke für ansteckende Krankheiten, 18klassige August-Viktoriaschule mit 2 Zeichensälen und Kochküche, Gemeindegasthaus, evangelische Kirche und Pfarrhaus, Polizeigebäude, 12klassige Moltkeschule mit 2 Zeichensälen, Turnhalle, Kochküche und Badeeinrichtung.
In Brechten: Anbau von 4 Klassen nebst Turnhalle und Badeeinrichtung an der Luisenschule
In Eving: Amtshaus und Amtsmannwohnung, Anbau von 6 Klassen mit Turnhalle und Zeichensaal an die Moltkeschule, Erweiterung der katholischen Kirche, katholisches Schwesternhaus, katholisches Kaplaneigebäude, evangelisches Pfarrhaus, Anbau einer Infektionsabteilung und Einrichtung eines Säuglingsheims am Krankenhaus, evangelisches Gemeindehaus, Anbau von 6 Klassen an die Bismarckschule
In Holthausen: Obduktionsraum am Spritzenhaus
In Lindenhorst: Anbau von 4 Klassen an die Luisenschule, evangelisches Pfarrhaus, evangelisches Gemeindehaus, Erweiterungsbau der evangelischen Kirche
Bauberatung
Durch Verfügung des Landrats vom 2. Oktober 1912 wurde angeordnet, dass sämtliche Baugesuche zunächst dem Kreishochbauamt vorgelegt wurden. Die architektonisch einwandfreien Projekte wurden ohne weiteres zurückgesandt. Bauvorlagen, die eine Abänderung wünschenswert erscheinen ließen, wurden in einer gemeinschaftlichen Besprechung zwischen Kreisbaumeister und Amtsbaumeister, Bauherr oder Architekt erörtert und gegebenenfalls in anderer Ausführung vereinbart.
Tiefbau
Für die Gemeinde Eving wurde vom Kreisvermessungsamt ein Kanalisationsprojekt ausgearbeitet, das die landespolizeiliche Genehmigung erhielt. Das hiermit im Zusammenhang stehende Projekt einer Kläranlage, bearbeitet von der Emschergenossenschaft, verzögerte sich anfangs durch Einsprüche der Stadt Dortmund. Ein Übersichtsbebauungsplan für die Gemeinde Lindenhorst und ein Kanalisationsplan für diese Gemeinde wurden ebenfalls vom Kreisvermessungsamt bearbeitet. Die Gemeinde Brambauer gab die Bearbeitung eines Kanalisationsprojektes in Auftrag. Bei den Bürgersteig- und Kanalisationsanlagen an den Provinzialstraßen wurden mehrere Verträge mit der Provinzialverwaltung getätigt.
Schulwesen
Volksschulen
Das Gesetz vom 28. Juli 1906 über die Unterhaltung der öffentlichen Volksschulen bestimmte die Gemeinden als Träger der Schullasten. Damit kamen die früher noch vielfach bestehenden Schulsozietäten in Fortfall. Zwar hatten hier die meisten Gemeinden die Schullasten schon auf den Gemeindehaushaltsplan übernommen und damit erreicht, daß auch die Schullasten nicht nur von den Familien, sondern von der Allgemeinheit und auch von den größeren gewerblichen Betrieben mit getragen werden mußten. Bei dem Inkrafttreten des Gesetzes über die Unterhaltung der öffentlichen Volksschulen am 1. April 1908 wurden die Gemeinden Eving, Holthausen, Kemminghausen und Lindenhorst als Einzelschulverbände zugelassen, während die Gemeinden Brambauer, Brechten und Lippolthausen sich zu einem Gesamtschulverband vereinigten. Die Schullasten, die wie die übrigen Gemeindelasten aufzubringen waren, erforderten in fast allen Gemeinden den größten Teil des Gesamtaufkommens der Gemeindeabgaben. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes über die Unterhaltung öffentlicher Volksschulen wurde die Neubildung der Schulvorstände und der Schulkommissionen notwendig.
Das starke Anwachsen der Schülerzahl machte die Schaffung von vielen neuen Klassenräumen notwendig. Es wurden gebaut: die 18-klassige Auguste-Viktoriaschule in Brambauer, die 12-klassige Moltkeschule in Brambauer, ein 4-klassiger Erweiterungsbau an der Luisenschule in Brechten, ein 6-klassiger Erweiterungsbau an der Moltkeschule in Eving, ein 6-klassiger Erweiterungsbau an der Bismarckschule in Eving, ein 4-klassiger Erweiterungsbau an der Luisenschule in Lindenhorst.
Bei den ausgeführten größeren Schulbauten wurden in Eving in der Moltkeschule, in Brechten in der Luisenschule und in Brambauer in der Moltkeschule große Turnhallen geschaffen. Diese Turnhallen wurden nicht allein für das Turnen der Volksschüler benutzt, sondern sämtlichen Vereinen, die der "nationalen Jugendpflege" angeschlossen waren, unentgeltlich zur Verfügung gestellt. In der Luisenschule in Brechten und in der Moltkeschule in Brambauer wurden Brausebäderanlagen geschaffen. Zur Förderung des Handfertigkeitsunterrichtes wurde in der Moltkeschule in Eving ein besonderer Raum eingerichtet und mit den notwendigen Geräten und Material ausgestattet. Der Unterricht wurde nebenamtlich von 2 Lehrern erteilt.
Gewerbliche Fortbildungsschulen
Die im Jahre 1901 eingerichtete gewerbliche Fortbildungsschule in Eving war für die gewerblich beschäftigten Lehrlinge, Gehilfen und Arbeiter bestimmt. Die Schulbesuchspflicht war durch Ortsstatut festgelegt und dauerte bis zum vollendeten 17. Lebenjahr. Sie Schule gliederte sich in 2 Klassen (Unterstufe, Mittel- und Oberstufe). Eine Trennung nach Berufen fand nicht statt. Träger der Schule war die Gemeinde, die vom Staat und dem Kreis durch Beihilfen unterstützt wurde. Infolge der Entwicklung der Gemeinde Brambauer beschloß die Gemeindevertretung die Einrichtung einer gewerblichen Fortbildungsschule, die am 02. 11.1909 eröffnet wurde.
Kirchenwesen
Bis zum Jahr 1895 gab es nur eine selbständige Kirchengemeinde im ganzen Verwaltungsbezirk, 1914 waren es 6 selbständige Kirchengemeinden. Um die Kirchenlasten aller Konfessionen in den Gemeinden mit größeren gewerblichen Anlagen auf breitere Schultern zu legen, hatten diese politischen Gemeinden einen Beitrag auf die Gemeinden übernommen, und zwar führte die Gemeinde Brambauer 30%, die Gemeinden Eving und Lindenhorst je 40% von der Einkommensteuer der Kirchenmitglieder berechnet, an die Kirchengemeinden ab. Die Einziehung der von den Kirchengemeinden erhobenen Kirchensteuer wurde von der Amtskasse gegen eine Hebegebühr besorgt.
Evangelische Kirchengemeinde Brambauer
Bis zum Jahre 1907 gehörten die evangelischen Einwohner der Kirchengemeinde Brambauer zur Kirchengemeinde Brechten. Vor der Industrialisierung hatte die Ortschaft etwa 600 Einwohner. Von diesen waren die meisten, nämlich 500, evangelisch. Als jedoch die Zeche "Minister Achenbach" im Jahre 1899 in Betrieb genommen wurde, und die Gewerkschaft mit dem Bau zweier großer Arbeiterkolonien begann, stieg die Zahl der evangelischen Einwohner so schnell, daß sie im November 1905 schon über 2500 betrug. Mit dem 1. Januar 1907 wurde von der Aufsichtsbehörde die Verbindung mit der Muttergemeinde Brechten, auf einen diesbezüglichen Antrag des Evangelischen Bürger- und Arbeitervereins zu Brambauer hin, gelöst, und die Kirchengemeinde Brambauer gegründet. Zu ihr gehörten sämtliche evangelischen Einwohner der Landgemeinde Brambauer mit Ausnahme derjenigen, welche südlich vom Rellensbach und an der Holthauserstraße wohnten. Am 4. Juli 1909 konnte eine neue Kirche ihrer Bestimmung übergeben werden.
Katholische Kirchengemeinde Brambauer
Die katholische Pfarrgemeinde Brambauer umfaßte die politische Gemeinde Brambauer und einen Teil der Gemeinde Groppenbruch. Die Einwohner von Brambauer gehörten vor der Reformation zur Pfarrgemeinde Brechten. Nach der Reformation hielten sich die wenigen Katholiken zu den nächstliegenden katholischen Pfarreien Waltrop, Lünen-Altstadt-Mengede. Nach der Aufteilung des Gemeindebesitzes der Königsheide im Jahre 1821 siedelten sich mehrere Katholiken an, die sich ebenfalls zur nächstgelegenen Kirche hielten, meist zu Waltrop oder Mengede. Seit 1824 wurden dann langwierige Verhandlungen zwischen den Pfarrern von Waltrop (Diözese Münster) und Mengede (Diözese Paderborn) geführt, welcher Pfarre die Katholiken in Brambauer zuzuweisen seien. Eine Entscheidung wurde nicht getroffen, zumal geschichtlich die Gemeinde Brambauer keiner dieser Pfarreien zugehörte. Mit der Anlage der Zeche "Minister Achenbach" im Jahr 1897 stieg die Zahl der Katholiken rasch. Die bischöfliche Behörde in Paderborn entschied die Streitigkeiten über die kirchliche Zugehörigkeit in dem Sinne, daß der damalige Pfarrer Bukes in Mengede den Auftrag erhielt, die Seelsorge der zugezogenen Katholiken in Brambauer zu übernehmen. Demzufolge errichtete die Pfarrgemeinde Mengede in Brambauer 1902 eine Vikariestelle. Nach längeren Verhandlungen wurden dann alle Katholiken durch die kirchlichen und staatlichen Behörden der Pfarrei Mengede zugewiesen und sofort hinterher wurde der Bezirk der politischen Gemeinde Brambauer und der angrenzende Teil der Gemeinde Groppenbruch zur Pfarrei erhoben mit Wirkung vom 01.06.1911. Als Abfindung mußte die junge Pfarrgemeinde nach Mengede die Summe von 10000 Mark bezahlen, obwohl rechtlich das Gebiet vorher nicht zur Pfarrei Mengede gehört hatte. Da die am 06.05.1903 eingeweihte Notkirche seit längerer Zeit den Bedürfnissen nicht mehr genügte, wurde der Bau einer geräumigen neuen Kirche beschlossen. Die Gemeinde Brambauer hatte 1914 rund 6000 Katholiken, davon waren 1/4 Polen und 1/4 anderer Herkunft (Tschechen, Slowenen, Slovaken, Kroaten, Ungarn, Serben, Ruthenen, Italiener, Holländer).
Evangelische Kirchengemeinde Brechten
Von der Kirchengemeinde Brechten wurden Gahmen und Lindenhorst abgetrennt. Seitdem im Jahre 1905 Brambauer von der Muttergemeinde losgelöst worden war, blieb ein Bestand von 2500 Mitgliedern übrig. Die im Jahre 1338 erbaute alte Kirche wurde vor 1914 von Außen und Innen aufgeputzt.
Evangelische Kirchengemeinde Eving
Die Kirchengemeinde wurde am 01.04.1895 gegründet. Zwar hatte ein im Jahre 1892 gegründeter Kirchenbauverein sich einen günstig gelegenen Bauplatz gesichert und auch einige Mittel gesammelt, doch konnte erst im Jahre 1898 mit dem Bau der Kirche begonnen werden. Am 25.07.1899 wurde sie eingeweiht. In denselben Jahren wurde auch das erste Pfarrhaus gebaut.
Katholische Kirchengemeinde Eving
Zur katholischen Kirchengemeinde Eving gehörten die Katholiken der politischen Gemeinden Eving, Lindenhorst, Brechten und Kemminghausen. Für alle diese bestand nur eine Kirche in Niedereving aus dem Jahre 1890, die 1905 durch einen Erweiterungsbau vergrößert wurde. Die Zunahme der Bevölkerung in Obereving, hauptsächlich infolge der Kolonieanlage der Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Gesellschaft, machte im Jahre 1912 die Einrichtung eines besonderen Gottesdienstes nötig (im Berchemschen Saale) und drängte zum Bau einer zweiten Kirche (Notkirche). Die Zahl der Katholiken betrug 1905 4980 und 1913 6486.
Evangelische Kirchengemeinde Lindenhorst
Die evangelische Kirchengemeinde Lindenhorst war im Jahr 1904 aus der alten Kapellengemeinde entstanden. Zwar stagnierte die Anzahl der evangelischen Christen bei 1000 und wurde von der katholischen Bevölkerung, die stetig zunahm, weit überflügelt, gleichwohl hatte die Gemeinde zuerst im Jahr 1906 ihr Pfarrhaus fertiggestellt und 1912 neben der Kirche ein kleines Gemeindehaus errichtet. Im Jahre 1913 wurde die alte Kapelle zu einer neuromanischen Kirche vollständig umgebaut.
Polizeiverwaltung
Organisation
Als Polizeibeamte waren tätig: 1 Polizei-Kommissar, 1 Polizei-Wachtmeister und 11 Polizei-Sergeanten. Wegen der "ländlichen Verhältnisse" wurden auch Polizeihunde im Dienst verwendet. Alljährlich fanden Revolverübungsschießen sämtlicher Polizeibeamten und eine Vorführung der Polizeidiensthunde statt.
Vereinswesen
1914 gab es im Amt Eving 4 Kriegervereine, 15 Gesangvereine, 11 Turnvereine, 7 Knappenvereine, 8 Dilettantenvereine, 18 Lotterievereine, 15 Polen- u. religiöse Vereine, 85 verschiedene Vereine: Kegel-, Skat-, Sport-, Theater-Vereine
Gesundheitsvorsorge
Die Untersuchung von Nahrungs- und Genußmitteln erstreckte sich größtenteils auf die Vornahme von Milchrevisionen, welche durchschnittlich monatlich 1-2 mal durch Beamte des chemischen Untersuchungsamtes für den Landkreis Dortmund sowie, durch den Amtstierarzt B. Meyer in Eving getätigt wurden.
Die Schlachtvieh- und Fleischbeschau wurde vom 1. April 1905 bis 26. September 1907 durch den Amtstierarzt Hans Frickinger, vom 27. September 1907 bis 1914 vom Schlachthof-Tierarzt Gustav Meyer in Bochum ausgeübt.
Schornsteinkehrbezirk
Das Amt Eving bildete seit Bestehen desselben (1.4.1905) einen Kehrbezirk. Die Funktionen als Schornsteinfegermeister nahm seit diesem Tage der Schornsteinfegermeister Theodor Freund in Eving wahr.
Handhabung der Maß- und Gewichtspolizei
Die auf Grund der am 1. April 1912 in Kraft getretenen neuen Maß- und Gewichts-Ordnung für das Deutsche Reich vom 30. Mai 1908 festgesetzten Nacheichtage wurden in Eving und Lindenhorst für die Gemeinden Eving, Kemminghausen, Lindenhorst, Holthausen, Ellinghausen und Nette (die letzten beiden Gemeinden gehören zum Amte Mengede) am 2. 3. 4 und 5. Februar 1914 in der Wirtschaft Backhaus, Eving und am 7. und 9. Februar 1914 in der Wirtschaft Frank in Lindenhorst abgehalten. Es beteiligten sich hieran rund 80% der in Frage kommenden Gewerbetreibenden.
Bildung eines Amtsgerichtes in Lünen
Durch Gesetz vom 10. Juni 1907 wurde in Lünen ein Amtsgericht errichtet. Vom Amt Eving erfolgte die Zuteilung der Gemeinden Brambauer und Lippolthausen, die seit dem 1. April 1912, dem Tage des Inkrafttretens des Gesetzes, der neuen Gerichtsbarkeit unterstellt waren.
Schiedsmänner
Der Bezirk umfaßt die Gemeinden Eving, Lindenhorst und Holthausen, Brambauer Bezirk I (westlicher Teil der Brechtener und Waltroperstraße), Brambauer Bezirk II (östlicher Teil der Brechtener und Waltroperstraße), Brechten, Lippholthausen.
Verkehrswesen
Ein über viele Jahre erstrebter Eisenbahnanschluß der Orte Eving, Brechten, Brambauer usw. blieb bis 1914 ohne Erfolg.
Die Straßenbahnlinie Fredenbaum - Zeche Minister Achenbach wurde am 14.12.1904 und die Strecke Fredenbaum Derne-Lünen am 17. 01.1905 dem Betrieb übergeben. Eine Ausgestaltung der letzteren Linie erfolgte durch den Ausbau der Strecke Westfalenburg - Schulte-Rödding, die im August 1908 eröffnet wurde.
Gemeindebetriebe
Amtssparkasse
Die Amtsversammlung des Amtes Eving beschloß 1905, für das Amt Eving eine neue Sparkasse zu errichten, die am 01.07.1907 im Amtshause eröffnet wurde.
Elektrizitätswerk der Gemeinde Eving
Im Jahre 1902 schloß die Gemeinde Eving mit der Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Gesellschaft einen Vertrag, wonach sich diese verpflichtete, der Gemeinde Eving elektrische Energie für den Bedarf der Gemeinde und der Gemeindeeingesessenen zu liefern. Die Gemeinde stellte das Leistungsnetz her und übernahm dessen Unterhaltung.
Wasserwerk Eving
Das Wasserwerk der Gemeinde Eving wurde im Jahre 1895 eingerichtet. Mit dem damaligen Wasserwerk Unna (1914 Wasserwerk für das nördliche westfälische Kohlenrevier in Gelsenkirchen) wurde ein Vertrag geschlossen. Die Gemeinde Eving baute das Rohrnetz in der Gemeinde aus und übernahm die Wasserabgabe an die Gemeindeeingesessenen für eine Rechnung.
Gemeindegasthaus Brambauer
Die schnelle Entwicklung der Gemeinde Brambauer veranlaßte viele Anträge auf Erteilung der Genehmigung zum Betriebe von Gast- oder Schenkwirtschaften. Die Gemeinde Brambauer erhielt selbst eine Genehmigung zu einem Wirtschaftsbetrieb, wofür ein Gebäude des Bauunternehmers Rieser, Ecke der Lüner- und Hospitalstraße angekauft und durch kleine bauliche Aenderungen für diese Zwecke hergerichtet wurde. Am 01.01.1907 wurde der Wirtschaftbetrieb eröffnet. Die Führung der Wirtschaft erfolgte durch einen Verwalter, die Kassen- und Rechnungsführung wurde durch den Gemeindekassenrendanten besorgt, während die Kontrolle vom Amt ausgeübt wurde.
Karten:
1) Die neuen Dortmunder Stadtteile
Eving, Kemminghausen und Lindenhorst
[Stadtplan zum Adreßbuch Dortmund 1915]
(Stadtarchiv Dortmund, Bestand 200/01 Nr.0/47-1)
2) Die Gemeinden des Amtes Eving, um 1907
[Topogr. Karte M. 1 : 25 000, Landesaufnahme 1892, mit Berichtigungen 1907]
(Stadtarchiv Dortmund, Bestand 200/05 Nr. 14/6)
3) Die Gemeinden des Amtes Eving, um 1914
(Stadtarchiv Dortmund, Bestand 200/01 Nr. 0/87)
- Bestandssignatur
-
22
- Kontext
-
Stadtarchiv Dortmund (Archivtektonik) >> Amtliche Überlieferung >> Zeitraum 1803 - 1929 >> Eingemeindete Orte, Kreis- und Gemeindeverbände >> Gemeinden und Gemeindeverbände
- Bestandslaufzeit
-
[1823-01-01/1927-12-31]
- Weitere Objektseiten
- Geliefert über
- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs
- Letzte Aktualisierung
-
23.06.2025, 08:11 MESZ
Datenpartner
Stadtarchiv Dortmund. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Bestand
Entstanden
- [1823-01-01/1927-12-31]