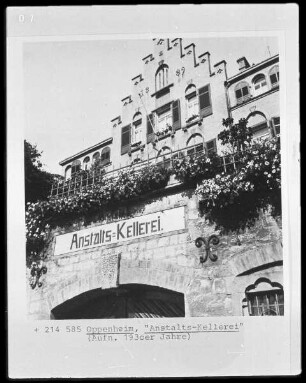Bestand
Anstalts-KG Stift Keppel (Bestand)
Ev. Anstaltskirchengemeinde Stift KeppelDas Archiv der Evangelischen Anstaltskirchengemeinde Stift Keppel wurde im November 2021 im Landeskirchlichen Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen verzeichnet. Es umfasst insgesamt 35 Verzeichnungseinheiten, die sich über den Zeitraum von 1930 bis 1991 erstrecken. Die Überlieferung deckt hauptsächlich die Zeit des Bestehens der Anstaltskirchengemeinde von 1950-1975 ab und beinhaltet in erster Linie Unterlagen der allgemeinen Verfassung und Organisation sowie der Vermögensverwaltung der Anstaltskirchengemeinde.Das Gemeindearchiv wird bei der Kirchengemeinde Hilchenbach verwahrt, in der die Anstaltskirchengemeinde Stift Keppel aufging.I. Eckdaten zur Gemeinde- und StiftsgeschichteDie Gründung des Stiftes Keppel geht bis in das 13. Jahrhundert zurück. Im Jahr 1239 gegründet, entwickelte es sich zunächst zu einem aufstrebenden Standort des Prämonstratenserordens. Nach Einführung der Reformation durch Graf Wilhelm den Reichen von Nassau erfolgte zunächst eine Säkularisierung des Klosters, indem ein freiweltliches adeliges Damenstift eingerichtet wurde. Im Zuge des Dreißigjährigen Krieges gelangte Stift Keppel kurzzeitig in Folge der Rekatholisierung des Siegerlandes an die Jesuiten, bis es 1650 als reformiertes Damenstift rekonstituiert wurde. Durch die Konversion des Landesherrn Graf Johann des Jüngeren zu Nassau-Siegen zum Katholizismus wurde ein Simultaneum mit katholischen und reformierten Stiftsdamen eingerichtet.Mit der napoleonischen Herrschaft wurde das Stift im Jahr 1812 aufgehoben, eine seit 1819 bestehende Stiftung Geseke-Keppel setzte sich weiterhin für die Unterstützung bedürftiger Damen ein. Die Stiftskirche wurde nachweislich von 1839 bis 1846 durch die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Hilchenbach genutzt, seit 1844 bis zum Jahr 1900 war sie Sitz einer katholischen Missionsgemeinde, die in Stiftsräumen auch eine Volksschule betrieben.1871 wurde die „Keppelsche Schul- und Erziehungsanstalt“ als Mädchenschule mit Internat eingerichtet. Die Schule, die kurze Zeit später um ein Lehrerinnenseminar erweitert wurde, stand unter der Schirmherrschaft von Elisabeth Ludovika von Bayern, Königin von Preußen. Unter dem Einfluss des Nationalsozialismus wurde Keppel in eine Frauenoberschule umgewidmet. Nach dem Zweiten Weltkrieg, an dessen Ende das Stift als Hospital genutzt wurde, wurde Stift Keppel zunächst von den Besatzungsmächten beschlagnahmt, der Lehrbetrieb konnte kurze Zeit später wieder aufgenommen werden. Seit 1977 wird die Lehrtradition in einem öffentlich-stiftischen Gymnasium für Mädchen und Jungen fortgeführt.Kurz nach der französischen Besetzung wurden die evangelischen Gottesdienste für beinahe 40 Jahre ausgesetzt. Unter diesem Einfluss versuchte das Stift Keppel eine Stelle für einen weiteren Pfarrer einzurichten, um diesen auf Gottesdienste in der Stiftskirche zu verpflichten und strebte in der Folge immer stärker den Status einer eigenständigen Kirchengemeinde an. Eine Auspfarrung scheiterte mehrmals an der fehlenden Zustimmung der Nachbargemeinden oder Vorbehalten der zuständigen Regierungsstellen.Erst zum 1. April 1950 wurde eine Evangelische Anstaltskirchengemeinde Stift Keppel gegründet, die die auf dem Gebiet der Erziehungs- und Schulanstalt Stift Keppel wohnenden Evangelischen vereinigte, die zuvor der der Kirchengemeinde Hilchenbach angehörten. Die Leitung der evangelischen Anstaltskirchengemeinde wurde dem Stiftspfarrer übertragen, der dazu vom Stiftskurator berufen wurde und von der Evangelischen Kirche von Westfalen bestätigt wurde. Nach dem Ausscheiden von Pfarrer Martin Kornfeld im Jahr 1972 konnte die Pfarrstelle nicht wiederbesetzt werden. Der Presbyteriumsvorsitz wurde kommissarisch von Pfarrer Köster aus Dahlbruch ausgeübt. Bereits im Jahr 1971 hatte das Presbyterium für eine Zusammenlegung der Stiftsgemeinde mit der Kirchengemeinde Hilchenbach/Allenbach in Bezug auf die pfarramtliche Versorgung votiert. Weitere Abgänge aus dem Presbyterium 1973 konnten nicht kompensiert werden, wodurch die Beschlussfähigkeit eingebüßt wurde. Als Folge wurde 1975 die Aufhebung der eigenständigen Anstaltskirchengemeinde beschlossen. Die Mitglieder waren fortan wie in der Zeit vor 1950 der Kirchengemeinde Hilchenbach angehörig.II. Bearbeitung und Nutzung des ArchivsZu Beginn der Verzeichnungsarbeiten lag das Schriftgut überwiegend als lose Blätter in Mappen vor. Die Mappen trugen keine Aktenzeichen, sondern waren mit handschriftlichen Anmerkungen zu sachthematischen Gruppen zusammengefasst. Die einzelnen Akten hatten keine Einbindung in einen Registraturplan erfahren. Bei der Verzeichnung bot sich daher eine einheitliche Neuordnung und Klassifikation des gesamten Bestandes in Anlehnung an die vorgefundenen Ordnungen an.Der Bestand wurde unter Zugrundelegung internationaler Verzeichnungsgrundsätze nach ISAD (G) erschlossen. Bei der Verzeichnung erhielten die Akten fortlaufende Nummern, die als gültige Archivsignaturen in der Bestellsignatur jeder Verzeichnungseinheit als letzte arabische Nummer oder im Findbuch ganz links neben dem jeweiligen Aktentitel aufgeführt sind. Unterhalb des Aktentitels geben die Vermerke „Enthält, Enthält nur, Enthält u.a., Enthält v.a., Enthält auch“ eingrenzende oder weiterführende Auskünfte über den Inhalt. Unter „Darin“ sind besondere Schriftgutarten wie Druckschriften, Presseberichte, Bauzeichnungen oder Fotos aufgelistet.Sofern die Benutzung nicht zu Verwaltungszwecken erfolgt, unterliegen gemäß Kirchengesetz zur Sicherung und Nutzung von kirchlichem Archivgut in der Evangelischen Kirche der Union vom 6. Mai 2000 (ArchG) sämtliche Archivalien einer 30-jährigen Sperrfrist (gerechnet nach Ende ihrer Laufzeit). Außerdem gilt für alle personenbezogenen Archivalien zusätzliche Sperrfristen gemäß § 7 ArchG. Diese Archivalien dürfen auch nach Ablauf der allgemeinen Sperrfrist erst 10 Jahre nach dem Tod der betreffenden Person eingesehen werden. Ist das Todesdatum nicht feststellbar, bemisst sich diese Frist auf 90 Jahre nach der Geburt.Kassiert wurde nicht archivwürdiges Schriftgut im Rahmen der Aufbewahrungs- und Kassationsordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 20.02.2003 in der Fassung vom 29.10.2020 bzw. des Aufbewahrungs- und Kassationsplans der EKvW vom 29.10.2020.Bei der Zitierung des Archivbestandes ist anzugeben: Archiv der Anstaltskirchengemeinde Stift Keppel Nr. ... (hier folgt die Archivsignatur des entsprechenden Archivales). Literatur: Murken, Jens: Die evangelischen Gemeinden in Westfalen. Ihre Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. Band 2: Ibbenbüren bis Rünthe (Schriften des Landeskirchlichen Archivs der Evangelischen Kirche von Westfalen Bd. 12), Bielefeld 2017, S. 84-87.
- Bestandssignatur
-
FB
- Kontext
-
Landeskirchliches Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen (Archivtektonik) >> 10. Archive bei kirchlichen Körperschaften >> 10.2. KG Kirchengemeinden >> 10.2.21. Kirchenkreis Siegen
- Bestandslaufzeit
-
1930-1991
- Weitere Objektseiten
- Geliefert über
- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs
- Letzte Aktualisierung
-
23.06.2025, 08:11 MESZ
Datenpartner
Evangelische Kirche von Westfalen. Landeskirchliches Archiv. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Bestand
Entstanden
- 1930-1991