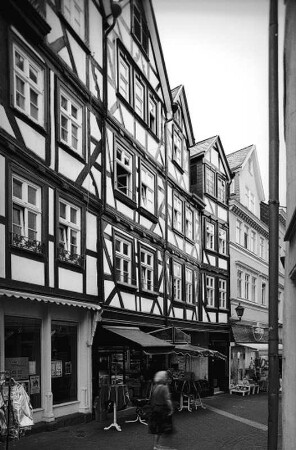Baudenkmal
Sachgesamtheit jüdischer Friedhof; Wetzlar, Bergstraße (WZ)
Urkundliche Erwähnungen einer jüdischen Gemeinde in Wetzlar finden sich seit dem 13. Jahrhundert. Die Gemeinde war jedoch recht klein und bestand offensichtlich zeitweise nur aus ein bis zwei Familien. Nach den Pogromen der Pestjahre erschienen gegen Ende des 14. Jahrhunderts auch in Wetzlar wieder jüdische Familien. Wegen der wirtschaftlichen Stagnation der Stadt blieb jedoch die Anzahl der Wetzlarer Juden immer recht klein. Erst im 18. Jahrhundert, als Wetzlar durch den Zuzug des Reichskammergerichtes einen starken Aufschwung erlebte, wuchs auch die jüdische Gemeinde der Stadt wieder an und erreichte schließlich eine Zahl von etwa 100 Personen. Nach der Auflösung des Reichskammergerichtes ging auch die Zahl der jüdischen Familien in Wetzlar wieder leicht zurück. Dennoch erhielten sie 1810 durch Karl Theodor von Dalberg die völlige Gleichstellung, die sie sich jedoch durch Zahlung erheblicher Ablösesummen erkaufen mußten. 1811 wurden die Juden durch den Großherzog veranlasst, deutsche Namen anzunehmen. Seither sind Familien wie die Budge, Flörsheim und Heertz in Wetzlar in verschiedenen wichtigen Positionen nachweisbar. Ihre endgültige Gleichstellung erhielten die Juden 1848 durch die preußische Regierung. Bis 1933 lebten etwa 147 jüdische Einwohner in der Stadt. Durch Auswanderung verringerte sich die Zahl in den nächsten Jahren immer weiter, die übrigen Personen wurden 1942 von Frankfurt aus deportiert. Im Mittelalter befand sich das Judenviertel mitten in der Altstadt. Ihre Wohnstätten lagen zwischen der Lahnstraße und dem Fischmarkt. An der Lahnstraße befand sich wohl auch die älteste Synagoge. 1535 errichtete man eine neue Judenschule am Kornmarkt. 1756 konnte die Gemeinde dann in einem umgebauten Wohnhaus eine neue Synagoge an der Pfannenstielsgase (Nr. 8) einrichten, nachdem die Stadt zuvor den Antrag abgelehnt hatte und man erst ein Urteil vom Kammergericht erwirken mußte. Die Synagoge wurde bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts benutzt. 1938 wurde die gesamte Inneneinrichtung zerstört und das Gebäude in der Folgezeit als Gefängnis für französische Kriegsgefangene genutzt. 1945 erlebte die Synagoge noch einmal ein kurze Renaissance. Durch die amerikanischen Militärbehörden wurde sie wieder zu Gottesdienstzwecken für Displaced Persons (DPs) jüdischen Glaubens genutzt. In den 50er Jahren wurde das Gebäude dann als Lagerraum genutzt und 1958 abgerissen. Die jüdische Gemeinde der Stadt Wetzlar verfügt erst seit dem 16. Jahrhundert über eigene Friedhöfe. Bis ins 16. Jahrhundert wurden alle in Wetzlar ansässigen Juden in Frankfurt beerdigt. Erst als die Frankfurter Gemeinde dies untersagte, mußte man sich in Wetzlar nach einer Beerdigungsmöglichkeit umsehen. Zunächst schaffte man die Verstorbenen aus der Stadt nach Dalheim und begrub sie in dem verlassenen Dorf. Erst seit dem 18. Jahrhundert verfügt die Gemeinde über einen stadtnahen Friedhof. Dieser wurde direkt außerhalb der inneren Stadtmauer neben dem Silhöfer Tor im Zwinger angelegt. Dieser Friedhof wurde 1880 geschlossen und durch einen neuen an der Bergstraße ersetzt. Auf dem alten Friedhof befanden sich noch in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts eine große Anzahl hebräisch beschrifteter Grabsteine. 1939 errichtete man auf dem Gelände einen Bunker, dem ein großer Teil des Friedhofes zum Opfer fiel. Von den über 300 Grabsteinen blieben so nur wenige erhalten. 1882 eröffnete man den neuen Friedhof an der Wuhlgrabenstraße (heute Bergstraße). Wie bei jüdischen Begräbnisplätzen üblich, war auch der Wetzlarer Friedhof nicht parkartig gestaltet, sondern lediglich baumbesetzter Begräbnisplatz. Umgeben ist der Friedhof von einer Bruchsteinmauer, in die zur Bergstraße ein von Pfeilern flankiertes Tor eingelassen ist. Die äußeren Pfeiler sind mit stilisierten Palmblättern bekrönt, die Inneren mit Inschriftenplatten versehen (Jesaia 20 / 19: "Lass aufleben Deine Toten, meine Leichen erstehen. Erwachet und jubelt, die Ihr ruhet im Staube"). Mehrere Reihen formal stark differenzierter Grabsteine aus der Zeit zwischen 1882 und den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts prägen den Friedhof durch ihre unterschiedliche Gestaltung. Obelisken und klassizistische Tempelformen mit einfachem Blumenornament prägen die vielfach stark verwitterten Sandsteine. Auffällig anders ist lediglich der schwarze, polierte Grabstein der Familie Heimann Rosenthal aus der Zeit des Ersten Weltkrieges, dessen stark stilisierte klassische Form dem Monument ein fast expressionistisches Äußeres verleiht. Bis zum Jahre 1940 fanden hier 115 Beerdigungen statt. Die Gräber verfügen nahezu alle über deutschsprachige Inschriften. Am Rand des Friedhofes befinden sich sie Gräber der DPs, die hier nach 1945 beerdigt wurden.
- Location
-
Bergstraße (WZ), Wetzlar, Hessen
- Classification
-
Baudenkmal
- Last update
-
04.06.2025, 11:55 AM CEST
Data provider
Landesamt für Denkmalpflege Hessen. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Baudenkmal