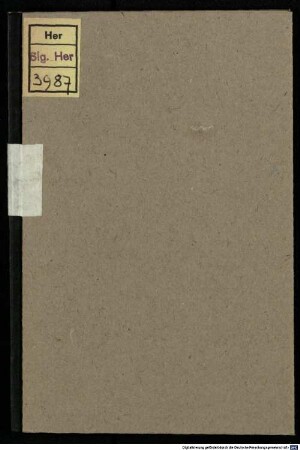- Location
-
Landesarchiv Thüringen – Hauptstaatsarchiv Weimar#Kunst und Wissenschaft - Hofwesen
- Extent
-
124
- Notes
-
Neue Berliner Musikzeitung 18 (Nr. 16, 20.4.1864), S. 123f.: „Die Statue", romantisch-komische Oper in drei Aufzügen von Michel Carré und Jules Barbier, übersetzt von Dräxler-Manfred und Ernst Pasqué, Musik von Ernst Reyer. Während wir über die erste Opernnovität, die unsere Hofbühne in dieser Saison brachte, Ferd. Hiller's „Katakomben" uns mehr abfällig äussern mussten (es erlebte das genannte Werk nur zwei Aufführungen und scheint für immer ad acta gelegt zu sein), können wir uns über die vorgenannte Oper eines bisher uns unbekannten Künstlers bei weitem günstiger aussprechen. Das Libretto, dem Märchen-Cyclus „Tausend und eine Nacht" entnommen, ist zwar noch in dem Genre der älteren Operntexte mit Dialog gehalten und ist trotz seiner vier Väter nicht gerade von besonderer Bedeutung, aber dennoch hat es dem Componisten Veranlassung gegeben, sein wirklich bedeutendes Talent aufs glänzendste zu documentiren. Die Musik ist originell (obwohl dieselbe ein tüchtiges Studium der Werke von Weber, Berlioz, Mendelssohn, Meyerbeer und Wagner verräth), feurig und glänzend, und was dabei die Hauptsache ist, charakteristisch, ohne in's Bizarre zu fallen. Die Hauptmotive der Oper sind im Ganzen fasslich, obwohl der Componist nicht im Geringsten Concessionen an den schlechten Geschmack des Publikums gemacht hat — von sinn- und geschmacklosen Rouladen oder effecthaschenden Cadenzen ist nicht im Entferntesten die Rede. Die Instrumentation ist eine sehr vorzügliche, feine und geistreiche zu nennen. Besonders interessant ist der rhythmische Theil der Oper. Die Accompagnements des Orchesters sind obligat und machen das Werk ungeübtem Kapellen ziemlich schwierig, wie überhaupt dasselbe, besonders auch in gesanglicher Hinsicht, nur gut geschulten Kräften zugänglich ist. Da die neue Erscheinung Festoper (zum Geburtstage unserer kunstsinnigen Frau Grossherzogin Sophia) war, so darf es nicht Wunder nehmen, dass die scenische Ausstattung, die Costume etc. möglichst glänzend und charakteristisch waren, wie denn die ganze Darstellung unter Musikdirector E. Lassen's sicherer und geistvoller Direction, eine sehr zufriedenstellende genannt zu werden verdient, was auch von der zwei Tage nachher (10 April) stattgefundenen Wiederholung mit einigen Einschränkungen gesagt werden muss. Die Besetzung der Oper war eine sehr gute, namentlich verdienen Fr. v. Milde (Margiana), Hr. Meffert (Selim), Hr. v. Milde (Amyod, sein Schutzgeist), Hr. Schmidt (Kalum Baruch), Hr. Knopp (Muck, Selim's Sclave), vorzügliches Lob. Erstere wurde schon im ersten Acte bei offener Scene und dann später zweimal mit dem Componisten und Hrn. Meffert stürmisch gerufen. Der Theaterchor zeigte auch hierbei seine schon oft gerügte numerische Schwäche. Nach diesen allgemeinen Bemerkungen wollen wir versuchen, das Werk in gedrängtester Weise zu skizziren. Der erste Aufzug wird eingeleitet durch eine charakteristische Introduction, deren Motive der Oper entnommen sind. Nach Aufgeben des Vorhanges ertönt der anmuthige Chor: „0 balsamische Luft" mit einer reizenden Orchesterbegleitung im Polonaisenstil. Selim und seine Genossen lagern, den Wirkungen des Opiums hingegeben, in träger Ruhe. Da erscheint plötzlich Selim's Schutzgeist und ermahnt Selim, diesem trägen Traumleben zu entsagen, da er ihm, trotz seines übersättigten Treibens, dennoch Höheres und Besseres bieten könne, wenn er nur folgen wolle. Selim verspricht seinem Traumleben zu entsagen und macht sich zur Reise nach Baibeck bereit, während der anmuthige Eingangs-Chor von neuem erklingt. Bei der scenischen Verwandlung ertönt ein längeres Orchester-Zwischenspiel, welches das Auftreten Margiana's in vorzüglicher Weise motivirt. Mergiana besingt in einer einfachen innigen Romanze die frische, labende Quelle, zu welcher sie hinabsteigt. Inzwischen kommt Selim auf seiner Reise ganz ermattet herbeigewankt, Muck, Selim's Sclave, singt über ihr beiderseitiges Reiseungemach ein pikantes Strophenlied: „Lieber will ich hängen" und tröstet sich erst dann, als er von Margiana gespeist und getränkt wird, worauf er sich rasch entfernt. Auch Selim wird von Margiana erquickt und bittet, dass sie den Schleier heben möge, damit er sich ihr Bild in sein Herz einprägen könne. Nach längerer Weigerung bewilligt Margiana diese Gunst. Der Eindruck, den sie auf Selim macht (auch ihr ist Selim nicht gleichgültig), ist überraschend und beide sprechen ihre Gefühle in einem längerem Duette aus, das vielleicht einige Kürzungen vertragen könnte; die schöne Steigerung am Schlüsse wird dann noch bedeutender hervortreten. Margiana verlässt Selim, worauf Amynd erscheint und Selim auf sein bevorstehendes Glück von neuem aufmerksam macht. Die von ihm gesungene Ballade: „Ein Schatz dieser Welt, viel höher gestellt als Gold und Juwelen, den Erd' und Himmel preist, ist der Schatz der Seelen, den man die Liebe heisst" wurde von Herrn v. Milde mit aller Hingabe meisterhaft gesungen. Hierauf tritt Selim, nach erhaltener Aufforderung (Geisterchor hinter der Scene) in ein düsteres Grabdenkmal, um weitere Aufschlüsse über den ihm beschiedenen Schatz zu erhalten, worauf ein sehr ansprechender charakteristischer Marsch zu dem Chore der über die Bühne schreitenden Caravane ertönt. Die zurückkehrende Margiana sucht Selim vergebens und entfernt sieh trauernd; die letzten Töne der Caravane verklingen und Selim tritt unter Donner und Blitz aus den geheimnissvollen Hallen, worauf er dem erstaunten Muck mittheilt, was er über sein in „Aussicht gestelltes" Glück erfahren habe: In jenem Himmelsaufenthalt habe er 12 Bildsäulen erblickt, „geformt von Götterband, Goldganz und Diamant" doch inmitten der zwölf ist eine Säule leer. Aus der Luft ertönen die rätselhaften Worte: „Dieses dreizehnte Bild ist unschätzbar von Werth, der Geist Amynd hat es für Dich bescheert. Doch Du selbst erwähle ein unschuldig Mädchen, heirathe sie und kehre dann wieder zurück; bringe rein sie hierher, und diese leere Säule zeigt auf dem Pindestal dann das Bild (die versprochene Statue) Deinem Blick". Selim beschwört seinem Schutzgeist Amynd diese Bedingung, obwohl Muck dabei einige Bedenken nicht zurückhalten kann, worauf ein kurzes Terzett erfolgt, woran sich dann noch einmal die Warnungen Amynd's, unterstützt vom Chore der Geister, knüpfen. Der erste Act schliesst damit, ohne besonderen Effect. — Auch dem 2. Acte ist eine kurze Introduction vorangestellt. Es erscheinen die Nachbarn des alten geizigen Krämers Kalum-Baruch, welcher seiner ihn besuchenden Nichte Margiana ein Loblied singt und den Freunden mittheilt, dass er die Holde mit seiner Hand beglücken will, worauf man, als die glückliche Krämerseele zur Hochzeit einladet, gratulirend dankt und den Bräutigam bittet, dass er Musiker und reiche Speisen besorgen möge. Dessen Freude wird nun sogleich getrübt, als Muck, auf Amynd's Geheiss, um die schöne Nichte für seinen Herrn Selim freit. Kalum nimmt natürlich dieses Gesuch höchst ungünstig auf und der Freiersmann wird auf sehr unzarte Weise auf die Strasse expedirt. Während nun die Sclaven des Kalum allerhand Vorbereitungen zum Feste machen, lässt dieser Margiana rufen und erklärt, was er ihr für ein grosses Glück zugedacht habe. Diese ist natürlich nicht im Mindesten von den Liebeserklärungen des alten Kalum erfreut und weiset seine Hand, mit oder ohne Herz, entschieden zurück, indem sie in einer schönen Romanze mit grosser Arie Selim's gedenkt und ihren Abscheu gegen eine Verbindung mit dem schäbigen Onkel ausspricht. Amynd bat sich indess In einem Doppelgänger Kalum's verwandelt. Dieser erstaunt nicht wenig, als sein leibhaftes Ebenbild aus dem obern Stock seines Hauses herabsteigt und sich ganz als Eigenthümer desselben gebehrdet. Die sich aus diesem Zusammentreffen entspinnende komische Scene wurde von den Herren v. Milde und Schmidt vorzüglich ausgeführt und das Zankduett: „Allah hilf! Wer steht hier vor mir?" ist sicherlich nicht die schlechteste Nummer der Oper. Kalum eilt endlich ergrimmt hinaus, um den Eindringling durch die Häscher expediren zu lassen. Nun erscheint Selim, der den Pseudo-Kalum zur Rede setzt, warum er Muck so unliebenswürdig behandelt habe und warum er Margiana ihm vorenthalte. Kalum-Amyod erklärt dem Selim, dass er durchaus nichts gegen eine Verbindung zwischen ihm und seiner Nichte habe, worauf Selim in einer Cavatine: „Wie der Morgen beleuchtet die blühenden Bäume" das Zusammentreffen mit Margiana in der Wüste besingt. Die Nichte erscheint und wird Selim unter den bekannten Bedingungen übergeben. Die erscheinenden Nachbarn wundern sich allerdings über die plötzliche Sinnesveränderung ihres alten Freundes und wünschen schliesslich Heil und Segen. Muck trifft emsig Vorbereitungen zur Hochzeit, als der ergrimmte wirkliche Kalum mit den Häschern erscheint, die das Tragikomische: „Fort mit aller Sorgenschaar" anstimmen, woran sich Marsch und Chor der Freunde Kalum's anschliesst. Dieser bedrängt den armen Muck sehr hart, wird aber sammt den Häschern von Amynd in Musikanten verwandelt, die den netten Chor: „Die Cymbeln erklingen", wobei ein gut arrangirtes Ballet die Festivität erhöbt, accompagniren müssen. Bevor Margiana scheidet, singt sie noch ein Lied, worin sie ihr Zusammentreffen mit Selim in der Wüste schildert, worauf dieser auf seine bisher verschleierte Gattin aufmerksam wird und erbebt. Beide scheiden, Kalum wird wieder entpuppt, wird aber bis morgen früh sammt den Häschern gefangen gehalten, worauf der zweite Act abschliesst. — In der Introduction zum dritten Aufzuge wird des Samume Wuth annähernd geschildert, woran sich ein charakteristischer Chor knöpft. Auch Selim und Margiana werden von dem vernichtenden Unwetter betroffen, und hier im Angesicht des Todes fragt Margiana, warum sich Selim von ihr so entfernt halte. Selim gesteht, dass er geschworen, sie den Geistern zu opfern, und dass ihm dies, nachdem er sie wieder erkannt, entsetzlich und unmöglich sei. In einem herrlichen Duett strömen beide Liebende ihr schönes Liebesleben aus, bis Amynd erscheint und Selim an seinen Schwur errinnert; unsichtbare Geister lassen die Worte vernehmen: „Ewiger Strafe verfällt, wer seinen Schwur nicht hält". Trotzdem will Selim die Wiedergefundene nicht missen, bis sich Margiana selbst Amynd übergiebt. Der verzweifelnde Selim wird von magischem Schlaf übergössen und Margiana geht an der Hand Amynd's in den glänzenden Geistersaal. Ein reizendes Ballet blendet die Augen, als endlich Selim mit Margiana eintritt, um die versprochene Statue in Empfang zu nehmen. Nach dem schönen Chore: „In der Erde Schacht etc." steigt die „Höllengabe", wie Selim sie nennt, aus der Erde dichtverschleiert hervor, Selim will sie mit dem Schwerte zertrümmern, als die Statue den Schleier lüftet und sich als Margiana dem entzückten Selim darstellt. Die herrliche Ballade Amynd's „Ein Schatz dieser Welt etc.", chorisch erweitert, macht den effectvollen Schluss des vortrefflichen Werkes."
- Creator
- Contributor
- Published
-
1864-04-08
- Other object pages
- URN
-
urn:nbn:de:urmel-cb3f9336-bec9-4daa-a344-831f516d3e503-00034923-10
- Last update
-
01.09.2025, 12:12 PM CEST
Data provider
Landesarchiv Thüringen – Hauptstaatsarchiv Weimar. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Theaterzettel ; Text
Time of origin
- 1864-04-08