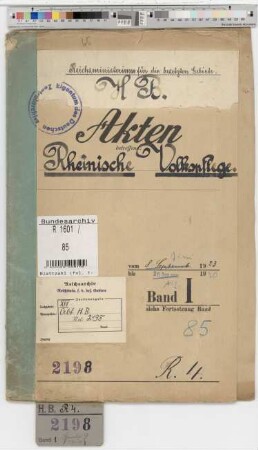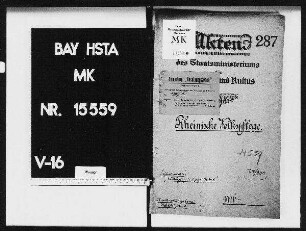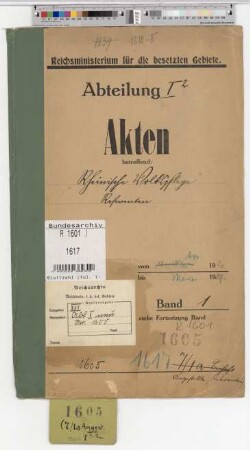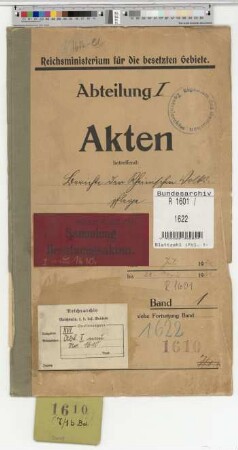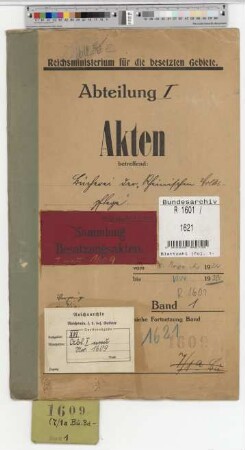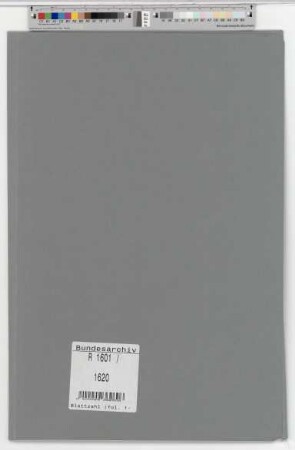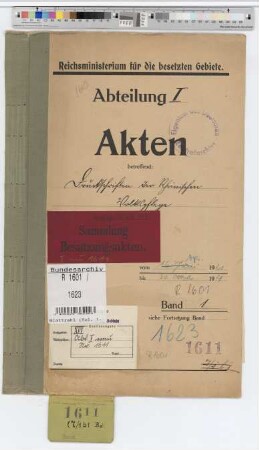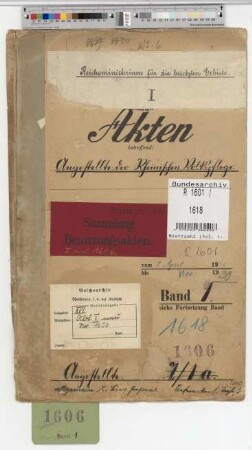Bestand
Rheinische Volkspflege (Bestand)
Geschichte des Bestandsbildners:
Seit Mai 1919 war die Reichszentrale für Heimatdienst (RfH), am 10. März
1918 gegründet als Zentrale für Heimataufklärung, als amtliche Stelle der
Reichsregierung für alle Fragen der Aufklärung "des mit
staatsbürgerlichen Rechten ausgestatteten Volkes [...] über die
wichtigsten Fragen des öffentlichen Lebens in einer objektiven und
sachlichen über allen Parteien stehenden, keiner Partei oder
Interessengruppe dienstbaren Art" zuständig. Sie war zunächst der
Presseabteilung der Reichsregierung angegliedert und unterstand damit dem
Auswärtigen Amt.
Die RfH unterhielt bis August
1919 nur vier Agenten, die der zunehmenden Arbeitsbelastung durch die
zahlreichen Separatismusbestrebungen nicht gewachsen waren, sodass ab dem
1. August 1919 zur Zusammenfassung der Aufklärung und aller pro-deutschen
Kräfte in den von den Franzosen besetzten Rhein- und Ruhrgebieten ein
neues Referat, die sogenannte Besetzte-Gebiete-Stelle ("Begestelle"
[-Referat] der RfH), unter der Leitung von Alfred von Wrochem geschaffen
wurde.
Als Kopf- und Umschlagstellen wurden
zusätzlich eingerichtet:
1) eine Hauptstelle in
Frankfurt am Main unter dem sozialistischen Gewerkschaftssekretär Max
Groger (vgl. BArch, R 1603/2288);
2) eine Stelle
in Heidelberg, zuständig für Baden und das Saargebiet, unter dem
Sozialdemokraten Arthur Wohlgemuth;
3) eine Stelle
in Darmstadt, zuständig für Rheinhessen, unter dem Landtagsabgeordneten
Loos;
4) weitere Stellen ab September/Oktober 1919
in Gummersbach (vgl. BArch, R 1603/2284), Koblenz, Limburg und
Trier.
Abhängig von diesen Stellen waren in den
Hauptorten der linksrheinischen Gebiete zusammengesetzte
Aktionsausschüsse mit Beiräten aus allen Parteien vorhanden, die jeweils
ein Mitglied zum Hauptbeirat in der Frankfurter Stelle entsandten. Die
Frankfurter Stelle wurde jedoch am 12. März 1920 wegen politischer
Schwierigkeiten Grogers aufgelöst.
1920 wurde die
Berliner Leitung der Begestelle aus Geheimhaltungsgründen örtlich von der
RfH getrennt, da infolge des Versailler Vertrages jede antifranzösische
Beeinflussung der Bevölkerung durch das Reich aufhören sollte. Die
Begestelle wurde dem Reichsministerium des Innern als Geheimstelle
angegliedert. Ein Versuch seitens des Reichsfinanzministers im Mai 1920,
die Arbeit der Begestelle in die RfH einzugliedern, scheiterte. Mittel
für praktische Kulturarbeit und Unterstützung der Presse wurden
gestrichen.
Im Juni 1920 wurde schließlich die
Begestelle in Rheinische Volkspflege (RVP) umbenannt (vgl. BArch, R
1603/2153). In einer Sitzung im Reichsministerium des Innern am 15. Juni
1920 erklärte der Leiter der RfH, Dr. Strahl, dass die RVP selbständig
unter der Pressestelle der Reichsregierung, aber nicht mit der RfH in
Verbindung stünde. Die RVP war also die unter der Pressestelle der
Reichsregierung stehende Nachfolgerin der RfH hinsichtlich der Arbeit im
besetzten Gebiet (vgl. BArch, R1603/2171).
Die
Rechnungsführung und die Leistung von Zahlungen für die RVP erfolgten
nach wie vor durch die RfH; die ab Juli 1920 bei der RVP eingerichtete
besondere Buchführung war nur eine Nebenbuchführung der RfH. Durch diese
nicht ganz eindeutige Stellung kam es zwischen der RfH und der RVP immer
wieder zu Streitigkeiten. So teilte der Leiter der RfH am 20. August 1920
der RVP mit, er sei im Einverständnis mit dem Staatssekretär der
Reichskanzlei vom Pressechef zum verantwortlichen Kommissar der RVP
bestellt; alle Berichte und Denkschriften an vorgesetzte Stellen hätten
über ihn zu gehen. Der Leiter der RVP, von Wrochem, stellte demgegenüber
unter Bezugnahme auf die erwähnte Sitzung vom 15. Juni 1920 ausdrücklich
fest, es sei "seiner Zeit die Vereinbarung getroffen worden, dass die RVP
unmittelbar der Reichskanzlei - jetzt Pressestelle der Reichsregierung -
unterstellt sein solle"; Dr. Strahl und von Loebell seien nur Kommissare
für die richtige Verwendung der Gelder (vgl. BArch, R 1603/2677).
Nach der Errichtung des Staatssekretariats für die
besetzten Gebiete im Reichsministerium des Innern im Mai 1921 und der
Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Reich und Ländern wurde die RVP
diesem Staatssekretariat unterstellt. Vorbehalten waren ihr die
zentralisierte Beobachtung der französisch-belgischen Propaganda, des
Separatismus sowie diesbezügliche Abwehrmaßnahmen (vgl. BArch, R
1603/2155, 2365). Die RVP wurde 1922 als "nachgeordnete Stelle
nichtamtlichen Charakters, deren Tätigkeitsgebiet sich nach den vom
Staatssekretär erteilten Anweisungen richtet", bezeichnet (vgl. BArch, R
1603/2153).
Die Veränderungen im Aufbau sahen so
aus, dass als Ersatz für die aufgelöste Stelle in Frankfurt am Main im
April/Mai 1920 eine neue Stelle für die oberrheinischen Gebiete in
Mannheim unter Josef Seufert gebildet wurde (vgl. BArch, R 1603/2155,
2223). Diese kooperierte eng mit dem Saarausschuss und arbeitete auch von
Mainz aus. Seit Mai 1920 ersetzte Mannheim auch die Umschlagstelle
Darmstadt, denn dort liefen die Fäden der Propagandastellen des besetzten
Gebietes zusammen; Wünsche und Anträge wurden gesammelt und von dort nach
Berlin weitergegeben.
Die Kölner Außenstelle wurde
ab dem 1. Juli 1920 wegen Störung und Gefährdung durch die Besatzung nach
Düsseldorf verlegt.
Bereits im Juli/August 1920
kam es zur Auflösung sämtlicher Zweigstellen (vgl. BArch, R 1603/2155),
sodass die Arbeit zunehmend durch die großen Parteien, besonders die SPD,
und die Verbände erledigt wurde. Über die Zusammenarbeit mit den
verschiedenen Verbänden, insbesondere den Gewerkschaften, gibt eine
Denkschrift vom Juli 1920 näheren Aufschluss (vgl. BArch, R
1603/2717).
1922 erfolgte eine Reorganisation der
RVP, und es fand ein Abbau der überflüssig gewordenen Stellen statt. Bei
ihrer Unterstellung unter das Reichsministerium für die besetzten Gebiete
1923 änderte sich erneut die Struktur. Die RVP trat als private
Organisation auf, und ihr Leiter war Treuhänder gegenüber der
Reichsregierung (vgl. BArch, R 1603/2158, 2157). Das Ministerium übte
eine immer strengere Aufsicht über die Geschäftsführung der RVP aus. Zu
diesem Zwecke wurden Leitern und Referenten der RVP ab April 1927 Rechte
und Pflichten von Beamten des Reichsministeriums übertragen (vgl. BArch,
R 1603/2159).
Aufgelöst wurde die RVP schließlich
am 30. September 1930, wobei die Abwicklung sich bis zum 15. Oktober 1930
verzögerte (vgl. BArch, R 1603/2169, 2578).
Bestandsbeschreibung:
Bestandsgeschichte
Die Akten der Rheinischen
Volkspflege gelangten nach ihrer Auflösung 1931 ins Reichsarchiv, wo
zunächst eine Erfassung der Akten auf Karten stattfand. Ab Sommer 1936
wurden die Karten unter nochmaliger Prüfung der gesamten Akten durch ein
Band-Verzeichnis ersetzt. Bei dieser Arbeit wurde eine nachträgliche
Kassation durchgeführt.
Die Vorakten der
Reichszentrale für Heimatdienst, die die besetzten Gebiete betreffen,
übernahm man zum Teil mit in den Bestand. Die Klassifikation der Akten
orientiert sich am Geschäftsverteilungsplan von 1923 (vgl. BArch,
R1603/2153).
Im Deutschen Zentralarchiv, später
Zentrales Staatsarchiv der DDR, wurde der Bestand unter der Signatur
16.03 verwahrt.
Nach der Wiedervereinigung 1990
wurde der Bestand Teil des Bundesarchivs, wo er die Bestandssignatur R
1603 erhielt.
Archivische Bewertung und
Bearbeitung
Das vorliegende Findbuch stellt eine
überarbeitete Fassung der offenbar ersten, durch Dr. Keinau im
Reichsarchiv geleisteten, Verzeichnung von 1937 dar, die 1951 durch J.
Brumme im Deutschen Zentralarchiv durch neue Aktensignaturen und
nachträgliche Bemerkungen ergänzt worden war. Die Archivsignaturen
beginnen nun mit R 1603/2153. Auf eine erneute Umsignierung wurde
verzichtet. Im Sommer 2008 erfolgte die Zuordnung fehlender
Aktenfragmente, um den ursprünglichen Zusammenhang der Überlieferung
wiederherzustellen. Da die Verzeichnung von 1937 nicht mehr mit heutigen
Richtlinien übereinstimmte, wurde das Bestandsverzeichnis mit Titeln,
Enthält-Vermerken und Laufzeiten überarbeitet und ergänzt. Zur
Vereinfachung der Suche nach Schlagwörtern wurde ein neuer Index
erstellt.
Für die Akten der Abteilungen I und II
des Zeitungsarchivs waren keine Laufzeiten vorhanden. Hier wurde pauschal
für alle Akten die Gesamtlaufzeit der entsprechenden Abteilung
übernommen. Es kann daher vorkommen, dass die Laufzeiten der einzelnen
Akten nicht immer den gesamten genannten Zeitraum abdecken.
Das Findbuch entstand im Rahmen der archivpraktischen
Ausbildung im Zeitraum Juni 2008 (Miriam Arold) und August 2009 (Claire
Maunoury).
Inhaltliche Charakterisierung:
Hausakten (Regelung des Dienstbetriebs, Personalakten u.a.) 1919-1930
(27), Rheinische Frauenliga 1919-1930 (84), Politische Arbeit 1919-1930
(107), Kultur 1919-1930 (94), Wirtschaft 1919-1930 (17), Eupen-Malmedy
1919-1930 (13), Saargebiet 1919-1930 (57), Bücherreferat, Bild, Film,
Vortragswesen 1919-1930 (109), Presse 1919-1930 (29), Organisation
1919-1930 (97), Kasse 1919-1930 (8), Handakten Rühlmann 1919-1930
(25),
Zeitungsausschnittarchiv 1921-1930
(212).
Die im vorliegenden Findbuch verzeichneten
Akten enthalten Schriftgut zum Dienstbetrieb und zur inneren Verwaltung
der RVP selbst, zur Rheinischen Frauenliga sowie zu verschiedenen, die
Besetzung des Rheinlands betreffenden politischen Bereichen. Es sind
zahlreiche Informationen über die Separatismusbewegungen sowie über
politische Sabotage im besetzten Gebiet festgehalten, ferner kulturelle
Angelegenheiten, wie Propaganda in Literatur, Film und Presse. Es sind
Ausarbeitungen zu Flugblättern, Broschüren und Filmen, die sich gegen die
Besatzung richten, dokumentiert, aber auch die kulturpolitische Arbeit
und Propaganda der Besatzer in Deutschland. Des weiteren finden sich
Unterlagen, die sich speziell auf die Gebiete Eupen-Malmedy und das
Saargebiet beziehen und dort die wirtschaftliche und kulturelle Lage,
insbesondere die französisch-belgische Propaganda und entsprechende
Gegenmaßnahmen, schildern.
Abgerundet wird der
vorliegende Aktenbestand durch das Zeitungsausschnittarchiv der RVP, das
sich aus 3 Abteilungen zusammensetzt. Abteilung I enthält Artikel aus dem
Zeitraum 1921-1923, die sich u.a. mit militärischen, kulturellen und
wirtschaftlichen Fragen der Rhein- und Ruhrbesetzung beschäftigen.
In den Artikeln der Abteilung II geht es insbesondere um
die deutsch-französische Außenpolitik sowie um die Räumung der besetzten
Gebiete 1924-1930, während in der Abteilung III Ausschnitte aus
französischen, englischen und italienischen Zeitungen zur Rheinbesetzung
und anderen Folgen des Versailler Vertrages gesammelt sind.
Erschließungszustand:
Online-Findbuch (2009)
Zitierweise: BArch R
1603/...
- Reference number of holding
-
Bundesarchiv, BArch R 1603
- Extent
-
874 Aufbewahrungseinheiten
- Language of the material
-
deutsch
- Context
-
Bundesarchiv (Archivtektonik) >> Norddeutscher Bund und Deutsches Reich (1867/1871-1945) >> Inneres, Gesundheit, Polizei und SS, Volkstum
- Related materials
-
Verwandtes Archivgut im Bundesarchiv: R 1601 Reichsministerium für die besetzten Gebiete
R 1602 Reichskommissar für die besetzten rheinischen Gebiete
R 43 Reichskanzlei
R 32 Reichskunstwart
R 2 Reichsfinanzministerium
R 8028 Mirbachs Telegraphisches Büro
Amtliche Druckschriften: Schütze, Karl: Französische und belgische Militärjustiz im besetzten Gebiet, Berlin 1928
Literatur: Richter, Johannes Karl: Die Reichszentrale für Heimatdienst: 1.3.1918-16.3.1933 - Geschichte der ersten staatlichen politischen Bildungsstelle in Deutschland und Untersuchung ihrer Rolle in der Weimarer Republik, Berlin 1963
- Date of creation of holding
-
1919-1930
- Other object pages
- Provenance
-
Rheinische Volkspflege, 1919-1930
- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs
- Last update
-
16.01.2024, 8:43 AM CET
Data provider
Bundesarchiv. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Bestand
Time of origin
- 1919-1930