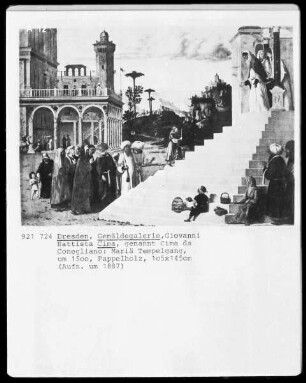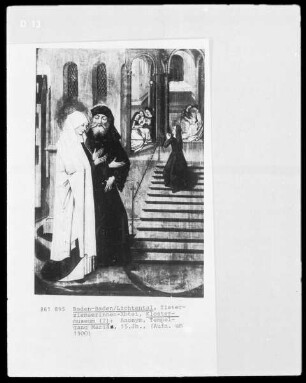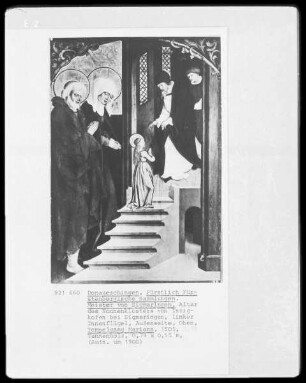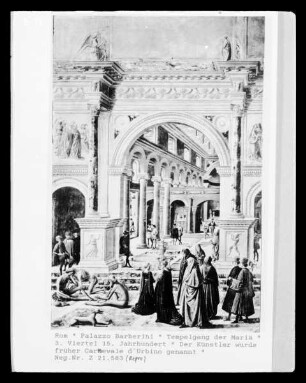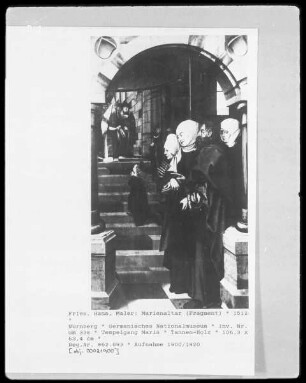Gemälde
Mariae Tempelgang
James Simon schenkte den Berliner Museen im Jahr 1904 diese beiden kleinen Tafeln, zu denen es praktisch keine bibliografischen Hinweise gibt. Die allgemeine Klassifizierung als "toskanisch (sienesisch?) Mitte 16. Jh." ist durch die mündliche Stellungnahme Philip Pounceys von 1971 gerechtfertigt, der die Tafeln als von der Hand Bartolomeo Neronis, genannt il Riccio, bezeichnete. Diese Einschätzung wurde von Erich Schleier in einem Brief vom 23. Januar 1984 bestätigt. Die Kataloge der Gemäldegalerie (1906-1931) postulierten eine generelle Einordnung als ´florentinisch, um 1530`und verwiesen auf das Umfeld des Francesco Granacci (Posse 1909). Berenson (1957) suchte den Schöpfer der beiden Predellentafeln mit "gemalter grauer Umrahmung mit Karyatiden zu beiden Seiten" hingegen weiter nördlich im Unfeld von Gerolamo da Treviso il Giovane. Da ein gewisser Zusammenhang mit der Art Neronis (seit 1532 in Siena dokumentiert und 1571 verstorben) spürbar ist, kanndem Standpunkt Pounceys teilweise zugestimmt werden (hier sei nur auf die Verwandschaft der Jungfrau in der Szene der Vermählung Mariä mit der wesentlich monumentaleren Samariterin im sienesischen Fresko Christus und die Samariterin im ehemaligen Monastero di Campansi verwiesen, das aus Prototypen Peruzzis beruht (Cornice 1976; De Marchi, in Siena 1990, S. 367 Abb 1 in Farbe). Andere Argumente sprechen jedoch für den behutsamen Vorschlag, den Schöpfer der beiden fast unbekannten Tafeln in Arezzo zu vermuten. Die rot-grün gekleidete Frau, zweite von rechts neben der Jungfrau in der Vermählung Mariä, ist von gleichem Charakter wie die Madonna in dem abgelösten Freskofragment Madonna mit segnendem Kind aus der Collegiata di Santa Maria a Cesi nahe Spoleto (Provin: Terni): Hierbei handelt es sich um eines der wenigen durch Quellen gesicherten Werke des Tomaso Bernabei aus Cortona, genannt il Papacello, der lange irrtzümlich dem Signorelli-Umkreis zugeordnet wurde (vgl. Gori Sassoli 1988, S. 17 mit Abb. 1; Kanter 1992 und demgegenüber Simonelli 2013 mit den Einflüssen Signorellis). Dieses Indiz reicht aus, um die beiden Berliner Szenen auch mit dem größten Vorhaben des Papacello zu vergleichen, der im Rom der zwanziger Jahre des Cinquecento Schpüler von Giulio Romano und somit gleichsam ein Raffaelschüler der zweiten Generation war: den Fresken im großen Saal des "Palazzone" in Cortona, Sitz foris portam des Kardinals Silvio Passerini, des wichtigsten Mäzens auch Marcillats. Dieser Freskenzyklus ist im römischen Schema des zweiten Jahrzehnts des 16. Jahrhunderts organisiert, das sich etwa in Peruzzis Sala delle Prospettive in der Villa Farnesina findet; die Szenen des oberen Frieses sind von Metopen unterteilt. Es ist offensichtlich, dass dieses Schema auch in den hier ausgestellten kleinen Tafeln Anwendung findet - als ob ihnen ursprünglich vorbereitende Funktion zukam, etwa als bozzetto oder als Modell für den Auftraggeber in der Vorbereitung eines großen Formats. Da es sich bei den vorliegenden Tafeln um zwei Marienszenen und im Passerini-Palast um Themen aus der römischen Geschichte handelt, muss sich der Bezug natürlich auf die reine Typologie beschränken und kann nicht zwingend eine gemeinsame chronologische Bestimmung nach sich ziehen. Die Fresken in Cortona werden gewöhnlich spätestens Anfang 1527 datiert, doch jene im Salon müssten schon im Laufe des Jahres 1525 ausgeführt worden sein: In dieses Jahr fiel das Fest zu Ehren des florentinischen Kardinals Pucci. Zum noch früheren Besuch Kardinald Ippolito de`Medici im Juni 1524 musste die Arbeit an den Fresken jedoch wenigstens so weit fortgeschritten gewesen sein, dass man den berühmten Gast in diesem Ambiente beherbergen konnte (Mancini 1897, S. 361; Gori Sassoli 1988, S. 22-23, 32 Anm. 24-26). Das oben erwähnte Fresko aus Cesi verweist hingegen in eine mindestens zehn Jahre reifere Schaffensphase, und seine Ausführung, die mit dem Stil der beiden Tafeln aus dem ehemaligen Besitz James Simons übereinstimmt, müsste um 1540 datieren. Akzeptiert man diese Chronologie, so bietet sich eine Verbindung mit der Freskolünette (Muttergottes mit dem Kind, der hl. Anna und dem Johannesknaben) über dem Hauptportal von Santa Maria del Calcinaio in Cortona an, die inschriftlich 1543 datiert ist und die Sassoli (1988, S. 26, 27 mit Abb. 4) zu Recht Papacello zuschreibt. Hier bestätigt die Betrachtung der Marienfigur in der Vermählung aus Berlin die typologische Übereinstimmung mit ihrem Gegenstück in Cortona. Auch die frontal gezeigte, gelb gekleidete Frau in der Szene von Mariä Tempelgang kommt der hl. Anna in der Freskolünette sehr nahe. Weitere Indizien folgen: zum Beispiel die offenkundige Affinität des Kindes außen rechts in der Vermählung Mariä, dessen hanchement sich im Putto neben dem Krieger im Freskenzyklus mit den "Storie di Barccio da Montone" in der Sala Rossa im Palazzo dei Priori in Perugia wiederholt (Santi 1985, S. 195-196; Gori Sassoli 1988, S. 28, 30 Anm. 6, 33 Abb. 22), oder aber es bezieht sich auf die Figuren im Graffito-Fries an der Fassade des Palazzo Racani in Spoleto (Sapori 1980; Gori Sassoli 1988, S. 27, 30 Abb. 18, 34 Anm. 38). Schließlich muss ein weiterer Aspekt erwähnt werden: der Wortschatz der florentinischen Maniera, der insbesondere in der Episode des Tempelgangs Mariä und vor allem in manch einer der weiblichen Figuren deutlich spürbar ist. Dieses zurückhaltende Beachten der Normen del Sartos und Pontormos könnte die Ankunft von Werken Jacones in Cortona um die Mitte der zwanziger Jahre widerspiegeln (Madonna auf dem Thron mit Heiligen in der Kirche Santa Maria del Calcinaio; dort auch eine Krönung Mariä (zerstört) und vielleicht auch die extrem am Stil Pontormos orientierte Tafel des geheimnisvollen Solosmeo in San Fedele a Poppi im Casentino, signiert und 1527 datiert. Eine Auslese der Moderne also, getroffen ipso facto von Bernabei, dem bewährten Meister des Zitats. (Roberto Contini)
- Location
-
Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin, BerlinDeutschland, BerlinDeutschland
- Inventory number
-
S.15
- Measurements
-
Bildmaß: 29,1 x 59,5 cm
Rahmenaußenmaß: 38 x 69 cm
- Material/Technique
-
Pappelholz
- Event
-
Eigentumswechsel
- (description)
-
1907 Schenkung von James Simon, Berlin
- Event
-
Herstellung
- (who)
-
Tommaso Bernabei (ca. 1500 - 1559), Maler*in
- (where)
-
Italien
- (when)
-
Ca. 1540
- Last update
-
09.04.2025, 10:13 AM CEST
Data provider
Gemäldegalerie. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Gemälde
Associated
- Tommaso Bernabei (ca. 1500 - 1559), Maler*in
Time of origin
- Ca. 1540