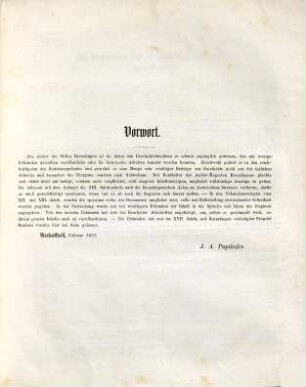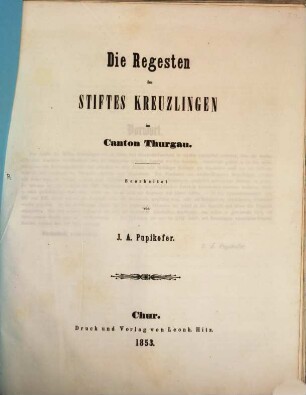Bestand
Binswanger-Archiv, Sanatorium "Bellevue", Kreuzlingen/Thurgau (Verwaltungsakten) (Bestand)
Bestandsbeschreibung: Übernommen: 1986/87
aus Privatbesitz.
Bestandsstruktur, -geschichte:
Das
Verwaltungsschriftgut ist nur zum Teil überliefert, soweit sich solche
Unterlagen zum Zeitpunkt der Schließung der Klinik im Sekretariat der Ärztlichen
Leitung befanden.
Bei der Erschließung wurde eine Aufteilung auf die
Bestände UAT 441 (Krankengeschichten), UAT 441a (Wärterprotokolle), UAT 442
(Verwaltungsakten, weiteres patientenbezogenes Schriftgut, Sammlungsgut) und UAT
443 (Nachlass Ludwig Binswanger) vorgenommen. Dabei konnten jedoch
Überschneidungen nicht vermieden werden.
Vorwort
Im Sommer
1986 hat das Universitätsarchiv Tübingen zusammen mit dem Nachlass des
Psychiaters Ludwig Binswanger (1881-1966) das Archiv des früheren
Privatsanatoriums "Bellevue" in Kreuzlingen bei Konstanz übernommen. Ein erstes
Gesamtrepertorium wurde 2002 anlässlich der vom Institut für Ethik und
Geschichte der Medizin veranstalteten internationalen Tagung "Psychiatrie in
Binswangers Klinik 'Bellevue' 1857-1950: Diagnosen - Therapie -
Arzt-Patientbeziehung" vorgelegt. Mit dieser Neubearbeitung, die damals noch
nicht bearbeitete sowie nach 2002 dem Archiv übergebene Unterlagen
berücksichtigt, soll die archivische Erschließung der Tübinger
Binswanger-Bestände zu einem vorläufigen Abschluss gebracht werden. Ein zweiter
Band mit einem Verzeichnis der Korrespondenzpartner Ludwig Binswangers steht
kurz vor dem Abschluss, während auf ein Verzeichnis der eigentlichen
Krankengeschichten aus naheliegenden Gründen weiterhin verzichtet werden
muss.
Tübingen, den 26. November 2013
Johannes Michael
Wischnath
Einleitung
1. Zur Chronologie der Familie
Binswanger und des Sanatoriums Bellevue
1.1. Ludwig Binswanger d. Ä.
(1820-1880)
25. Juni 1820 Geburt von Ludwig Binswanger d.Ä. in
Osterberg, Landgericht Illertissen in Bairisch-Schwaben, als fünfter Sohn des
jüdischen Hausierhändlers Moses Binswanger (1783-1867) aus Hürben, Landgericht
Krumbach in Bairisch-Schwaben und dessen Frau (1783-1867).
1835 -
1840 Besuch des Gymnasiums St. Stephan in Augsburg.
1840 - 1845
Studium der Philosophie in Erlangen und ab 1841 der Medizin in München und
Heidelberg.
1842 - 1843 Ignaz Vanotti (1798-1870) errichtet hundert
Meter vor der badischen Grenze für seine Verlagsanstalt "Belle-vue bei Constanz"
(Konstanz) die gleichnamige Villa.
1845 - 1846 Assistent am
Krankenhaus Augsburg unter Franz Reisinger (1787-1855), wo ihm die selbständige
Leitung der "Irrenabteilung" obliegt.
1846 Promotion. Dissertation
"Pharmakologische Würdigung der Borsäure, des Borax und anderer borsaurer
Verbindungen in ihrer Einwirkung auf den gesunden und kranken thierischen
Organismus". Staatsexamen mit der Note 1. In der Folge Mitarbeit am "Archiv für
physiologische Heilkunde". Der Eintritt in den bayerischen Staatsdienst in einer
seinen Leistungen entsprechenden Stellung bleibt ihm als Juden versagt.
1848 Veröffentlichung der Arbeit "Das Chloroform in seinen Wirkungen" mit
Aloys Martin (1818-1891).
März 1848 Eintreten für die Emanzipation
der Juden bei öffentlichen Kundgebungen in München.
8. März 1848 -
1849 Assistenzarzt an der Medizinischen Klinik in Tübingen unter Carl August
Wunderlich (1813-1877) mit 400 Gulden Jahresgehalt, Zulassung zur
Privatdozentur.
24. Juli 1848 Verehelichung mit Jeanette Raphaela
Landauer (1825-1891) aus Hürben, Landgericht Krumbach. Aus der Ehe gehen sieben
Kinder hervor.
10. Febr. 1850 Auf Empfehlung Wilhelm Griesingers
(1817-1868) Wahl zum Leiter der kantonalen Irrenanstalt in
Münsterlingen/Thurgau. Vor Antritt des Amts weitere Ausbildung in Winnenthal bei
Winnenden unter Albert Zeller (1804-1877) und Siegburg/Rheinland unter
Maximilian Jakobi (1775-1858).
1. Juli 1850 Amtsantritt als Leiter
der Anstalt Münsterlingen.
1852 Ludwig Binswanger läßt seine Kinder
taufen. Er selbst tritt nicht förmlich zur evangelisch-reformierten Kirche
über.
1854 Albert Zeller und Maximilian Jakobi besuchen Binswanger in
Münsterlingen.
1857 Die projektierte Einrichtung einer Privatanstalt
in Zürich kommt nicht zur Ausführung.
März 1857 Nach Erwerb des
Anwesens "Bellevue" in Kreuzlingen, Gemeinde Egelshofen, vor den Toren von
Konstanz für 32.142 Franken Eröffnung des "Asyls" Bellevue. Neben Binswangers
Familie können 15 Kranke Aufnahme finden. Später befinden sich hier vorzugsweise
die Gesellschaftsräume.
1861 Reise nach Schweden.
1863
Aufstockung der Villa Bellevue.
1866 Erwerb des Gemeinde- und
Kantonsbürgerrechts.
1870 Bau der ersten Dépendance, des um 1900
abgebrochenen "Mittelbaus". Es können jetzt 25 Patienten aufgenommen
werden.
1873 Reise nach Bayern, Besuch der Weltausstellung in Wien.
Erwerb der Hauses "Harmonie".
1874 - 1877 Erwerb des Landguts
Unter-Gyrsberg und Umbau bis 1877 zum Schlößchen "Brunnegg" - sichtbares Zeichen
wirtschaftlichen Erfolges. In der Folge werden auch hier einzelne Kranke
aufgenommen.
1877 Reise nach Italien und Frankreich.
1879
Erwerb des Hauses "Landegg" mit 12 Zimmern, die ganz oder etagenweise vergeben
werden. Es können jetzt 40 Kranke aufgenommen werden.
1880 Bau einer
geschlossenen Abteilung ("Waldegg") mit Appartements und Einzelzimmern für 8 bis
9 männliche Kranke.
6. Aug. 1880 Ludwig Binswanger d.Ä. stirbt in
Kreuzlingen.
1.2. Robert Binswanger (1850-1910)
12. Mai
1850 Robert Binswanger wird in Tübingen geboren.
1870 - 1874 Nach dem
Besuch des Gymnasiums in Konstanz und der Kantonsschule in Frauenfeld seit 1870
Studium der Medizin in Zürich (bis zum Physikum), Tübingen, Straßburg und Basel
(Staatsexamen).
1873 Als cand. med. leitete Robert Binswanger die
Anstalt vorübergehend in Vertretung seines Vaters.
1874 Assistent bei
Ernst Viktor von Leyden (1832-1910) in Straßburg zusammen mit seinem Bruder Otto
Binswanger (1852-1929).
1875 Promotion in Straßburg bei Ernst Viktor
von Leyden mit einer Dissertation "Über die Entstehung der in der Kindheit
erworbenen halbseitigen Gehirnatrophie".
1875 Assistent an der von
Ludwig Meyer (1827-1900) geleiteten Klinik in Göttingen. In Meyer wird er später
seinen "eigentlichen" Lehrer sehen.
30. Dez. 1876 Verehelichung mit
Bertha Hasenclever (1847-1896). Aus der Ehe gehen fünf Kinder hervor, darunter
Ludwig Binswanger (1881-1966), der spätere Nachfolger.
1. Jan. 1877
Eintritt in die väterliche Anstalt. Er löst hier seinen Bruder Otto Ludwig
Binswanger ab, der an seiner Stelle Assistent in Göttingen wird.
1880
Nach dem Tod Ludwig Binswangers d. Ä. werden die Brüder Robert und Otto
Binswanger gemeinsam Eigentümer der Anstalt.
1880 - 1907 Ausbau von
Bellevue zu einem ausgedehnten Anstaltskomplex in einem weitläufigen
Parkgelände.
1885 Bau eines geschlossenen Pavillons ("Tannegg") für 8
bis 10 Frauen.
1887 Bau der Villa "Felicitas" mit Arztwohnung und
Appartement für einen chronisch Kranken.
1889 Bau der Villa "Emilia"
mit Appartements für chronisch Kranke.
1889/1890 Bau der Villa
"Columba" für die Unterbringung "ruhigerer" Patienten, 1905 abgegeben.
1891 Neubau des Hauses "Harmonie" mit Arztwohnung, Büros und
Laboratorium.
1885 Schloß und Gut Brunnegg gehen in den Alleinbesitz
von Robert Binswanger über.
1892 Auf Aufforderung Leydens referiert
Binswanger auf dem IX. Kongress für Innere Medizin in Leipzig über die Erfolge
der "Suggestiv"-Therapie.
1893 Bau der Villa "Roberta" als Ersatz für
das bisherige Haus "Harmonie" mit 16 Zimmern für die Unterbringung von
Nervenkranken in Einzelzimmern und Suiten.
1894 Mit seiner Arbeit
"Karl Stauffer-Bern. Eine psychiatrische Studie" löst Robert Binswanger eine
öffentliche Kontroverse aus.
1897 Verehelichung mit Marie Louise
Reiners geb. Meyer (1871-1941). Aus der Ehe gehen zwei Kinder hervor.
1898/99 Die Anstalt geht gegen eine Ablösung von 400.000 Franken in den
alleinigen Besitz von Robert Binswanger über.
1899 Bau der Villa
"Maria" mit 10 Zimmern für die Unterbringung von 10 Damen.
Um 1900
Bau der "Parkvilla" für die Unterbringung eines russischen Großfürsten, der sie
zu seinem privaten Gebrauch einrichten läßt.
1900 - 1901 Um- und
Ausbau des Hauptgebäudes Bellevue und Errichtung eines
Wirtschaftsgebäudes.
1905 Abgabe der Villa "Columba" im Tausch gegen
das Haus "Seehof", das zunächst als Privathaus genutzt und 1912 umgebaut
wird.
1907 Bau des "Parkhauses" für 25 männliche Kranke.
6. Dez. 1910 Robert Binswanger stirbt in Kreuzlingen.
1.3.
Ludwig Binswanger d. J. (1881-1966)
13. April 1881 Ludwig Binswanger
d. J. wird in Kreuzlingen geboren.
1900 - 1906 Nach Besuch des
Gymnasiums in Konstanz und der Kantonsschule in Schaffhausen seit 1900 Studium
der Medizin in Lausanne, Heidelberg und Zürich. Juni 1906 - 1907 Volontärarzt
bei Eugen Bleuler (1857-1935) und dessen Oberarzt Carl Gustav Jung (1875-1961)
in der Klinik "Burghölzli" in Zürich.
1907 Promotion in Zürich bei C.
G. Jung mit der Dissertation "Diagnostische Assoziationsstudien. XI. Beitrag:
Über das Verhalten des psychogalvanischen Phänomens beim
Assoziationsexperiment". Februar 1907 Binswanger begleitet C. G. Jung auf seiner
Reise zu Sigmund Freud (1856-1939) nach Wien.
1907 - 1908
Volontärarzt in Jena bei seinem Onkel Otto Binswanger (1852-1929).
2.
April 1908 Verehelichung mit Hertha Buchenberger (1888-1971). Aus der Ehe gehen
fünf Kinder hervor.
Juli 1908 Eintritt als Assistenzarzt in die
väterliche Anstalt.
1. Jan. 1911 Nach dem Tod Robert Binswangers
(1850-1910) Übernahme der ärztlichen Leitung. Verwaltungsleiter war bis 1947
Binswangers Bruder Dr. phil. Otto Binswanger (1882-1968).
25. - 28.
Mai (Pfingsten) 1912 Besuch Sigmund Freuds in Kreuzlingen, nachdem Binswanger
eben eine lebensbedrohende Erkrankung überstanden hat.
1913 Es liegen
Pläne für die Verlegung der Anstalt vor, die wegen des Weltkriegs nicht mehr zur
Ausführung kommen.
1916 - 1917 Bau des "Gartenhauses". Seit 1917
wohnte hier Ludwig Binswanger mit seiner Familie.
1922 Ludwig
Binswanger veröffentlicht seine "Einführung in die Probleme der allgemeinen
Psychologie".
1923 Einzige persönliche Begegnung mit Edmund Husserl
(1859-1939). Beginn der Freundschaft mit Theodor Haering d. J.
(1884-1964).
1929 Erste persönliche Begegnung mit Martin Heidegger
(1889-1976).
1936 Binswanger hält in Wien den Festvortrag zu Sigmund
Freuds 80. Geburtstag.
1940 Evakuierung der Anstalt für mehrere
Monate in die private Heil- und Pflegeanstalt Littenheid bei Wil/Thurgau wegen
der unmittelbaren Lage an der deutschen Grenze.
1942 Binswangers
Hauptwerk "Grundformen menschlichen Denkens" erscheint. Jakob Wyrsch (1892-1980)
prägt zur Charakterisierung seines Ansatzes und zur Unterscheidung von
Heideggers "Daseinsanalytik" den Begriff "Daseinsanalyse".
1. Jan.
1956 Binswanger übergibt die Leitung der Anstalt seinem Sohn Wolfgang Binswanger
(1914-1992).
1956 Beginn der Zusammenarbeit mit Günter Neske
(1913-1997), in dessen Pfullinger Verlag Binswangers Spätwerk erscheint.
30. Okt. 1965 Bei einer Feier in Amriswil würdigen Martin Heidegger,
Binswangers Schüler Roland Kuhn (1912-2005), der Tübinger Philosoph Walter
Schulz (1912-2000) und der Zürcher Germanist Emil Staiger (1908-1987) sein
Lebenswerk. In der Nacht nach dieser Feier erleidet Binswanger einen
Schlaganfall.
5. Febr. 1966 Ludwig Binswanger stirbt in
Kreuzlingen.
1980 Schließung von Bellevue.
2.
Bestandsgeschichte
Mit der Schließung des Sanatorium Bellevue im Jahr
1980 war auch über den Verbleib der Verwaltungs- und Patientenakten, der
umfangreichen Privat- und Ärztebibliothek nebst Sonderdrucksammlung sowie des
Nachlasses von Ludwig Binswanger d. J. zu entscheiden. Vermittelt durch den des
damaligen Leiters des Instituts für Geschichte der Medizin der
Eberhard-Karls-Universität, Prof. Gerhard Fichtner, wurde entschieden, diese
Unterlagen der Universität Tübingen zu übergeben und der Forschung zugänglich zu
machen. Das Institut für Geschichte der Medizin kam dabei als Verwahrort nicht
in Betracht, weil insbesondere die jüngeren Patientenakten weiterhin für die
ärztliche Benutzung bereitgehalten werden mussten, andererseits jeder unbefugte
Zugriff auf dieses ausgeschlossen werden sollte. Hingegen verfügte das
Universitätsarchiv bereits über umfangreiche Erfahrungen mit der Aufbewahrung,
Erschließung und Benutzung von Patientenunterlagen der Tübinger
Universitätskliniken entsprechender Materialen bereits Erfahrung hatte.
Während das Verwaltungsarchiv der Klinik, der Nachlass Ludwig Binswangers
und die Bibliotheksbestände in das Eigentum in das Eigentum der Universität
übergingen, verblieben die Krankenakten im Eigentum der damaligen Dr. Binswanger
Sanatorium Bellevue AG Kreuzlingen. Anfang Juli 1986 erfolgte die Überführung
der Materialien nach Tübingen. Die Ärztebibliothek und die Sonderdrucksammlung
wurden zunächst von der Universitätsbibliothek übernommen, in der Folge aber dem
Institut für Ethik und Geschichte der Medizin übergeben. Alles übrige wird
seither im Universitätsarchiv verwahrt, dem im Jahr 2002 schließlich auch noch
das sogenannte "Familienarchiv" übereignet wurde.
Die Benutzung ist
in einer besonderen Benutzungsordnung geregelt, nach der eine nichtärtzliche
oder nichtmedizinische Nutzung der Krankenakten in jedem Einzelfall der
Zustimmung eines Beauftragen der Eigentümer bedarf.
3.
Bearbeiterbericht
Noch vor der Übernahme fand in Kreuzlingen durch
den damaligen Leiter des Universitätsarchivs, Prof. Dr. Volker Schäfer, eine
erste Sichtung statt. Dabei wurde entschieden, die Krankenakten (Archivbestand
441), die Verwaltungsakten (Archivbestand 442) und den Nachlass Ludwig
Binswangers d. J. (Archivbestand 443) bei Erschließung und Signaturvergabe
getrennt zu behandeln.
Verwaltungsakten des Bellevue und Nachlass
Ludwig Binswanger
Bei der Erschließung dieser beiden Bestände, die
zusammen rund 30 Regalmetermeter umfassen, zeigte sich rasch, das die
beabsichtigte Scheidung des Klinik- und des Nachlass-Schriftgutes nicht mit
letzter Konsequenz durchzuführen war. Bereits 1991 hatte stud. phil. Jörg
Fischer 1991 eine provisorische Verzeichnung der beiden Bestände Akten
vorgenommen Diese Titelaufnahmen, die auch dem vorliegenden Repertorium
zugrundeliegen, wurden 1994 in eine Datei überführt und im Januar und März 1995
von Johannes Michael Wischnath revidiert und sachlich in vier Teile geordnet.
Die persönlichen und wissenschaftlichen Archivalien von Ludwig Binswanger wurden
dem 1. Teil "Nachlass Ludwig Binswanger" zugeordnet, Archivalien zu allen
anderen Mitgliedern der Familie dem 2. Teil "Familie Binswanger". Der 3. Teil
"Sanatorium Bellevue" umfasst sämtliche Akten zur Verwaltung und zum Betrieb des
Sanatoriums. Alle Bild- und Tondokumente sowie alle Kunstwerke und künstlerische
Arbeiten der Patienten finden sich im Teil "Sammlungsgut".
Während
die medizinischen und therapeutischen Klinikakten in großen Umfang erhalten
sind, bestehen bei Verwaltungsakten zum wirtschaftlichen Betrieb des Bellevue
bedauerlich große Lücken. So gut wie keine Unterlagen sind zum Kauf, Umbau und
Erhalt der Gebäude vorhanden. Gleiches gilt auch für die Beschäftigen des
Bellevue. Sehr unvollständig sind auch die Akten der Verwaltungsorgane der
Binswanger Kuranstalt Bellevue Aktiengesellschaft vor allem ab 1962 bis zur
Schließung.
4. Ergänzende Überlieferung
Vor Übernahme des
wissenschaftlichen Nachlasses Ludwig Binswangers durch das Universitätsarchiv
waren aus dem Nachlass drei Korrespondenzen abgegeben worden. Auf Wunsch der
Paul-Häberlin-Gesellschaft in Basel wurde dieser am 30. Juli 1965 der
Briefwechsel Ludwig Binswangers mit Paul Häberlin übergeben. Die Korrespondenz
mit Sigmund Freud wurde Mitte der 1980er Jahre an die Bayerische
Staatsbibliothek München verkauft, wo auch die Korrespondenz mit Carl Gustav
Jung liegt, von der im Binswanger-Archiv lediglich Kopien vorhanden sind.
Auf Grund der weltweiten Beziehungen Ludwig Binswangers ist darüber hinaus
in einer Vielzahl von weiteren Gelehrtennachlässen, etwa dem Spranger-Archiv im
Bundesarchiv Koblenz, mit ergänzenden Unterlagen zu rechnen.
5.
Literatur
··Irmela Bauer-Klöden / Johannes-Michael Wischnath:
"Beglücktes Haus, gesegneter Beruf" - Die Binswangersche Heilanstalt Bellevue in
Kreuzlingen im Spiegel des Tübinger. Eine Ausstellung des Universitätsarchivs
Tübingen. Tübingen 2003 (=Werkschriften des Universitätsarchivs Tübingen, Reihe
2: Repertorien und Kataloge, Heft 17.)
·Kaspar Domeyer: Binswangers
Privatklinik Bellevue 1886-1890. Diss. med. Tübingen 2004.
·Katja
Gertrud Doneith: Binswangers Privatklinik Bellevue 1881-1885. Diss. med.
Tübingen 2008.
·Julia Susanne Gnann: Binswangers Kuranstalt Bellevue
1906-1910. Tübingen, Diss. med. 2006.
·Max Herzog (Hg.): Ludwig
Binswanger und die Chronik der Klinik "Bellevue" in Kreuzlingen. Eine
Psychiatrie in Lebensbildern. Berlin 1995.
·Andrea Henzler: Zur
Technik in Ludwig Binswangers ersten psychoanalytisch orientierten Behandlungen.
Tübingen, Diss. med. 2007. Online-Publikation
·Albrecht Hirschmüller
(Hg.): Ellen West - Eine Patientin Ludwig Binswangers zwischen Kreativität und
destruktivem Leiden. Neue Forschungsergebnisse. Heidelberg 2003.
·Naamah Akavia / Albrecht Hirschmüller (Hg.): Ellen West: Gedichte,
Prosatexte, Tagebücher, Krankengeschichte. Körning 2007.
·Albrecht
Hirschmüller / Annett Moses (Hg.): Psychiatrie in Binswangers Klinik "Bellevue".
Diagnostik - Therapie - Arzt-Patient-Beziehung. Vorträge einer Internationalen
Tagung Tübingen, 4.-5. Oktober 2002. Mit Beiträgen von Albrecht Hirschmüller,
Thomas Beddies, Annett Moses, Claudia Stäbler, Sandra Josefin Schweizer,
Stefanie Weismann-Günzler, Kaspar Domeyer, Heidi von Jurczyk, Julia Gnann,
Andrea Henzler und Michael Neumann. Tübingen 2002.
·Albrecht
Hirschmüller, Volker Schäfer: Die Binswanger-Bestände im Universitätsarchiv
Tübingen und ihre Erschließung. In: Niemals müßig. Symposion aus Anlass der
Emeritierung von Professor Dr. Gerhard Fichtner am 19.12.1998 in Tübingen. Hrsg.
von Dietlinde Goltz und Albrecht Hirschmüller, Stuttgart 1999, S. 38-54.
·Dino Larese: Ludwig Binswanger. Versuch einer kleinen Lebensskizze,
Amriswil 1965. [Mit Bibliographie]
·Chantal Marazia / David Stimilli
(Hg.): Ludwig Binswanger - Aby Warburg. Die unendliche Heilung. Aby Warburgs
Krankengeschichte. Zürich und Berlin: Diaphanes 2007.
·Annett Moses /
Albrecht Hirschmüller: Binswangers Psychiatrische Klinik in Kreuzlingen. Das
"Asyl" unter Ludwig Binswanger sen. 1857-1880. Frankfurt am Main 2004
(=Marburger Schriften zur Medizingeschichte
·44).
·Der
Psychiater Dr. med. Ludwig Binswanger und das Sanatorium Bellevue: ein Heft zum
hundertsten Geburtstag von Dr. med., Dr. med. h.c. und Dr. phil. h.c. Ludwig
Binswanger. Mit Beiträgen von Roland Kuhn, Emil Staiger, Jörg Aeschbacher.
Kreuzlingen 1981, 44 S., Ill. (=Beiträge zur Ortsgeschichte; H. 21).
·Stefan Frank Scheffczyk: Die Kokaintherapie der Morphiumsucht am Beispiel
des Sanatoriums "Bellevue" in Kreuzlingen (1884 - 1887). Diss. med. Tübingen
1997.
·Sandra Josefin Schweizer: Binswangers Anstalt "Bellevue"
1866-1870. Diss. med. Tübingen 2000 (=Aus dem Institut für Geschichte für
Medizin der Universität Tübingen).
·Claudia Stäbler: Binswangers
Privatklinik Bellevue 1861-1865. Diss. med. Tübingen 2001 (=Aus dem Institut für
Geschichte der Medizin der Universität Tübingen).
·Iboya Stollwerk
geb. Meszaros: Binswangers Kuranstalt Bellevue 1896-1900. Diss. med. Tübingen
2007.
·Stefanie Christina Weismann-Günzler geb. Günzler: Binswangers
Asyl Bellevue 1871-1875. Diss. med. Tübingen 2004.
Tübingen, im
September 2002 Michael Wischnath und Irmela Bauer-Klöden
Inhalt:
A. Verwaltungsakten
1. Allgemeines:
Ausarbeitungen über die Klinik (UAT 442/237-239, 243-252, 328, 364: 15 Nrn,
o.J., 1961-1979).
Jahresberichte, -rechnung, Revision (UAT 442/258,
335, 359-361: 5 Nrn, 1930-1977).
Sanierungsbemühungen, Schließung
(UAT 442/212-213, 240-241, 253, 283, 373: 7 Nrn, 1945-1979).
Anschriften (UAT 442/76-79: 4 Nrn, o.J.).
Allgemeine
Korrespondenz (UAT 442/111-136, 180, 214, 259, 362: 30 Nrn, 1886-1980).
Sanatorium "Bellevue" AG, Verwaltungsrat, Generalversammlung (UAT 442/215,
242, 334, 336-358: 26 Nrn, 1920-1977).
Einzelne Betriebsteile (UAT
442/227, 229, 234, 268: 4 Nrn, 1894-1916, 1950, 1973-1974).
Immobilien (UAT 442/217-218: 2 Nrn, 1947-1961).
Kassenbuch (UAT
442/219: 1 Nr., 1873-1884).
Fachvereinigungen (UAT 442/216, 262-263:
3 Nrn, 1919-1979).
Veranstaltungen, Tagungen (UAT 442/181-182, 236,
254-257, 259, 282, 316, 329: 11 Nrn, 1955-1978).
2. Patienten,
Therapie:
Aufnahme (UAT 442/1-9, 11-51, 185-186, 231: 53 Nrn,
1857-1980).
Statistik (UAT 442/97-102, 187-191, 193-211: 30 Nrn,
1884-1980).
Arztbriefe (UAT 442/52-75: 24 Nrn, 1875-1919).
Privatkonsultationen Dr. Ludwig Binswanger (UAT 442/80-94: 15 Nrn,
1913-1980).
Krankengeschichten (UAT 442/10, 224-225: 3 Nrn, o.J.,
1903-1910).
Ärztliche Konferenz (UAT 442/228: 1 Nr.,
1901-1910).
Arznei-, Behandlungsbücher (UAT 442/220-223, 226,
232-233, 235: 8 Nrn, 1857-1919, 1936-1955).
Rorschach-Versuche (UAT
442/103-110: 8 Nrn, 1940-1965).
Gruppentherapie, Protokolle (UAT
442/192, 265, 267, 269-281: 15 Nrn, 1957-1979).
Rapporthefte,
Stationsprotokolle (UAT 442: 460 441-1439: 980 Nrn, 1924-1970)
3.
Ärzte, Pflege- u.a. Personal: (UAT 442/95-96, 137-179, 230, 266, 325-327: 50
Nrn, 1910-1980).
4. Sonstiges: (UAT 442/284-286, 363, 394: 5 Nrn,
o.J. 1937-1967).
B. Teilnachlass Ludwig Binswanger
Persönliche Dokumente, Autobiografisches (UAT 442/300-304: 5 Nrn,
1900-1977).
Geburtstage, Ehrungen (UAT 442/287-288, 291, 306-308,
310-315: 12 Nrn, o. J., 1947-1967).
Privatkorrespondenz (UAT
442/292-293, 309: 3 Nrn, 1895-1966).
Familienangehörige: Dorothy,
Peter, Robert, Otto Ludwig, Eduard, Hertha Binswanger (UAT 442/294-299, 305: 7
Nrn, 1901-1977).
C. Korrespondenz Dr. Wolfgang Binswanger: (UAT
442/183-184: 2 Nrn, 1956-1980).
D. Werke der bildenden Kunst, Bild-
und Tondokumente:
Bildhauerische Arbeiten (UAT 442/385-386, 393: 3
Nrn, 1900, 1906).
Gemälde (UAT 442/388-389: 2 Nrn, 1903, 1904).
Grafiken (UAT 442/381: 1 Nr., o.J.).
Patientenzeichnungen (UAT
442/378-379: 2 Nrn, o.J., 1930, 1977/78).
Negative und Diapositive
(UAT 442/375: 1 Nr., o.J.).
Platten (UAT 442/374, 376: 2 Nrn,
o.J.).
Fotografien (UAT 442/380, 382-383, 384, 387, 390-392: o.J.,
ca. 1869-1977).
Fotoalben (UAT 442/317-324, 377: 7 Nrn, ca.
1899-1977, o.D.).
Tonbänder (UAT 442/365-368: 2 Nrn, 1971,
1976).
Tonbandkassetten (UAT 442/369-372: 6 Nrn, ca. 1977).
- Bestandssignatur
-
UAT 442/
- Umfang
-
1.441 Nrn; 17,60 lfm
- Kontext
-
Universitätsarchiv Tübingen (Archivtektonik) >> N Nachlässe und kleinere Erwerbungen >> Nb Nachlässe B >> Binswanger-Archiv (1836-1980)
- Bestandslaufzeit
-
1857-1980
- Weitere Objektseiten
- Letzte Aktualisierung
-
19.04.2024, 00:31 MESZ
Datenpartner
Eberhard Karls Universität Tübingen, UB - Universitätsarchiv. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Bestand
Entstanden
- 1857-1980