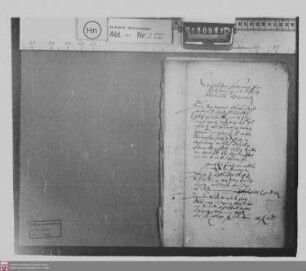Bestand
Reichsgrafschaft Wied-Runkel (Wied-Isenburg) (Bestand)
Form und Inhalt: Die Grafschaft Wied nimmt ihren Anfang von der vor 1129 von Graf Meffried errichteten Burg Wied (Altwied) und gründet auf Reichsgut. Graf Lothar von Wied, der kinderlose und damit letzte Vertreter des Grafengeschlechts Wied, überschrieb 1243 seinen Neffen Bruno (II.) von Braunsberg und Dietrich von Isenburg die Hälfte der Grafschaft Wied in Lehnsabhängigkeit von den Pfalzgrafen. Als Graf Lothar von Wied dann 1244 starb, fiel eine Hälfte der Grafschaft an die Grafen von Braunsberg und Isenburg und die andere Hälfte an die Herren von Eppstein, die ihren Anteil 1306 an die Grafen von Virneburg verkauften. Wenig später (1338) gelang es Wilhelm von Braunsberg-Isenburg, die gesamte Grafschaft wieder zu vereinigen und eine neue Linie der Grafen von Wied-Isenburg zu gründen.
Als Wilhelm II. von Wied-Isenburg 1462 ohne männlichen Erben starb, fiel die Grafschaft in weiblicher Erbfolge an Dietrich IV. von Runkel, der mit einer Nichte Wilhelms, Anastasia von Wied-Isenburg, verheiratet war. Dietrich war somit der Begründer der neuen Linie der Grafen von Wied-Runkel, zu der 1468 über die Linie Westerburg die Grafschaft Leiningen erbbedingt hinzukam.
1477 wurde Friedrich von Wied-Runkel mit der gesamten Grafschaft Wied belehnt. Er hatte vier erb-berechtigte Söhne, von denen zunächst der älteste als Wilhelm III. 1488 die Herrschaft antrat. Wilhelm konnte zusätzlich die Grafschaft Moers erwerben. Da er 1526 ohne legitime Söhne starb, erbte sein Bruder Johann III. die Grafschaft Wied, während Moers über Wilhelms Tochter Anna an die Grafschaft Neuenahr fiel. Die beiden jüngeren Brüder, Hermann und Friedrich, waren Geistliche geworden: Hermann seit 1515 Erzbischof von Köln, Friedrich Bischof von Münster. Obwohl Hermann und Friedrich im Zuge der Reformation ihre Ämter niederlegten, traten sie nicht wieder in die Erbfolge ein. Nach dem Tod Johanns III. wurde die Grafschaft Wied 1595 endgültig in die Niedergrafschaft (seit 1648/53 Wied-Neuwied mit Zentrum in Neuwied) und Obergrafschaft (Wied-Runkel mit Zentrum in Dierdorf) aufgeteilt. Im 17. Jahrhundert schien zeitweise die Wiedervereinigung der beiden Teile unter Graf Friedrich von Runkel und Dierdorf möglich, doch kam es in den Jahren 1692-1698 zur letztlich beständigen Teilung in die Grafschaften Wied-Neuwied und Wied-Runkel.
Friedrich III. von Wied (1634-1698), der 1641 die Niedergrafschaft übernommen hatte, gründete 1653 die Stadt Neuwied.
Seit Einführung der Reformation wurde Wied wie ein reichsunmittelbares Fürstentum behandelt und gehörte zum Niederrheinisch-Westfälischen Reichskreis (westfälische Grafenbank). Johann Friedrich Alexander von Wied-Neuwied (1706-1791) wurde 1784 in den Reichsfürstenstand erhoben; er war der erste Fürst von Neuwied (1784-1791). Sein Sohn Friedrich Karl (1741-1809) war der letzte regierende Fürst zu Wied. Nachdem er sich geweigert hatte, dem Rheinbund beizutreten, wurde das Fürstentum 1806 auf Druck des französischen Kaisers Napoleon aufgelöst und dem Herzogtum Nassau zugeschlagen. 1815 fielen die Wiedischen Territorien an Preußen.
Trotz Mediatisierung behielten die Fürsten von Wied ihre standesherrlichen Rechte (unter Regelung der preußischen Regierung). Als 1824 die Linie Wied-Runkel ausstarb, beerbte der Fürst von Wied-Neuwied diese und vereinigte beide Linien wieder. Aufgrund der Verordnung des preußischen Königs vom 31. Mai 1825 zur Bildung einer kollegial organisierten Regierung in den Standesherrschaften wurde 1826 die Fürstlich Wiedische Regierung errichtet, die auf Antrag des Fürsten Wilhelm Hermann Karl von Wied 1848 wieder aufgelöst wurde. Landkreis und preußische Regierung übernahmen nun endgültig die Durchführung der staatlichen Verwaltung der ehemals Wiedischen Territorien. Die Übernahme eines Großteils der Unterlagen der Registratur des Fürsten dürfte unmittelbar nach Errichtung des Staatsarchivs erfolgt sein, da das erste Findbuch bereits 1840 von dem Koblenzer Archivar Heinrich Beyer angelegt worden ist. Eine weitere Abgabe (Depositum) erfolgte 1911 durch die Fürstlich-Wiedische Verwaltung Neuwied (LHA Ko Best. 417, Nr. 169).
Der Schwerpunkt der Aktenüberlieferung liegt zeitlich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in-haltlich bei den reichs- und kreisständischen Sachen und dem kurkölnischen Landtag.
- Reference number of holding
-
35
- Context
-
Landeshauptarchiv Koblenz (Archivtektonik)
- Related materials
-
Bär, Max: Die Behördenverfassung der Rheinprovinz seit 1815. (Publikationen der Gesellschaft für Rhei-nische Geschichtskunde, 35). Bonn 1919 (Nachdruck Bonn 1965), S. 204-229
Gensicke, Hellmuth: Landesgeschichte des Westerwaldes. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau, 13). Wiesbaden 1958, S. 290-306 (zur Herrschaft Isenburg), S. 250-262 u. 331-338 (zur Grafschaft Wied)
Isenburg-Ysenburg 963 - 1963. Zur tausendjährigen Geschichte des Geschlechtes. Hanau 1963
Köbler, Gerhard: Historisches Lexikon der deutschen Länder. Die deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 7. Aufl., München 2007, S. 787f.
Krüger, Hans-Jürgen: Das Fürstliche Haus Wied, Grafen zu Isenburg, Herren zu Runkel und Neuerburg. (Deutsche Fürstenhäuser, 14). Werl 2004
Müller, Bernd: Das Fürstentum Isenburg im Rheinischen Bund - vom Territorium zum Staat.
Büdingen 1978
Schaus. Emil: Hinterlegte Bestände im Staatsarchiv zu Koblenz. In: Nachrichten-Blatt für rheinische Hei-matpflege, Jg. 1929/1930, S. 31: Best. 35 Nr. 2001-3378
Thiel, B. J.: Salentin, Graf von Isenburg, Herr von St. Johannisberg, während der Kriegsjahre 1542-1544. (Historische Abhandlungen über die Herrschaft Düdelingen und St. Johannisberg, 1). Luxemburg 1937
Wasser, Eugen: Isenburg und die Isenburger. 900 Jahre Dorfgeschichte. Hrsg. von der Ortsgemeinde Isenburg. Horb/Neckar 2002
Archiv des Fürsten zu Wied, Neuwied
- Date of creation of holding
-
936 Urkunden: 1237-1803; 1606 Akten: 1346-19. Jh. (32,65 Rgm)
- Other object pages
- Last update
- 01.04.2025, 1:23 PM CEST
Data provider
Landeshauptarchiv Koblenz. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Bestand
Time of origin
- 936 Urkunden: 1237-1803; 1606 Akten: 1346-19. Jh. (32,65 Rgm)