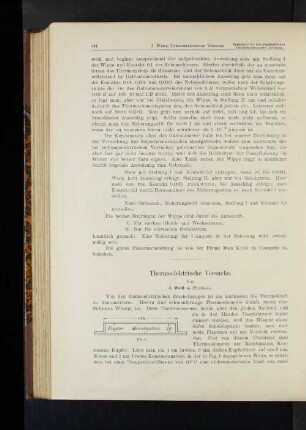Artikel
Thermoelektrik: Strom aus Abwärme. Thermoelektrische Generatoren versorgen autonome Systeme und sparen Energie.
Abwärme fällt in allen Bereichen des täglichen Lebens an – in Industrie, Haushalt und Verkehr. Allein in Deutschland summiert sich das auf ein Abwärmepotenzial von 300 TWh pro Jahr. Diese Energiemenge entspricht knapp der Hälfte des gesamten Energieverbrauchs der deutschen Industrie. Sogenannte thermoelektrische Generatoren (TEG) können dieses riesige Energie-Reservoir anzapfen und die „Abfallenergie“ ohne bewegliche Teile in eine höherwertige Energieform überführen. Sie nutzen Abwärme und erzeugen bereits aus kleinen Temperaturdifferenzen elektrischen Strom. Diese Verwertung ansonsten verlorener Abwärme bzw. Umgebungswärme wird auch als Energy Harvesting bezeichnet und wird zukünftig einen wichtigen Beitrag zur Energieeffizienz und zur Einsparung von CO2-Emissionen beitragen. Thermoelektrische Module können nicht nur Abwärme direkt zu Strom wandeln, sondern auch als elektrische Wärmepumpe mittels Strom direkt kühlen und heizen: Die Industrie setzt die sogenannten Peltier-Kühler heute zur Temperierung von Autositzen oder zur Temperaturstabilisierung elektronischer Bauteile ein. Im Konsumgüterbereich sind sie beispielsweise in Campingkühlboxen und lautlosen Hotelkühlschränken zu finden. Thermoelektrische Module bestehen in ihrer einfachsten Form aus einem Thermoelement, das in vielen Anwendungen als Temperatursensor eingesetzt wird. Dieses ist aus zwei thermoelektrischen Materialien, sogenannten Thermoelektrika, aufgebaut, deren elektrische Kontakte sich auf unterschiedlichen Temperaturniveaus befinden. Die ersten Thermoelektrika waren nur sehr aufwendig herstellbar und produzierten lediglich einige Watt. Heute sind bereits Systeme bis 1.000 Watt möglich. Durch neue Materialien und Verarbeitungsverfahren können größere Temperaturunterschiede genutzt werden, wodurch auch die Leistungsausbeute weiter steigen wird. Forscher und Hersteller arbeiten daran, den Wirkungsgrad von Thermogeneratoren zu steigern und für die Massenproduktion geeignete Herstellungsverfahren zu entwickeln. Ähnlich wie in der Photovoltaik erscheint nun, ausgehend von einer Technik zur Versorgung von Weltraumfahrzeugen wie dem Marsrover Curiosity, der Weg zu einem breiten Einsatz in verschiedenen Anwendungen geebnet. Dieses Themeninfo vermittelt einen Überblick über die Funktionsweise und die Einsatzbereiche der Technik sowie über die Materialien, die für unterschiedliche Temperaturbereiche entwickelt und optimiert werden.
- ISSN
-
1610-8302
- Umfang
-
24 p.
- Sprache
-
Deutsch
- Erschienen in
-
BINE Informationsdienst - Themeninfo; 1/2016
- Thema
-
Energieforschung kompakt
Industrie und Gewerbe: Abwärme & Wärmerückgewinnung
Energieerzeugung: Weitere Energiewandler
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
König, Jan D.
Bartholomé, Kilian
Böttner, Harald
Jänsch, Daniel
Klein, Mirko
Köhne, Martin
Nurnus, Joachim
Roch, Aljoscha
Tarantik, Karina
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
- (wann)
-
2016
- Förderung
-
Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi). Förderkennzeichen: 03ET1164A-C, 0327863A-G, 0327876A-D, G, 19U15006A-G, 03X4506A. Englische Ausgabe: Thermoelectrics: power from waste heat. Thermoelectric generators supply autonomous systems and save energy.
- Letzte Aktualisierung
-
07.03.2025, 12:05 MEZ
Datenpartner
BINE Informationsdienst. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Artikel
Beteiligte
- König, Jan D.
- Bartholomé, Kilian
- Böttner, Harald
- Jänsch, Daniel
- Klein, Mirko
- Köhne, Martin
- Nurnus, Joachim
- Roch, Aljoscha
- Tarantik, Karina
- FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen
Entstanden
- 2016