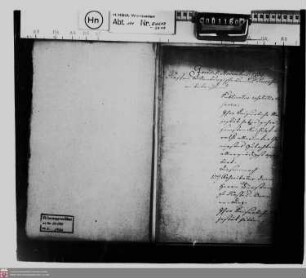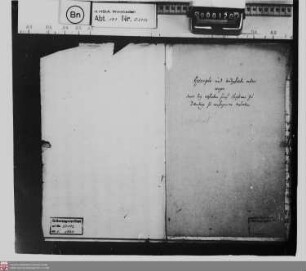Archivbestand
Fürstentum Siegen, Oranien-Nassauische Behörden, Zentralbehörden in Dillenburg (Bestand)
1. Regierung: Fürstenhaus
1670-1755 (2); Schulden, Rechnungswesen 1607-1806 (6); Statistik
1782-1789 (1); Justiz 1749-1805 (3); Kirchen, Schulen,
Stiftungen 1723-1812 (80); Stift Keppel, Jesuiten (1239-1495)
1559-1823 (9); Adel 1343-1797 (26); Stadt Siegen 1745-1806 (3);
Forsten, Hude, Bergbau, Mühlen 1528-1833 (11), Juden 1797 (1);
Gesuche, Beschwerden 1741-1756 (9); Edikte 1761-1784 (2); - 2.
Justizkanzlei: Deponierte Gelder, Jurisdiktion 1781-1814 (5). -
3. (Ober-)Konsistorium: Kirchen- und Schulangelegenheiten
1478-1815 (220). - 4. Rentkammer mit Oberforstkollegium:
Grenzen, Etat, Bauten 1616, 1744-1814 (28); Dienste 1714-1807
(9); Bergwerke, Mühlen, andere Gewerbe 1616-1809 (24);
Kommunalsachen, Kirchen, Schulen 1579-1815 (14); Stift Keppel
1749-1815 (3); Kautionen, Depositen 1739-1805 (10); Förster
1754-1818 (4); Forstfrevel 1787-1806 (3); Kommunal- und
Kirchenwaldungen, Hude und Viehtrift (1730-) 1756-1807 (17);
Vermessung (1707-) 1705-1812 (22); Straßen- und Wegebau
1753-1808 (8); Berg- und Hüttenkommission: Hütten, Hämmer,
Straßenbau 1748-1815 (17), Prozesse 1766-1810 (50).
Bestandsgeschichte:
Vereinigung mit der Grafschaft Nassau-Oranien-Diez 1743,
Verwaltung der deutschen Gebiete der Oranier in Dillenburg,
Unterdirektorium in Siegen, aufgelöst 1806. -
Mischbestand.
Form und Inhalt:
Geschichte der Grafschaft und des Fürstentums
Nassau-Siegen
Die Grafschaft Nassau vom Mittelalter
bis zur Erbteilung 1606
Das Haus Nassau war ein weit
verzweigtes deutsches Adelsgeschlecht von europäischer
Bedeutung, dessen Anfänge bis in das 11. Jahrhundert
zurückreichen. Unstrittig ist, dass die Grafen von Nassau von
den Grafen von Laurenburg abstammen. Die Burg Laurenburg, wenige
Kilometer flussaufwärts von der heutigen Kleinstadt Nassau an
der Lahn gelegen, war im 12. Jahrhundert Herrschaftssitz des
gleichnamigen Adelsgeschlechts. 1159 verlagerte diese gräfliche
Familie ihren Sitz auf die Burg Nassau und nannte sich fortan
auch nach dieser Burg.
Die Grafen von Laurenburg bzw.
dann von Nassau betrieben intensiv den Ausbau ihrer
Landesherrschaften. Unter den Brüdern Arnold I. von Laurenburg
(1123-1148) und Ruprecht I. (1123-1154), dessen Sohn Walram I.
(1154-1198) sowie wiederum dessen Sohn Heinrich II., dem Reichen
(1198-1251), wurde stetig der Besitz im Raum zwischen Taunus und
Westerwald an der unteren und mittleren Lahn erweitert. Vor 1128
hatten die Grafen von Laurenburg vom Hochstift Worms, das in der
genannten Gegend umfangreiche Rechte besaß, die Vogtei über das
Walpurgisstift Weilburg erhalten. Damit war es den Grafen
gelungen, eine Verbindung zwischen ihrem Allodialbesitz an der
unteren Lahn und ihrem Besitz um Siegen zu schaffen, welchen sie
Mitte des 12. Jahrhunderts mit dem Erwerb der so genannten
Hessisch-Thüringischen Reichslehen, nämlich der Herborner Mark,
der Kalenberger Zent und des Gerichts Heimau (Löhnberg) festigen
konnten. Auch die ”Herrschaft zum Westerwald“ gelangte zu dieser
Zeit in nassauischen Besitz. Ende des 12. Jahrhunderts erwarben
die Nassauer Grafen mit dem Reichshof Wiesbaden einen wichtigen
Stützpunkt im Südwesten.
Die gemeinsam regierenden
Söhne des Grafen Heinrichs II. von Nassau, Walram II.
(1151-1276) und Otto I. (1251-1289) teilten in einem Vertrag vom
16. Dezember 1255 ihren Besitz in zwei Teile und ihr Haus in
zwei Linien. Seitdem unterscheidet sich das Grafengeschlecht in
eine Ottonische und eine Walramische Linie. Die natürliche
Grenze beider Herrschaftsbereiche bildete im Wesentlichen die
Lahn, wobei Otto I. den nördlichen Landesteil mit Siegen
(urkundliche Ersterwähnung 1079), Dillenburg, Herborn und Haiger
erhielt, Walram II. hingegen den südlich des Flusses gelegenen
Teil der Grafschaft mit Weilburg und Idstein. In beiden Linien
kam es in den nächsten Jahrhunderten mehrfach zu
Landesteilungen.
Die Ottonische Linie, aus der
dreihundert Jahre später auch die Grafschaft bzw. anschließend
das Fürstentum Nassau-Siegen hervorgehen sollte, wurde nach dem
Tod des Grafen Otto I. im Jahr 1289 zunächst von dessen Gemahlin
Agnes von Leiningen-Landeck ( um 1303) und ihren Söhnen
geführt. Nach dem Tod der Gräfin kam es am 27. Juni 1303 zu
einer Hausteilung unter ihren Söhnen Emich ( 1334), Johann (
1328) und Heinrich III. ( 1343). Es entstanden folgende Linien,
die nach ihrem Aussterben an andere noch bestehende nassauische
Grafenhäuser der ottonischen Linie fielen:
Nassau-Dillenburg (1303-1328), fällt an Siegen
Nassau-Hadamar, ältere Linie (1303-1394), fällt an
Dillenburg
Nassau-Siegen, ab 1328 Nassau-Dillenburg
(1303-1341), geteilt in
Nassau-Beilstein, ältere
Linie (1341-1561), fällt an Dillenburg
Nassau-Dillenburg, ältere Linie (1341-1606).
Der
älteren Linie Nassau-Dillenburgs gelang es im 15. Jahrhundert,
umfangreiche Besitzungen zu erwerben, darunter auch in den
Niederlanden. Unter Graf Johann I. von Nassau-Dillenburg
(1362-1416) und seinen Söhnen wurde 1386 die Grafschaft Diez
erworben, 1403/04 die Herrschaft Breda und 1420 durch Erbschaft
die Grafschaft Vianden. Unter der Regierung Graf Johanns IV. von
Nassau-Dillenburg (1442-1475) verlagerte sich der Schwerpunkt
der Herrschaft zunehmend in die niederländischen Besitzungen.
Nach dem Tod Graf Johanns IV. teilten sich dessen Söhne das
väterliche Erbe. Graf Engelbert II. (1475-1504) erhielt die
niederländischen Gebiete, Graf Johann V. (1475-1516) bekam die
Grafschaft Nassau-Dillenburg. Dem kinderlosen Grafen Engelbert
II. von Nassau-Breda folgte sein Neffe, der Sohn des Grafen
Johanns V. von Nassau-Dillenburg (1475-1516) namens Heinrich
III. (1504-1538). Graf Heinrich III. konnte den Einfluss Nassaus
in den Niederlanden erheblich ausweiten. Durch seine
Eheschließung mit Claudia von Chalon und Orange erwarb er das
Fürstentum Orange (Oranien) in Südfrankreich. Deren Sohn Renatus
bzw. René (1519-1544) führte als erster Nassauer den souveränen
Titel ”Fürst von Oranien“. Vor seinem Tod 1544 hatte Fürst
Renatus seinen noch minderjährigen Neffen Wilhelm von
Nassau-Dillenburg (*1533, reg. 1544-1584) als Erben benannt.
Wilhelm durfte den Titel Prince d’Orange (Fürst von Oranien)
allerdings nur unter der Bedingung Kaiser Karls V. (1516-1558)
führen, wenn er an dessen Hof in Brüssel katholisch erzogen
wurde. 1560 konnte Wilhelm das zwischenzeitlich von Frankreich
besetzte Fürstentum in Besitz nehmen, kurz bevor er als Wilhelm
I. von Oranien zum Führer des Aufstands der Niederlande gegen
Spanien wurde.
Nach dem Aussterben der älteren Linie
Nassau-Siegen war das Siegerland bei den Grafen von
Nassau-Dillenburg verblieben, deren landesherrliche Macht sich
dort über eine Landmasse mit differenzierten grundherrlichen
Verhältnissen erstreckte. Zu diesen Grundherren zählten
geistliche Institutionen und der landsässige Adel. Zu den
geistlichen Grundherren gehörten die Abtei Deutz bei Köln, das
Stift St. Georg zu Köln, die Abtei Siegburg, das Kloster
Drolshagen, die Pfarrkirche St. Martin zu Siegen, das Kloster
St. Johann bei Siegen, das Minoriten- und das
Franziskanerkloster zu Siegen und das
Prämonstratenser-Nonnenkloster Keppel. Zu den landsässigen
Adelsfamilien als Grundherren zählten im Siegerland besonders
die Familien von Hain, Kolbe von Wilnsdorf, Rode von Wilnsdorf,
von Bicken, von der Hees, von Holdinghausen, von Selbach, von
Selbach genannt Daube, von Wischel zu Langenau und die
Edelherren von Wildenburg. Als Landesherren waren die Grafen von
Nassau-Dillenburg stets bestrebt, ihre grundherrliche
Erwerbspolitik im Siegerland zu forcieren, besonders auf Kosten
der geistlichen Grundherren und des landsässigen Adels. Die
Stadt Siegen selbst war im 13. und 14. Jahrhundert einer
doppelten Oberhoheit ausgesetzt. 1224 war der Ort als eine aufs
Neue erbaute oder wiederaufgebaute Stadt oder Landgemeinde
(genauer lateinischer Wortlaut: ”oppidi Sige de novo
constructi“) von Erzbischof Engelbert I. (1216-1225) von Köln an
Graf Heinrich II. von Nassau zum halben Miteigentum übertragen
worden. Diese Doppelherrschaft zwischen Kurköln und Nassau - die
Stadt hatte am 19. Oktober 1303 das Soester Stadtrecht erhalten
- hielt bis Ende des 14. Jahrhunderts an. Erst dann ging sie
gänzlich in die Hände der Grafen von Nassau-Dillenburg über. Die
Stadt Siegen bot im 16. Jahrhundert einen wehrhaften Anblick.
Sie war von hohen Mauern mit 16 Türmen umgeben und sie besaß
eine mächtige Burg. Zur Siegener Stadtbefestigung gehörten drei
Tore: das Kölner Tor nach Westen, das Löhrtor nach Süden und das
Marburger Tor nach Osten.
Die innere Verwaltung der
Grafschaft Nassau-Dillenburg bestand im Spätmittelalter und in
der Frühen Neuzeit aus einer Zentralverwaltung und zwei
nachgeordneten Behördenorganisationen, den Gerichten und den
Ämtern. Der Bereich Siegen war, seit der Erbteilung von 1255 zum
ottonischen Territorium gehörend und seit 1343 einen Teil der
Grafschaft Nassau-Dillenburg bildend, eine geschlossene und
unzerteilte Verwaltungseinheit bis 1606. Die Zentralverwaltung
der Grafschaft befand sich in der gräflichen Residenz zu
Dillenburg in Form der gräflichen Kanzlei. Vertreter des Grafen,
oberster Beamter/Befehlshaber und Vorgesetzter für alle
Verwaltungs- und Hoheitsaufgaben war der dort amtierende
Kanzler. Die Kanzlei in Dillenburg nahm die Gesetzgebung im
Namen des Landesherrn wahr, sie gab Anweisungen über die
Verwendung und Verwaltung der einkommenden Gelder und
Naturalabgaben und verfügte über das Kontroll- und
Revisionsrecht über die Beamten, also die Amtmänner, Rentmeister
und Kellner. Die Grafen unterhielten auf der Burg Siegen einen
speziellen Sitz für ihren Amtmann und Befehlshaber sowie dessen
Kanzlei. Ihm zur Seite standen der Rentmeister und der Kellner.
In gewisser Weise fungierte die Kanzlei zu Siegen als eine Art
Oberamt. Diesem waren seit dem Spätmittelalter kleinere Amts-
und Gerichtsbezirke nachgeordnet. Zu diesen gehörten
ursprünglich das Amt und Gericht Siegen vor dem Hain, das Amt
und Gericht Netphen, das Amt und Gericht Ferndorf und Krombach,
das Amt und Gericht Hilchenbach sowie das Amt und Gericht
Freudenberg. Die aus dem Spätmittelalter überkommenen Amts- und
Gerichtsbezirke bestanden bis zur Einverleibung des Fürstentums
Siegen in das Großherzogtum Berg zu Beginn des 19. Jahrhunderts
fort. Nur in der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts entstand das Amt
der Vierdorfschaften aus Ortschaften aus dem Amt und Gericht zu
Siegen vor dem Hain. Folgende Ortschaften, Wüstungen und Höfe
gehörten zu den jüngeren, seit 1813 existierenden
Amtsbezirken:
Amt Weidenau (bis 1807 Amt und Gericht
zu Siegen vorm Hain): Achenbach, Birlenbach, Bürbach,
Buschgotthardshütten, Charlottenthal, Dillnhütten, Fickenhütten,
Füsselsbach, Geisweid, Hardt, Hubach, Kaan, Klafeld, Marienborn,
Meinhardt, Münkershütten, Müsenershütten, Rehbach,
Schneppenkauten, Seelbach, Sohlbach, Sontagsgut, Trupbach,
Volnsberg, Weidenau.
Amt Netphen: Afholderbach,
Anzhausen, Beienbach, Brauersdorf, Breitenbach, Buchen,
Cuntzenbach, Deuz, Dreisbach, Dreistiefenbach, Eckmannshausen,
Eschenbach, Feuersbach, Flammersbach, Flocksdorf, Flöckersdorf,
Frohnhausen, Gangersdorf, Gernsdorf, Gillersdorf, Glabach,
Grissenbach, Hainchen, Helgersdorf, Heppersdorf, Herzhausen,
Hohenroth, Irmgarteichen, Lahnhof, Malbach, Mausthal, Nauholz,
Nenkersdorf, Netphen, Obernau, Ockersdorf, Oelgershausen,
Patschoß, Rudersdorf, Salchendorf, Setzen (Niedersetzen und
Obersetzen), Sohlbach, Tiefenbach, Unglinghausen, Walpersdorf,
Wampelshausen, Wernsbach, Werthenbach.
Amt Siegen:
Agnesenhof, Drupecher Mark, Hain, Hammerhütte, Heimbach,
Hermelsbach, Leimbach, Leimpe, Rinsenau, Siegen, Sieghütte,
Winchenbach.
Amt Ferndorf und Krombach: Ahe,
Bockenbach, Bottenbach, Bruchhausen, Buchen, Burgholdinghausen,
Buschhütten, Dornseifen, Eichen, Ersdorf, Fellinghausen,
Ferndorf, Hammerhaus, Heiminghausen, Herkinghausen, Irlen,
Junkernhees, Kredenbach, Kreuztal, Krombach, Langenau, Littfeld,
Lohe, Osthelden, Stendenbach, Vormberg, Weiden, Wüstenhof.
Amt Freudenberg: Alchen, Anstoß, Asdorf, Berghaus,
Bockseifen, Bottenberg, Bruch, Bühl, Büschen, Büschergrund,
Dirlenbach, Dröningen, Eichen, Engelbrecht (auch Engelberth),
Fischbach (Oberfischbach), Freudenberg, Gambach, Gengschladen,
Halmenhof, Heisberg, Herlingen, Heuslingen, Heuslinger Grund,
Hohenhain, Holzklau, Homelinghausen, Langenholdinghausen,
Lindenberg, Mausbach, Meiswinkel, Mittelhees, Niederndorf,
Oberhees, Oberschelden, Odendorf, Ohrndorf, Plittershagen,
Reichelsbach, Stöcken (Niederstöcken und Oberstöcken), Uebach,
Weningen, Wurmbach, Zeitenbach.
Amt Hilchenbach (auch
Amt Keppel): Allenbach, Altenteich, Breidenbach, Breidenscheid,
Dahlbruch, Ebinghausen, Elberndorf, Erzenbach, Ginsberg, Grund,
Haarhausen, Hadem, Helberhausen, Hilchenbach, Hillnhütten,
Keppel, Klingelseifen, Lützel, Merklinghausen, Müsen, Oberndorf,
Oechelhausen, Rodenberg, Ruckersfeld, Schreiberg, Schweisfurth,
Sterzenbach, Stöcken, Vormwald, Watzenseifen, Wehbach,
Winterbach.
Amt Wilnsdorf (bis 1807 Amt und Gericht
zu Siegen vorm Hain): Altmersdorf, Dielfen, Einsiedel, Eisern,
Eremitage, Hellingsdorf, Obersdorf, Ratzenscheit, Rindsberg,
Rinsdorf, Rödgen, Wilden, Wilgersdorf, Wilnsdorf,
Windhain.
Amt Eiserfeld (bis 1807 Amt und Gericht zu
Siegen vorm Hain): Eiserfeld, Gosenbach, Hengsbach, Lurzenbach,
Niederschelden, Rulsdorf, Untertan.
Amt
Vierdorfschaften (seit 1. Hälfte 17. Jahrhundert):
Niederschelden, Trupbach, Seelbach, Klafeld, Weidenau,
Gosenbach.
Parallel zur weltlichen
Verwaltungsstruktur gab es die kirchliche Verwaltungshierarchie.
Im Mittelalter gehörte das Siegerland zur Erzdiözese Mainz,
speziell zum Archidiakonat St. Stephan in Mainz. Die Grafschaft
Wittgenstein und das Siegerland zusammen bildeten eine der drei
Dekanate dieses Archidiakonates: das Dekanat Arfeld.
Hinsichtlich der Urpfarreien teilte sich das Siegerland in zwei
Sendbezirke als Unterabteilungen des Dekanats: die Sedes in
Siegen und die Sedes in Netphen. Am Sedes-Sitz fanden die Send-
und Rügegerichte der kirchlichen Behörde statt. Als Sendbezirke
hatten sie jedoch nichts mit einem bloßen Pfarrsitz gemeinsam.
In der Sedes Siegen befanden sich in vorreformatorischer Zeit
die Kirchspiele und Pfarreien Siegen, Oberfischbach,
Oberholzklau, Ferndorf und Krombach, im Sedes Netphen hingegen
die Kirchspiele und Pfarreien Netphen, Irmgarteichen,
Hilchenbach und Rödgen.
Der Bruder des Grafen
Heinrich III. (*1483, 1538), Graf Wilhelm von
Nassau-Dillenburg, genannt der Reiche (*1487, reg. 1516-1559),
erbte 1516 das Dillenburger Land. Er führte dort von 1530 bis
1536 die Reformation ein, behielt aber die alte
Kirchenorganisation der Kirchspiele und Pfarreien bei. 1536
wurde die Stelle eines Superintendenten als oberste kirchliche
Behörde der nassauischen Ämter Dillenburg und Siegen geschaffen.
1546 erließ Graf Wilhelm von Nassau-Dillenburg (*1487, reg.
1516-1559) eine Kirchen- und Schulordnung. 1570 wurde in Siegen
eine eigene Superintendentur geschaffen, die jedoch einem
Generalsuperintendenten in Dillenburg unterstellt war. Obwohl
1570 eine lutherische Kirchenvisitationsordnung für
Nassau-Dillenburg erlassen wurde, ließ Graf Johann VI. (*1536,
reg. 1559-1606) 1573 das calvinistische Glaubensbekenntnis
einführen, was wiederum eine Reihe neuer Kirchenordnungen und
neuer Einrichtungen zur Folge hatte. In diesem Zusammenhang kam
es zur Bildung eigener Kirchspiele und Pfarreien in Freudenberg
und Müsen. Bereits kurz nach Einführung der Reformation kam es
zu Vereinigung der beiden Kirchspiele Wilnsdorf und Rödgen. Seit
1578 bzw. 1586 bildeten die nassauischen Territorien zusammen
mit den Grafschaften Sayn-Wittgenstein, Solms, Wied und Ysenburg
eine gemeinsame Generalsynode mit Sitz in Herborn.
Mitte des 16. Jahrhunderts gewann die ottonische Linie der
Grafen von Nassau politischen Einfluss europäischer Tragweite.
Wie bereits erwähnt, trat der älteste Sohn des Grafen Wilhelms
des Reichen, Wilhelm I. ("der Schweiger") (*1533, reg.
1545-1584) das Erbe der Herrschaft Breda und des Fürstentums
Oranien an. Als Statthalter der Niederlande führten er und seine
Söhne Philipp Wilhelm (*1554, reg. 1609-1618), Moritz (*1567,
reg. 1618-1625) und Friedrich Heinrich (*1584, reg. 1625-1647)
im Befreiungskrieg von 1568 bis 1648 die Niederlande in die
Unabhängigkeit. Die oranische Linie behielt ihren Einfluss und
ihre Stellung in den Generalstaaten, die sich 1581 von Spanien
losgesagt hatten, auch nach der Ermordung Wilhelms von Oranien
1584 bei. Die Fürsten von Oranien fungierten in den Niederlanden
als Generalstatthalter und Generalkapitäne bzw. Großadmiräle.
Der Sohn Wilhelms, Moritz von Oranien, legte sogar den
Grundstein für die holländische Großmachtstellung im 17.
Jahrhundert. Der Urenkel des Prinzen Wilhelms I. von Oranien,
Wilhelm III. von Oranien-Nassau (*1650, 1702), der ”letzte
Oranier“, erlangte 1688 sogar die englische Krone. Sein
niederländisches Erbe fiel jedoch an die Linie
Nassau-Diez.
Der jüngere Bruder Wilhelms von Oranien,
Graf Johann VI., genannt der Ältere, zu Nassau-Dillenburg
(*1536, reg. 1559-1606), konnte nach dem Erlöschen der älteren
Beilsteiner Linie im Jahr 1561 wieder die gesamten ottonischen
Stammlande in seiner Hand vereinigen. Er gründete 1584 die lange
Zeit überregional bedeutsame reformierte Hohe Schule zu Herborn.
Nach seinem Tod wurde das Land unter seinen Söhnen aufgeteilt,
eine Teilung, die bis 1743 anhalten sollte.
Die Grafschaft bzw. das Fürstentum Nassau-Siegen bis zu
ihrem Erlöschen 1606-1743
In seinem Testament hatte
Graf Johann VI. den Gepflogenheiten des Hauses Nassau
entsprechend den gräflichen Besitz unter seinen Söhnen
aufgeteilt, die alle eine militärische Ausbildung in den
Niederlanden und eine sorgfältige Erziehung und Bildung im Sinne
des Calvinismus genossen hatten. Graf Johann VII. (*1561, reg.
1606-1623) erhielt Siegen, Graf Wilhelm Ludwig (*1560, reg.
1606-1620) bekam Dillenburg, Graf Georg (*1562, reg. 1606-1623)
die Herrschaft Beilstein, den Westerwald, das Amt Burbach, den
Hickengrund und das Stuhlgebiet, Graf Ernst Kasimir (*1573, reg.
1606-1632) die Grafschaft Diez und Graf Johann Ludwig (*1590,
reg. 1606-1653) Hadamar, Ellar, die Esterau sowie ein Viertel an
Camberg, Altweilnau und Kirberg. Hier eine Übersicht der nach
1606 entstandenen Territorien und deren Verbleib bzw.
Anfall:
Nassau-Hadamar, jüngere Linie (1607-1711),
1629 katholisch, 1650 gefürstet, 1711 geteilt, 1743 ganz an
Diez
Nassau-Siegen, (1607-1623), 1623 geteilt
in:
Nassau-Siegen, reformierte Linie (1623-1734),
1664 gefürstet, fällt
an Siegen (katholisch)
Nassau-Siegen, katholische Linie (1623-1743), 1652
gefürstet,1743 an Diez
Nassau-Dillenburg,
(1607-1620), von Beilstein beerbt
Nassau-Beilstein,
jüngere Linie, ab 1620 Nassau-Dillenburg, jüngere
Linie (1607-1739), 1652 gefürstet, 1739 an Diez, und
Nassau-Diez (1607-1890)
Die Söhne des Grafen
Johann VI. von Nassau-Dillenburg regierten anfänglich noch
gemeinschaftlich, schlossen jedoch 1607 einen Erbverein, der
1618 und 1636 noch einmal erweitert wurde. Graf Johann VII. nahm
1607 das ehemalige Amt Siegen in Besitz und wurde Gründer der
Siegener Linie des nassauischen Gesamthauses. Um eine weitere
Aufsplitterung seines Territoriums für die Zukunft zu vermeiden,
bestimmte Graf Johann VII. in seinem Testament vom 8. April 1607
seinen ältesten Sohn aus erster Ehe, Johann, als seinen
alleinigen Nachfolger. Die Primogenitur sollte in der Erbfolge
der Grafschaft Nassau-Siegen fortan oberstes Gesetz sein. In der
Grafschaft selbst blieben unter Johann VII. die überkommenen
Verwaltungsstrukturen vorerst bestehen. Auf der Burg Siegen
amtierte ein Amtmann und Befehlshaber im Auftrag des Grafen.
Ferner gab es einen Kanzler mit Sekretär(en), Räte, Hofmeister
und diverse Spezialbeamte am Hof des Landesherrn, die zum Teil
mehrere Ämter in Personalunion innehatten. Zur obersten
Verwaltung gehörten zum Beispiel auch die Rentmeister und
Kellner, Landschreiber und (Kammer-)Sekretäre. An nachgeordnetem
Verwaltungspersonal gab es die Schultheißen und Gerichtsknechte
in der Stadt Siegen und in den Ämtern und Gerichten zu Siegen
vor dem Hain (Haingericht), Netphen, Hilchenbach,
Ferndorf-Krombach, Freudenberg und später
Vierdorfschaften.
Graf Johann VIII. von Nassau-Siegen
(*1583, reg. 1623-1638), ältester Sohn des Grafen Johann VII.
von Nassau-Siegen, lag sowohl religiös als auch politisch
überhaupt nicht auf der Linie seines Vaters. 1608 trat er
heimlich zum katholischen Glauben über, 1612/13 dann offiziell.
1614 wechselte er vom traditionellen Heeresdienst in den
Niederlanden über in den militärischen Dienst des Herzogs von
Savoyen, von 1615-1617 in den Dienst des französischen Königs.
Die neuen Dienstherren waren alle katholische Landesfürsten.
Angesichts der politischen und militärischen Ausrichtung Johanns
VIII. wuchsen die Bedenken des calvinistisch erzogenen Vaters.
Und so ist es nicht verwunderlich, dass Graf Johann VII. der
1617 abgegebenen Versicherung seines ältesten Sohnes misstraute,
im Falle der Thronfolge den Bekenntnisstand seiner Grafschaft
beizubehalten. Er ließ am 15. November 1617 sein Testament von
1607 kassieren und ein zweites aufsetzen, welches zwar die
Primogenitur aufrecht erhielt, jedoch für den Fall einer
erzwungenen Rekatholisierung des Landes mit Verlust der
Erbschaft drohte. Diese Maßnahme verstand sich offenkundig als
Drohung gegenüber seinem ältesten Sohn, es mit dem katholischen
Glaubensbekenntnis nicht zu übertreiben. Doch Johann VIII. ging
seinen eigenen Weg. Er heiratete 1618 die reich begüterte
Prinzessin Ernestine Yolande von Ligne (*1594, 1668) und trat
gegen den Willen seines Vaters zur katholischen Kirche über. Auf
Betreiben seiner calvinistisch erzogenen Kinder, die um ihr Erbe
bangen mussten, hob Graf Johann VII. schließlich in seinem
dritten und zugleich letzten Testament vom 3. Juli 1621 zur
Sicherung des reformierten Glaubens die von ihm selbst
eigeführte Primogeniturordnung auf und verfügte stattdessen die
Aufteilung der Grafschaft Nassau-Siegen in drei Stammteile wie
folgt:
1.Graf Johann VIII. (Nassau-Siegen) erhielt a)
Schloss und Haus Siegen und die dortigen gräflichen Besitzungen,
b) das Amt Netphen mit Ausnahme einiger Orte, c) das ehemalige
Amt und Gericht Siegen vorm Hain mit den Kirchspielen Rödgen,
Wilnsdorf und Siegen ohne das Amt der Vierdorfschaften.
2.Graf Wilhelm (Nassau-Hilchenbach) erhielt a) Haus und Hof
Ginsberg, b) die Ämter Hilchenbach und Ferndorf-Krombach, c) die
Orte Kredenbach, Bottenbach, Buschhütten des bisherigen Amts
Netphen und die Orte Ruckersfeld und Oechelhausen.
3.Alle Söhne aus zweiter Ehe, darunter auch Johann Moritz,
erhielten a) als Residenz das ehemalige Franziskanerkloster in
Siegen, b) das Amt Freudenberg, c) vom Haingericht die rechts
der Sieg gelegenen Orte Niederschelden, Trupbach, Seelbach,
Klafeld und mehrere Hütten und Hämmer sowie d) das Amt der vier
Dorfschaften.
Jeder Stammteil hatte folgende Rechte:
Oberherrlichkeit und Gerechtigkeit, Weisungsbefugnis (Gebot und
Verbot), Untergericht, Jagd, Fischerei und Bergwerk.
Gemeinschaftlich waren zu regeln: a) Huldigungen, Lehen und
Belehnungen, b) Verwaltung der Kirchen, Schulen, Hospitäler
(besonders des Stifts Keppel, c) die Stadt Siegen mit einem
gemeinschaftlichen Stadtschultheißen als landesherrlichen
Beamten sowie die Einnahmen aus der Stadt, d) die
Kriminalgerichtsbarkeit, e) die gesamte Gesetzgebung und f) die
Kanzlei mit Kanzler und Sekretär.
Die ohnehin schon
territorial bescheiden und damit wirtschaftlich und
finanzpolitisch nicht sehr stark ausfallende Grafschaft
Nassau-Siegen war durch die Aufteilung in drei Stammteile so
filetiert worden, dass aus einem Kleinstaat drei Kleinststaaten
geschaffen worden waren. Deren Finanzkraft musste in der
Folgezeit so gering ausfallen, dass eine standesgemäße
Hofhaltung der Grafen in weite Ferne rückte, wenn nicht andere
Einkommensmöglichkeiten gesucht wurden. Auch sollte die
prätendierte Kleinstaaterei dazu führen, dass die Grafen der
Stammteile sich mit Prozessen überhäuften. Meist ging es um
Besitz, Rechte, Schulden, Ansprüche und Versorgungsdetails.
Dabei blieb die Zugehörigkeit einzelner Ortschaften zu den
Ämtern kein starres System. In den folgenden Jahrzehnten kam es
im Rahmen von Hausverträgen gelegentlich zu Änderungen, so dass
sich Ämter hinsichtlich der Anzahl ihrer Gemeinden vergrößerten
oder verkleinerten.
Noch bevor Graf Johann VII. von
Nassau-Siegen am 27. September 1623 verstarb, ging sein
katholisch gesinnter Sohn Johann VIII. daran, das väterliche
Testament von 1621 anzufechten und stattdessen dem kassierten
Testament von 1607, das ihm die Alleinherrschaft des Landes
zugestanden hatte, Geltung zu verschaffen. Nach dem Tod seines
Vaters schloss er im Januar 1624 mit Graf Wilhelm von
Nassau-Hilchenbach und mit der verwitweten Gräfin Margaretha von
Nassau-Siegen (*1583, 1638), geborene Prinzessin von
Holstein-Sonderburg-Plön, als Vertreterin der Kinder aus der
zweiten Ehe Verträge, die im Wesentlichen
Schuldenangelegenheiten regelten. Allerdings konnte Graf Johann
VIII. den Kaiser für sich gewinnen, der es angesichts der durch
den Krieg geschwächten reformierten Kräfte des Hauses Nassau
später annullierte. Bereits 1624 wiederrief Johann VIII. seine
einstigen Versprechungen über die Beibehaltung des reformierten
Bekenntnisses in seinem Territorium und begann unverzüglich mit
der Rekatholisierung seiner Grafschaft. Wesentliche Hilfe
leisteten ihm dabei die 1626 nach Siegen geholten Jesuiten, ab
1632 auch die Franziskaner. Als der Kaiser ihm nach
Verabschiedung des Restitutionsediktes von 1629 die von Graf
Johann VI. eingezogenen Klostergüter der Grafschaft Diez
zurückerstattete, war Graf Johann VIII. endgültig auf dessen
politische Seite zurückgekehrt. Er setzte nunmehr alles daran,
seine protestantischen Brüder und Verwandten, die von
kaiserlicher Seite des Hochverrats bezichtigt wurden, aus ihrem
Besitz und ihren Gerechtsamen zu verdrängen. Maßgeblich dem
diplomatischen Geschick des Grafen Johann Ludwig von
Nassau-Hadamar, dem Jüngsten Sohn Graf Johanns VI. zu
Nassau-Dillenburg, war es zu verdanken, dass 1629 dem Haus
Nassau weiteres Unheil erspart blieb. Doch auch Johann Ludwig
unterlag der Gegenreformation und konvertierte zum katholischen
Glauben, wodurch eine zweite Teilgrafschaft auf die
habsburgische Linie einschwenkte. Ihm ging es nun darum, bei den
Verhandlungen in Wien die in Nassau-Diez befindlichen Klöster in
seinen Besitz zu bringen. Dagegen protestierte wiederum
Kurtrier, weil die katholischen Grafen von Nassau-Siegen und
Nassau-Hadamar den Klosterbesitz nicht den alten Orden
zurückgeben, sondern den Jesuiten und damit der katholischen
Schulbildung überlassen wollten.
Nach der Niederlage
des böhmischen Königs Friedrich I. (*1596, reg. 1618-1620,
1632) kam es zur Schwächung der Protestanten und damit der
reformierten ottonischen Linien des Hauses Nassau, die über die
Dauer des Krieges vor einer konfessionellen und politischen
Zerreißprobe standen. Leidtragende war die Bevölkerung der
nassauischen Grafschaften, die über die Dauer des Krieges
Kontributionen, Einquartierungen und Truppendurchmärsche
ertragen mussten. Mit dem Eingreifen des Königs Gustav II.
Adolph von Schweden (*1594, reg. 1611-1632) in den
Dreißigjährigen Krieg 1630 ergriffen die protestantischen Grafen
zu Nassau die Gelegenheit, ihre Interessen gegen ihre
katholischen Verwandten durchzusetzen. Namentlich Graf Ludwig
Heinrich von Nassau-Dillenburg (*1594, reg. 1623-1662), Sohn des
Grafen Georg von Nassau-Beilstein, diente auf Seite Schwedens,
solange das Kriegsglück anhielt. Nach der Niederlage der
Protestanten in der Schlacht bei Nördlingen am 6. September 1634
sah sich Graf Ludwig Heinrich jedoch zu einer politischen
Kehrtwende gezwungen, um nicht sein Territorium einzubüßen. 1635
trat er auf die Seite des Kaisers über und stellte ihm Truppen
zur Verfügung. Durch den Wechsel der politischen Seiten konnte
Graf Ludwig Heinrich am wirkungsvollsten den Ansprüchen seiner
katholischen Verwandten in Siegen und Hadamar entgegentreten.
Auch verhinderte er, dass ihn das Schicksal ereilte wie seinen
Verwandten aus der walramischen Linie, deren Territorien vom
Kaiser konfisziert worden waren. Überhaupt sahen besonders die
Grafen Johann VIII. von Nassau-Siegen und Ludwig Heinrich von
Nassau-Dillenburg durch die Einziehung der walramischen
Territorien eine günstige Gelegenheit, ihre Besitzungen zu
erweitern bzw. abzurunden. Erst nachdem Kaiser Ferdinand III.
(*1608, reg. 1637-1657) die Grafen der walramschen Linie 1640
amnestiert hatte, waren die Arrondierungspläne der katholischen
Grafen zu Nassau-Siegen und Nassau-Dillenburg vorerst
gescheitert.
Nach dem Tod des Grafen Johann VIII. von
Nassau-Siegen 1638 wurde dessen noch minderjähriger katholisch
erzogener Sohn Johann Franz Desideratus (*1627, reg. 1638-1699)
designierter Nachfolger. Bis zu dessen Volljährigkeit führte
eine vormundschaftliche Regierung unter seiner Mutter Ernestine
Yolande Prinzessin von Ligne die Regierungsgeschäfte in
Nassau-Siegen.
Am Ende des Dreißigjährigen Krieges
waren die Territorien der ottonischen Linien Nassaus
wirtschaftlich und finanziell erschöpft sowie stark verwüstet.
Aufgrund der konfessionellen Spaltung des Grafenhauses hatten
sich tiefreichende Zwistigkeiten nicht nur unter den
Landesherren, sondern auch in der Bevölkerung verfestigt. In
Nassau-Siegen hatten es weder Graf Johann VIII., noch die
vormundschaftliche Regierung seines minderjährigen Sohnes
vermocht, die katholische Gegenreformation vollständig
durchzuführen. Vielmehr wurde die konfessionelle Spaltung der
Grafschaft Nassau-Siegen endgültig, als der reformierte Bruder
des Grafen Johann VIII., Johann Moritz (*1604, 1679), der
Rekatholisierung seines Landesteils entgegensteuerte und 1649
Ansprüche aus dem Testament seines Vaters von 1612 mit
kaiserlicher Zustimmung durchsetzen konnte. Johann Moritz von
Nassau-Siegen gehörte zu den schillerndsten Persönlichkeiten des
Hauses Nassau-Siegen. Er hatte viele Jahre im Dienst der
niederländischen Westindienkompanie gestanden und wurde als
Begründer von Moritzburg (Recife) in Brasilien bekannt. Er war
ein Freund des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg
(*1620, reg. 1640-1688) und bekleidete zahlreiche Ämter in
brandenburgischen Diensten.
Das kaisertreue Verhalten
der ottonischen Linien während des Dreißigjährigen Krieges
belohnte Kaiser Ferdinand III. nach dem Westfälischen Frieden
mit einer Reihe von Standeserhöhungen. Als erster Nassauer Graf
erhielt Johann Ludwig von Nassau-Hadamar 1650 die
Reichsfürstenwürde. Ihm folgten am 25. November 1652 Johann
Moritz von Nassau-Siegen, Ludwig Heinrich von Nassau-Dillenburg,
Wilhelm Friedrich von Nassau-Diez und Johann Franz von der
katholischen Linie Nassau-Siegen. 1654 erhielten die Nassauer
Fürsten Sitz und Stimme im Reichstag als Reichsfürsten in der
Reihenfolge Nassau-Hadamar, Nassau-Dillenburg, Nassau-Siegen,
Nassau-Diez. Am 6. Mai 1664 wurde auch den restlichen Grafen der
reformierten Linie Nassau-Siegens die Fürstenwürde übertragen.
Finanzielle oder wirtschaftliche Vorteile ergaben sich aus den
Standeserhöhungen nicht.
Nach dem Dreißigjährigen
Krieg begannen die Grafen und Fürsten der ottonischen Linien mit
dem Wiederaufbau ihrer Territorien. Sie erließen zahlreiche
Gesetze und Verordnungen, um die Wirtschaft,
Gesundheitsfürsorge, Kirchenzucht und Moral der Bevölkerung zu
heben. Allerdings ergriffen die Fürsten auch Maßnahmen zum
Ausbau ihrer Territorialherrschaft. Aufgrund der vorherrschenden
Entvölkerung kauften sie massiv brachliegende Grundstücke,
Wälder, Mühlen, Höfe und Dörfer innerhalb ihres
Herrschaftsbereichs auf, um eigene Hofgüter und Vorwerke
einzurichten oder um ihre Jagdgebiete zu erweitern. Diese
Maßnahmen - vor allem die Verpachtung herrschaftlicher Güter und
Gefälle - ließen die staatlichen Einnahmen der Fürsten
allmählich wieder ansteigen, die ihrerseits in die Hofhaltung
investierten und ihre Territorien ganz im Sinne absolutistischen
Denkens verwalten ließen.
Nachteilig für das
allgemeinbildende Schulwesen waren die territoriale und
konfessionelle Aufsplitterung der nassauischen Territorien sowie
der Dreißigjährige Krieg. Bis zum Ende des Krieges hatten sich
in den Teilgrafschaften eigene Schulsysteme entwickelt. In den
rekatholisierten Grafschaften/Fürstentümern Nassau-Siegen und
Nassau-Hadamar wirkten Jesuiten und Franziskaner im Sinne der
Erziehung der Gegenreformation. Die Hohe Schule Herborn hatte
indessen ihre Bedeutung als geistiges Zentrum des deutschen
Calvinismus verloren.
Hemmend auf die wirtschaftliche
Gesundung der nassauischen Fürstentümer wirkten sich seit der
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ausbrechende Streitigkeiten
um die Erbfolge bzw. Sukzessionen der ottonischen Fürsten aus.
Erlosch eine Linie, beanspruchten sofort die verbliebenen Häuser
Anrechte auf Gebiete, Einkünfte und Besitztitel. Besonders
heftig fiel der Erbfolgestreit 1702 aus, nachdem Wilhelm III.
von Nassau-Oranien als Statthalter der Vereinigten Niederlande
und König von England ohne männliche Nachkommen verstorben war.
Um den oranischen Erbteil stritten nicht nur die nassauischen
Fürsten, sondern auch die Könige von Frankreich und Preußen.
Wilhelm III. von Nassau-Oranien hatte sein Patenkind Johann
Wilhelm Friso von Nassau-Diez (*1687, reg. 1696-1711) zum
Nachfolger seiner oranischen Besitzungen auserkoren. Dagegen
protestierte der katholische Fürst Wilhelm Hyacinth von
Nassau-Siegen (*1666, reg. 1699-1743), weil laut Hausverträgen
die ältere, das heißt die Siegener Linie zunächst erbberechtigt
war. Wilhelm Hyacinths Pläne wurden jedoch durchkreuzt, als
König Ludwig XIV. von Frankreich (*1638, reg. 1643-1715) das
Fürstentum Orange kurzerhand für die französische Krone einnahm.
1713 fiel Oranien im Rahmen des Friedens von Utrecht endgültig
an Frankreich und schied damit aus dem Heiligen Römischen Reich
aus.
Die Hofhaltung, mit der Wilhelm Hyacinth seinen
Anspruch auf die oranische Erbschaft unterstreichen wollte, die
Reisen und Geschenke kosteten weit mehr als die Einnahmen aus
dem katholischen Landesteil Nassau-Siegens erbrachten. Der Fürst
nahm daher beachtliche Kapitalien bei den Frankfurter Bankiers
De Rhön und Schonemann auf, verpfändete die Dörfer Wilnsdorf und
Wilgersdorf für 20.000 Taler und erhöhte drastisch die Steuern
im ganzen Land. Eine weitere Einnahmequelle (die seinen Ruf im
Lande weiter schadete) waren Strafgelder in unerhörter
Höhe.
Fürst Wilhelm Hyacinth von Nassau-Siegen war
von Natur aus keine einfache Persönlichkeit. Er war ein
Querulant, jähzornig und krankhaft ehrgeizig. Das waren
offenkundige Eigenschaften, die auch die eigene Familie an ihm
fürchtete, vor allem dann, wenn in der großen Politik die Dinge
nicht so liefen, wie er es sich ausgemalt hatte. Hierzu zählten
Huldigungsdifferenzen mit den reformierten Fürsten von
Nassau-Siegen, Sukzessionsstreitigkeiten wegen des erledigten
Stammteils des reformierten Fürsten Moritz und wegen des
Hilchenbacher Stammteils, erbrechtliche Auseinandersetzungen mit
den Kindern seines Vaters aus letzter Ehe sowie wegen der
oranischen Erbschaft nach dem Tod Wilhelm III. von
Nassau-Oranien als König von England. Seine Verschwendungssucht
und offenkundige Unfähigkeit, sein Territorium wirtschaftlich
und finanziell zu stärken, machten die Lage nicht einfacher. Als
sein reformierter Verwandter Fürst Friedrich Wilhelm I. Adolf
von Nassau-Siegen (*1680, reg. 1691-1722) auch noch sein
Missfallen vor allem wegen der Sukzession und Sequestration des
Hilchenbacher Stammteils erregte, ließ er kurzerhand die Kanonen
seines Schlosses auf den Sitz seines Vetters richten, um seine
Macht zu demonstrieren. Daraufhin trug Fürst Friedrich Wilhelm
I. Adolf von Nassau-Siegen seine Klage in der Ständeversammlung
des Westfälischen Reichskreises vor. Als Wilhelm Hyacinth 1705
am Wiener Hof um Unterstützung seiner Erbansprüche bezüglich des
Hilchenbacher Stammteils warb, besetzten in der Zwischenzeit
preußische Truppen Siegen. Getrieben von Misswirtschaft und
unerträglichen Religionsverhältnissen, nutzten besonders
reformierte Bevölkerungsteile die Gunst der Stunde und
plünderten während der Abwesenheit des katholischen Fürsten
dessen Schloss in Siegen. Die Folge war, dass Fürst Wilhelm
Hyacinth beim Reichshofrat gegen seinen reformierten Vetter
Klage wegen Landfriedensbruchs und wegen Invasion seines Landes
durch preußische Truppen erhob.
Die Reihe der Klagen
über das harte und intolerante Verhalten des katholischen
Fürsten und seiner Regierung rissen nicht ab. Der Kaiser sah
sich gezwungen, den Religionsfrieden in Nassau-Siegen zu sichern
und Maßnahmen gegen die ruinöse Finanzpolitik des katholischen
Fürsten und seiner Berater zu ergreifen. Im Auftrag des
Reichshofrats wurde die Stadt Siegen am 15. Juli 1706 erneut
durch Truppen aus Pfalz-Neuburg und Preußen besetzt. Der Kanzler
Wilhelm Hyacinths, de Colomba, der an den unerträglichen
Zuständen wesentlichen Mitanteil hatte, wurde verhaftet und mit
Urteil vom 20. Dezember 1710 lebenslang aus dem Deutschen Reich
verbannt. Wilhelm Hyacinth sah sich gezwungen, angesichts des
fremden Militärs vorübergehend zu seinem Vetter Franz Alexander
(*1674, reg. 1679-1711) nach Hadamar zu flüchten.
Die
anhaltende Unzufriedenheit vor allem der evangelischen
Bevölkerung provozierte schließlich 1707 eine offene Revolte im
katholischen Teil Nassau-Siegens, bei der Fürst Wilhelm Hyacinth
am 29. März 1707 einen mutmaßlichen Anführer der Aufständischen,
Friedrich Flender von der Hardt, ohne jegliche Verhandlung
enthaupten ließ. Diesen Vorfall nahm Kaiser Joseph I. (*1676,
reg. 1705-1711) als Anlass, Wilhelm Hyacinth seines Fürstentums
verlustig zu erklären. Es wurden zwei kaiserliche Räte als
Verwalter des katholischen Landesteils Nassau-Siegens
eingesetzt. Die Geschäfte für sie übernahm fortan eine
kaiserliche Administrationsregierung in Siegen.
Infolge des Verlustes seines Fürstentums war Fürst Wilhelm
Hyacinth politisch gesehen erledigt. Er erhielt ein jährliches
Deputat von 4.000 Talern, während das restliche Vermögen für die
Ansprüche der Stiefmutter und Geschwister, der Gläubiger und als
Ehrenschuld gegen die Familie des Friedrich Flender verwendet
wurde. Weder seine Beschwerde an den Kaiser noch beim Reichstag
zu Regensburg auf Restitution führten zum Erfolg. 1713 wurde ihm
der Titel Graf von Chalon, welchen er ebenfalls führte, durch
Frankreich aberkannt, welches durch den Frieden von Utrecht das
Fürstentum Orange und die Herrschaften Chalon und Chatel
erhalten hatte. Wilhelm Hyacinth verdingte sich anschließend in
spanischen Diensten und versuchte noch jahrzehntelang, sein
Fürstentum rückerstattet zu bekommen.
Mit dem Tod des
Fürsten Franz Alexander von Nassau-Hadamar am 22. Mai 1711 stand
die Erbfolge des erledigten Fürstentums an. Die ottonischen
Linien in Dillenburg, Diez und Siegen verwalteten es zunächst
gemeinsam, mussten sich jedoch mit der Witwe und den Töchtern
des Fürsten Franz Alexander erbrechtlich auseinandersetzen. 1717
kam es schließlich zur Erbteilung Nassau-Hadamars. Der
katholische Landesteil Nassau-Siegens erhielt Stadt und Schloss
Hadamar, einige Orte aus der Dehrner Zehnt und aus dem
Kirchspiel Zeuzheim. Der reformierte Landesteil Nassau-Siegens
bekam ebenfalls Orte und Höfe aus dem Dehrner Zehnt, Nassau-Diez
die Kirchspiele Hellenhahn, Elsoff (Westerwald), Rennerod,
Rotenhain und Höhn zu Holzenhausen, Seck und Dapperich. An
Nassau-Dillenburg fiel das Amt Mengerskirchen und die
Kirchspiele Lahr und Frickhofen. Der Streit um das Hadamarsche
Erbe drohte jedoch zu eskalieren, weil Fürst Wilhelm Hyacinth
diese Aufteilung des erledigten Fürstentums ablehnte. Vielmehr
trieb er den Prozess vor dem Reichshofrat an und zwang die
streitenden Parteien, sich Verbündete unter den katholischen und
protestantischen Reichsständen zu suchen. Auf Seiten der
katholischen Fürsten von Nassau-Siegen ergriffen die Kurfürsten
von Köln, Trier und Pfalz Partei, die protestantischen Fürsten
zu Nassau-Siegen, Nassau-Diez und Nassau-Dillenburg fanden
Unterstützung beim König in Preußen und beim Landgrafen von
Hessen-Kassel. Alle beteiligten Parteien verfolgten dabei eigene
Interessen. Der Hadamarsche Sukzessionsstreit hielt auch noch
an, nachdem der Kaiser 1728 der Landesteilung zugestimmt
hatte.
Die 1730er Jahre waren für das Fürstentum
Nassau-Siegen einschneidend. 1734 verstarb der letzte Fürst der
reformierten Linie, Friedrich Wilhelm II. von Nassau-Siegen
(*1706, reg. 1722-1734). Gegen den Wiederstand der evangelischen
Bevölkerung traten die katholischen Fürsten Emanuel Ignatius
(*1688, reg. 1727-1735) und Franz Hugo (*1678, reg. 1727-1735),
beide Halbbrüder des im Exil sitzenden und ebenfalls Ansprüche
erhebenden Fürsten Wilhelm Hyacinth, das Erbe des reformierten
Landesteils an. Nach dem Tod der beiden katholischen Fürsten
1735 besetzten Truppen aus Nassau-Dillenburg und Nassau-Diez
umgehend das Fürstentum Nassau-Siegen. In Siegen ließen die
Fürsten von Nassau-Dillenburg und Nassau-Diez eine
Deputationsregierung errichten, die 1737 für ein Jahr lang noch
einmal einer kaiserlichen Deputationsregierung weichen musste.
Als am 28. August 1739 Fürst Christian von Nassau-Dillenburg
(*1688, reg. 1701-1739) starb, fiel dessen Erbe an
Nassau-Diez.
Fürst Wilhelm IV. von Nassau-Diez
(*1711, 1751) musste sich nunmehr mit dem noch in Spanien
aufhaltenden Fürsten Wilhelm Hyacinth auseinandersetzen, der
selbstredend seine durchaus berechtigten Erbansprüche erhob.
Beide Fürsten einigten sich 1741 dahingehend, dass Wilhelm
Hyacinth das Fürstentum Hadamar zugesprochen bekam und
tatsächlich dorthin zurückkehrte. 1742 entsagte er gegen
geldliche Entschädigung endgültig der Herrschaft für sich und
sein Geschlecht über den katholischen Landesteil Nassau-Siegens.
So fielen zwei der drei Stammteile des Fürstentums an das einzig
noch bestehende Geschlecht der nassauisch-ottonischen Linie, an
die Fürsten von Nassau-Diez. Als Wilhelm Hyacinth am 18. Februar
1743 in Hadamar verstarb, wurde Fürst Wilhelm IV. von
Nassau-Diez Alleinerbe aller ottonischen Fürstentümer. Zwar
waren die Teilfürstentümer seit 1606 wieder in der Hand eines
regierenden Fürsten vereinigt, doch gehörte auch zu dessen Erbe
eine ungeheuer große Schuldenlast der erledigten Fürstenhäuser,
deren Tilgung trotz großer Anstrengungen in den folgenden
Jahrzehnten nicht wirklich gelang.
Das
Fürstentum Siegen unter Verwaltung Nassau-Oraniens von 1743 bis
1806
Nach dem Tod des letzten Fürsten von
Nassau-Siegen, Wilhelm Hyacinth, fiel das erloschene
Teilfürstentum 1743 an Fürst Wilhelm IV. von Oranien und
Nassau-Diez. Dieser trug nunmehr den Titel eines Fürsten von
Nassau-Oranien. Die seit 1606 getrennten ottonischen Stammlande
Nassaus befanden sich damit wieder in den Händen eines
regierenden Fürsten, der sich aber meist in den Niederlanden
aufhielt. Für die Teilfürstentümer Dillenburg, Diez, Siegen und
Hadamar wurde umgehend eine funktionsfähige gemeinschaftliche
Verwaltung geschaffen. Bereits 1742 wurde Dillenburg neuer
Zentralort und Sitz der Regierung für alle ottonischen
Teilfürstentümer, indem Fürst Wilhelm IV. von Nassau-Oranien die
Landesregierung, die Justizkanzlei, das Oberkonsistorium und die
Rent- und Hofkammer als obere Landesbehörden dort unterbringen
ließ. Die Landesregierung in Dillenburg unterhielt wiederum den
Kontakt zur Deutschen Kanzlei in Den Haag. Der Rentkammer wurden
zunächst über das Finanzwesen hinausreichende Funktionen in der
Forst-, Kommerzien-, Bergwerks- und Hüttenverwaltung zugewiesen.
1748 plante man die Errichtung einer Kommission, die regelmäßig
Waldbegehungen durchführen sollte, um den zunehmenden
Forstfrevel einzudämmen. In diesem Rahmen wurden seit 1751 unter
Leitung des Offiziers Johann Henrich von Pfau die Waldgebiete
der Teilfürstentümer vermessen und kartographisch erfasst. 1765
wurde für das Berg- und Hüttenwesen, dem wichtigsten in Nassau
unter staatlicher Regie betriebenen Gewerbezweig, eine aus dem
Ressort der Rentkammer entnommene besondere Bergwerks- und
Hüttenkommission in Dillenburg errichtet. Ihr nachgeordnet war
das Bergverhör in Siegen, eine Art Bergamt. Es setzte sich aus
den beiden Bergmeistern des unteren und oberen Reviers, einem
Hüttenkommissar und einem so genannten Bergverhör-Accessisten
als Gerichtsbeamten zusammen. In den einzelnen Revieren standen
gewählte Bergschöffen in den Gerichtsverhandlungen am
Berggericht den landesherrlichen Beamten zur Seite.
Auf der mittleren Verwaltungsebene richtete man
Unterdirektorien ein: in Siegen für die Teilfürstentümer Siegen
und Dillenburg, in Diez für die Teilfürstentümer Diez und
Hadamar. Die Mittelbehörden sollten die durch den
Zusammenschluss der Teilfürstentümer entstandenen Probleme
koordinieren und abstellen. Allerdings kam es 1781 zur Auflösung
des Unterdirektoriums zu Diez, da man offenbar dessen Funktion
in Frage gestellt hatte. In Siegen blieb hingegen das
Unterdirektorium bis in die Ära Napoleon bestehen.
Entgegen der mittleren war die untere Verwaltungsebene in
den Teilfürstentümern unterschiedlich strukturiert. In
Nassau-Diez und Nassau-Dillenburg bestand die alte
Ämterorganisation fort. In Nassau-Siegen und Nassau-Hadamar
fasste man 1743 per Regulativ die bisherigen Ämter zu
Amtskollegien mit Sitz in Siegen bzw. in Hadamar zusammen.
Aufgrund eingehender Kritiken seitens der Untertanen wurden per
Regulativ 1775 die alten Ämterstrukturen wieder eingeführt, ohne
allerdings die Unterdirektorien abzuschaffen. Diese fungierten
vielmehr als erste Instanz für Angelegenheiten aus den Ämtern.
Im Fürstentum Siegen sollten 1775 das Amt vor dem Hain mit dem
Amt der Vierdorfschaften, das Amt Hilchenbach mit einem Teil des
Niedergerichts Netphen und das Obergericht Netphen mit dem
Restteil des Niedergerichts Netphen vereinigt werden, doch kam
es nicht zur Umsetzung der Verordnung.
Im Zuge der
Vereinheitlichung bzw. Zusammenlegung der Verwaltungen führten
die Zentralbehörden in Dillenburg das Schriftgut der
Registraturen aus den Teilfürstentümern zusammen. Im Vordergrund
für diese Maßnahme standen weniger historisch-wissenschaftliche
Gesichtspunkte, sondern vielmehr rechtliche und administrative
Belange, indem man schnelleren Zugriff auf älteres
Verwaltungsschriftgut bekam. Die Neuordnung der Bestände
übernahm der Jurist Anton Ulrich von Erath (1709-1773), der bis
1747 in braunschweigischen Diensten gestanden hatte, um dann als
Regierungsrat und Archivar in Dillenburg zu fungieren. Nach dem
Siebenjährigen Krieg wurden alle Archivalien in einem speziellen
Archivgebäude in Dillenburg, welches 1765/66 errichtet worden
war, zusammengeführt. Es war das erste Archivgebäude seiner Art
im Nassauischen und firmierte als Oranien-Nassauisches Archiv zu
Dillenburg.
Nach dem Erlöschen des Siegener
Fürstenhauses durchlebte das Teilfürstentum Siegen bis zur
Eingliederung in die preußische Provinz Westfalen eine
nassau-oranische und eine großherzoglich-bergische
Staatlichkeit. Diese war von den entfernt regierenden Fürsten
und ihren Verwaltungsbeamten im Nassauischen, aber auch von den
Interessen der vormundschaftlich regierenden Fürsten geprägt.
Wilhelm Carl Heinrich Friso, so die eigentlichen Vornamen des
Prinzen, war am 1. September 1711 in Leeuwarden geboren. Sein
Vater war Johann Wilhelm Friso (1687-1711), Fürst von
Nassau-Diez, Fürst von Oranien und Statthalter von Friesland,
seine Mutter Prinzessin Marie Luise von Hessen-Kassel. Fürst
Johann Wilhelm Friso war sieben Wochen vor der Geburt seines
Sohnes bei einer Bootsüberfahrt ertrunken. Als Neugeborener war
Wilhelm Carl Heinrich Friso daher bereits dessen Erbe in
Friesland und im Fürstentum Nassau-Diez. Über seinen Vater hatte
er auch Erbansprüche auf die kontinentalen Titel und Ländereien
des 1702 verstorbenen Königs Wilhelm III. von England,
insbesondere auf das Fürstentum Oranien. Schon 1702 wurden die
väterlichen Erbansprüche aber von König Friedrich I. in Preußen
und von Fürst Wilhelm Hyacinth von Nassau-Siegen angefochten,
die ihrerseits Ansprüche auf Oranien erhoben. Erst der Frieden
von Utrecht 1713 schuf eine zufriedenstellende Regelung für alle
Erbberechtigten. Die Ländereien des Fürstentums Orange fielen an
Frankreich. Wilhelm Carl Heinrich Friso wurde der formelle Titel
des Fürsten von Oranien zuerkannt. Er nannte sich fortan Fürst
von Oranien-Nassau und betitelte entsprechend seines Fürstentums
Nassau mit dem Regierungssitz in Diez seinen Besitz als
”Fürstentum Oranien-Nassau“.
Infolge des frühzeitigen
Todes seines Vaters stand Wilhelm Carl Heinrich Friso zunächst
unter der Vormundschaft seines Großvaters mütterlicher Seite,
des Landgrafen Karl von Hessen-Kassel (*1654, reg. 1670-1730).
Landgraf Karl hatte besonderes Interesse an der Sicherung des
Diezer Erbes und ging Koalitionen mit Brandenburg, den
Niederlanden und England gegen König Ludwig XIV. von Frankreich
ein. Auch in militärstrategischer Hinsicht kam der
Niedergrafschaft Katzenelnbogen mit der Festung Rheinfels und
den nassauischen Fürstentümern an der Lahn große Bedeutung zu.
Für das Fürstentum Nassau-Diez hatte die vormundschaftliche
Regierung zur Folge, dass es in das Bündnisgeflecht zwischen
Hessen-Kassel, Brandenburg und England eingebunden wurde. Nach
Erreichung seiner Volljährigkeit setzte Fürst Wilhelm Carl
Heinrich Friso alles daran, die ehemals starke Stellung des
Hauses Oranien in den Niederlanden wiederzuerlangen. Mit Preußen
einigte er sich am 14. Mai 1732 wegen des oranischen Erbes und
überließ dem preußischen König das Fürstentum Mörs, die
Grafschaften Lingen und Montfort sowie die Herrschaften Turnhout
und Herstal. Beide Seiten kamen überein, in Titel und Wappen das
Fürstentum Oranien zu benennen und aufzuführen.
Zur
Festigung seiner englisch-oranischen Beziehungen heiratete
Wilhelm Carl Heinrich Friso 1734 Prinzessin Anna, die älteste
Tochter des britischen Königs und Kurfürsten Georg II. von
Braunschweig-Lüneburg (*1683, reg. 1727-1760). Damit knüpfte er
zwar an die Politik der Oranier an, hatte aber gegen
republikanische Strömungen in den Niederlanden so stark
anzukämpfen, dass er zeitweilig eine Rückkehr in die Stammlande
(Nassau-Diez) in Betracht zog. 1736 schloss er mit
Nassau-Saarbrücken und Nassau-Dillenburg einen ausschließlich
die männliche Sukzession vorsehenden Erbvertrag, gegen den er
schon bald Bedenken äußerte, da ihm eine Tochter geboren wurde.
Um seine Erbfolge zu sichern, ersuchte er beim Kaiser die
Anerkennung der weiblichen Erbfolge und die Umwandlung seiner
Stammlande in Reichslehen, was einer Trennung seines Hauses von
den übrigen nassauischen Linien bedeutete. Die Verwandten
Wilhelms IV. von Nassau-Oranien durchschauten dessen Pläne und
es kam zu einem Prozess mit Nassau-Saarbrücken vor dem
Reichshofrat. Während Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt
vertraglich regelten, wie die Inbesitznahme des Fürstentums
Nassau-Diez im Fall des Ausbleibens eines männlichen Erbes
auszusehen hätte, wurde 1748 der Sohn Wilhelm geboren, der als
Wilhelm V. Batavus (*1748, 1751-1806) die Erbfolge in
Nassau-Oranien antrat. Als Wilhelm IV. von Nassau-Oranien 1751
verstarb, war dessen einziger Sohn knapp vier Jahre alt. Die
Regierung übernahm erst einmal vormundschaftlich seine Mutter
Anna (1709-1759). Nach deren Tod traten die Herzöge Karl und
Ludwig Ernst von Braunschweig-Lüneburg an ihre Stelle als
Vormünder für Wilhelm V.
Die Gebiete des Fürstentums
Nassau-Oranien waren während des Siebenjährigen Krieges
politisch unterschiedlich orientiert. Die republikanischen
Kräfte in den Niederlanden sympathisierten bei Ausbruch des
Krieges mit Österreich und Frankreich. Nassau-Dillenburg musste
als Mitglied des Niederrheinisch-Westfälischen Kreises Truppen
für die Reichsarmee gegen Preußen stellen. Und die
vormundschaftliche Regierung stand auf der Seite König
Friedrichs II. von Preußen. Nach dem Krieg hielt Nassau-Oranien
den Hohenzollern die Treue. Unterstrichen wurde dies mit der
Eheschließung des Fürsten Wilhelm V. von Nassau-Oranien mit
Prinzessin Friederike Wilhelmine, einer Nichte Friedrichs des
Großen, im Jahr 1767.
Seit etwa 1770 durchlebten die
ottonischen Stammlande Nassaus eine Reformphase in der
Verwaltung. Ursächlich dafür waren in erster Linie
kameralistische Bemühungen um die Vermehrung der Einkünfte und
Anhebung der allgemeinen Wohlfahrt. Träger der Reformen waren
vielfach erfahrene Beamte an der Spitze der Landesverwaltung in
Dillenburg, wie zum Beispiel Johann Eckhard Spanknabe, Anton
Ulrich von Erath oder Carl Heinrich von Rauschard. 1772 wurde
eine Medizinalordnung erlassen, 1774 eine
Brandversicherungsanstalt eingerichtet und 1775 die
Pfarrerwitwen- und Waisenkasse zur Beamtenwitwen- und
Waisenkasse erweitert. Auch der Landwirtschaftsreform widmete
die Regierung in Dillenburg größere Aufmerksamkeit. Um eine
moderne Landwirtschaft zu entwickeln, musste das in
Nassau-Dillenburg verbreitete Realteilungs- und Erbleihesystem
überwunden werden. Auf eine spezielle Denkschrift des
Regierungsrats Johann Friedrich Eberhard reagierte die Regierung
zu Dillenburg 1775 und erließ in der Folgezeit zahlreiche
Verordnungen zur Besserung, der Wiesen, des Ackerbaus und der
Viehhaltung. Durch das Konsolidationsgesetz von 1784 setzte auch
allmählich die Flurbereinigung ein. Zur Hebung der Sitte und
Moral erließ die Regierung 1777 eine neue, durchaus pietistisch
beeinflusste Kirchenordnung. Bedeutsam war auch die Berufung des
ehemaligen Reichskammergerichtsassessors Georg Ludwig Ernst von
Preuschen zu Liebenstein 1778 zum Geheimen Rat und
Regierungspräsidenten, der aufklärerische Gedanken und eine
größere Effektivität in die Verwaltung einbrachte. Preuschen
verfasste 1779 eine große Reformdenkschrift über die gesamte
Verwaltung Nassau-Oraniens. Zu seinen Kritikpunkten gehörten die
ungleiche Größe der Ämter, Mängel am Polizeiwesen, die
unzureichenden Schul- und Bildungsverhältnisse und die häufigen
Frondienste. Verbesserungen sollten außerdem in der
Landwirtschaft, im Gewerbe und im Straßenbau erfolgen. Ebenfalls
1779 erließ Fürst Wilhelm V. die Generalzunftartikel für die
nassauischen Territorien nach dem Vorbild Preußens und Badens.
Auch die Reformen im Justiz-, Medizinal- und Fürsorgewesen kamen
in den letzten beiden Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts voran.
Angestrebt wurde eine Vereinheitlichung der Rechtsordnung für
die ottonischen Stammteile. In der Reformphase der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts erließ die Dillenburger Regierung
1770 auch eine Hypothekenordnung, der 1775 eine
Kontraktenordnung folgte. So fortschrittlich das Reformwerk in
Gänze war, auf dem Gebiet der frühen Industrialisierung sollte
es an zu starker Reglementierung und an den einsetzenden
Kriegsereignissen in den 1790er Jahren scheitern.
Politisch schwierig gestaltete sich für Fürst Wilhelm V.
von Nassau-Oranien die Zeit des amerikanischen
Unabhängigkeitskriegs und dann der französischen Revolution.
1776 versuchte er gegen den Widerstand der republikanischen
Kräfte in den Niederlanden und der vom Amerikahandel
profitierenden Kaufleute, als Statthalter neutral zu bleiben, um
England nicht zu provozieren. Mit Hilfe Preußens gelang es ihm,
1787 tatsächlich den Widerstand der Republikaner bzw. Patrioten
in den Niederlanden zu brechen. Infolge der Französischen
Revolution verlor Fürst Wilhelm V. von Oranien-Nassau seinen
Einfluss in den Niederlanden. Nachdem 1793 die Französische
Republik den Niederlanden den Krieg erklärt hatte und die
Batavische Republik ausgerufen worden war, musste er 1795 mit
seiner Familie nach England fliehen. Außerdem lasteten auf den
nassauischen Stammlanden während der Koalitionskriege immer
wieder Truppendurchmärsche, Kontributionen und Einquartierungen.
Wilhelm V. kehrte erst 1801 nach Dillenburg zurück. Zwar konnte
er im europäischen Kräftespiel keine weitreichenden
territorialpolitischen Ziele durchsetzen, doch gelang es
immerhin seinem Gesandten, Regierungsrat Passavant-Passenberg,
Preußen für eine Parteinahme zugunsten Nassaus bei den
Verhandlungen um die Entschädigung für die Statthalterschaft der
Niederlande zu gewinnen. Diese sahen vor, ihm als Entschädigung
das Gebiet der ehemaligen Abteien Fulda und Corvey und weitere
Ländereien als nunmehr weltliches Fürstentum zu übertragen. Um
die Verhandlungen nicht scheitern zu lassen, hatte Preußen die
vorgesehenen Gebiete militärisch besetzen lassen. Wilhelm V.
akzeptierte das Verhandlungsergebnis, das ihn als Fürst von
Fulda, Fürst von Corvey, Graf von Dortmund und Herr von
Weingarten einsetzte, zu Beginn des Jahres 1802. Er erhielt
damit eine amorphe bzw. eine nicht zusammenhängende
Entschädigungslandmasse, zu der konkret die Territorien des
Hochstifts Fulda, Höxter mit der Abtei Corvey, Dortmund,
Dietkirchen, Weingarten in Oberschwaben, St. Gerold in
Vorarlberg, Hofen am Bodensee und die Propstei Bandern am
Oberrhein gehörten. Wilhelm V. führte seitdem den Titel eines
Fürsten von Nassau-Oranien-Fulda. Die genannten
Entschädigungsgebiete trat er am 29. August 1802 an seinen Sohn
Wilhelm Friedrich (*1772, reg. 1806-1843) ab, der bis 1806 dann
den Titel eines Fürsten von Nassau-Oranien-Fulda führte und
vorübergehend für die Seite Napoleons Partei ergriff.
Das Siegerland in der Landesverwaltung und
Behördenorganisation im Großherzogtum Berg 1806 bis 1813
Nach dem Tod Wilhelm V. am 9. April 1806 übernahm Wilhelm
Friedrich die Regierung eines Vaters und amtierte als Prinz
Wilhelm VI. von Oranien-Nassau. Mit Beginn des Koalitionskriegs
1806 wurde ihm das Kommando über eine preußische Division
aufgetragen. Nach der Schlacht bei Jena am 15. Oktober
kapitulierte er anschließend mit 10.000 Mann in Erfurt. Wegen
seines Engagements für Preußen erklärte ihn Napoléon Bonaparte
(*1769, 1821) seiner Länder für verlustig, so dass ihm nur
seine Privatbesitzungen in Posen und Schlesien blieben. 1809
trat er als Freiwilliger in das Heer des Erzherzogs Karl von
Österreich-Teschen (*1771, 1847), in dem er an der Schlacht bei
Wagram am 5./6. Juli 1809 teilnahm. Anschließend sah sich
Wilhelm VI. gezwungen, nach England auszuweichen. Die Gunst der
Stunde während des Befreiungskriegs ausnutzend setzte er, als
sich im November 1813 beim Eindringen der Preußen in Holland das
Volk gegen die französische Herrschaft erhob, am 30. November
1813 mit Hilfe der britischen Marine in Scheveningen über, um
seine Ansprüche in den Niederlanden geltend zu machen. Der
Wiener Kongress beschloss besonders wegen des diplomatischen
Geschicks seines Vertreters Hans Christoph Ernst von Gagern
(*1766, 1852) die Vereinigung Belgiens und Lüttichs mit den
Vereinigten Niederlanden zu einem Königreich. Wilhelm VI. von
Nassau-Oranien wurde am 30. März 1814 unter dem Namen Willem I.
in der Nieuwe Kerk in Amsterdam als Souveräner Fürst der
Niederlande inthronisiert. Seine Erblande in Deutschland, zu
denen auch das ehemalige Fürstentum Siegen gehörte, musste
Willem für Luxemburg, das am 22. Juli 1815 dem Deutschen Bund
einverleibt wurde und das er im Mai zum Großherzogtum erhoben
hatte, an Nassau und Preußen abtreten.
Infolge des
durch Machtspruch Napoleons verfügten Verlusts seiner Gebiete
war Fürst Wilhelm VI. von Nassau-Oranien-Fulda seit Ende 1806
nicht länger Landesherr über die ottonischen Stammlande und der
1802 erworbenen Entschädigungsländer. Das Fürstentum Siegen
wurde, wie Nassau-Dillenburg, dem wenige Monate zuvor
gegründeten Großherzogtum Berg zugeschlagen. Das Fürstentum
Siegen ordnete sich in die nach französischem Vorbild
geschaffene bergische Verwaltungsorganisation ein. Es bestand
hier im Arrondissement Siegen des Departements Sieg von 1806 bis
1813 fort. Dem Arrondissement Siegen stand als oberster Beamter
ein Unterpräfekt vor. Von Ende 1806 bis zum 7. April 1809 war
Friedrich Heinrich Graf von Borcke (*1776, 1825) Präfekt des
Siegdepartements, ihm folgte bis zur Aufhebung des
Großherzogtums Berg Johann Anton Schmitz (*1770, 1857).
Das Departement Sieg umfasste hauptsächlich diejenigen
Ländereien, die im Zuge der Bildung des Rheinbundes am 12. Juli
1806 zu dem aus den ”Herzogtümern Kleve und Berg“ unter
Napoleons Schwager Joachim Murat gebildeten Großherzogtum Berg
hinzukamen. Es handelte sich dabei hauptsächlich um die der
Mediatisierung zum Opfer gefallenen nassau-oranischen
Fürstentümer Siegen, Dillenburg, Hadamar und Beilstein, während
Nassau-Diez an das Herzogtum Nassau fielen.
Mit der
durch den kaiserlichen Kommissar Jacques Claude Beugnot
durchgeführten Einführung der Departementsstruktur im
Großherzogtum durch ein Dekret Napoleons vom 14. November 1808
umfasste das Departement Sieg rund 133.000 Einwohner auf 39
Quadratmeilen. Verwaltungssitz (Chef-lieu) war nicht Siegen,
sondern der ehemalige nassauisch-oranischen Regierungssitz
Dillenburg. Das Departement Sieg umfasste die beiden
Arrondissements (Bezirke) Dillenburg und Siegen.
Das Arrondissement Dillenburg hatte 58.044
Einwohner und wurde in sieben Kantone gegliedert
(Einwohnerzahlen 1808):
1.Kanton Dillenburg (11.524
Einwohner) mit den Mairien: Dillenburg, Eibach, Haiger und
Ebersbach
2.Kanton Driedorf (7.621 Einwohner) mit den
Mairien: Driedorf, Mengerskirchen und Elsoff
3.Kanton
Hadamar (11.311 Einwohner) mit den Mairien: Hadamar, Offheim,
Zeuzheim, Lahr und Frickhofen
4.Kanton Herborn (8.039
Einwohner) mit den Mairien: Herborn, Hörbach, Bicken und
Eisemroth
5.Kanton Rennerod (10.959 Einwohner) mit
den Mairien: Rennerod, Marienberg, Höhn und Emmerichenhain
6.Kanton Runkel (3.867 Einwohner) mit den Mairien:
Schupbach und Schadeck
7.Kanton Westerburg (4.723
Einwohner) mit den Mairien: Westerburg und Gemünden (die
ehemalige Grafschaft Westerburg)
Am 17. Dezember 1811
wurde der Kanton Westerburg in den Kanton Rennerod und der
Kanton Runkel in den Kanton Hadamar eingegliedert.
Das Arrondissement Siegen hatte 75.026 Einwohner und wurde
in sieben Kantone gegliedert (Einwohnerzahlen 1808):
1.Kanton Eitorf (12.147 Einwohner) mit den Mairien: Eitorf,
Herchen, Ruppichteroth und Much
2.Kanton Gummersbach
(13.697 Einwohner) mit den Mairien: Gimborn, Gummersbach,
Marienheide, Neustadt, Ründeroth
3.Kanton Homburg
(9.163 Einwohner) mit den Mairien: Drabenderhöhe,
Marienberghausen, Nümbrecht, Wiehl
4.Kanton Netphen
(11.783 Einwohner) mit den Mairien: Ferndorf, Hilchenbach,
Irmgarteichen und Netphen
5.Kanton Siegen (11.194
Einwohner) mit den Mairien: Freudenberg, Siegen, Weidenau,
Wilnsdorf
6.Kanton Waldbröl (14.358 Einwohner) mit
den Mairien: Dattenfeld, Denklingen, Eckenhagen, Morsbach und
Waldbröl
7.Kanton Wildenburg (2.684 Einwohner) mit
der Mairie: Friesenhagen
Der Kanton Wildenburg wurde
1811 mit dem Kanton Siegen zusammengelegt.
Bedeutungsvoll war die nach französischem Vorbild
geschaffene Neuordnung im Großherzogtum Berg. Im Siegerland
wurden alle städtischen Privilegien der Städte Siegen,
Hilchenbach und Freudenberg sowie alle Zunftprivilegien
aufgehoben. Die Besoldung der Beamten, die bisher Angelegenheit
des Landesherrn gewesen war, oblag nunmehr den Ämtern und
Gemeinden. Im Gerichtswesen entsprachen die Friedensgerichte in
den Kantonalorten Siegen und Netphen den Kantonsgrenzen. Der
Appellationsgerichtshof für alle Kantone des Siegdepartements
hatte seinen Sitz in Dillenburg. In Letzter Instanz wurden
Gerichtsentscheidungen in der Hauptstadt des Großherzogtums
Berg, in Düsseldorf, getroffen.
Das
Siegerland unter erneuter nassau-oranischer Verwaltung bis zum
Übergang an Preußen 1814-1816
Im Zuge des
Befreiungskrieges wurden die Arrondissements Dillenburg und
Siegen von preußischen und russischen Truppen besetzt, wodurch
die staatliche Zugehörigkeit zum Großherzogtum Berg pro forma
erlosch. Das Siegerland kam gleich den anderen nassauischen
Territorien wieder in den Besitz des Prinzen Wilhelm VI. von
Oranien zurück. Von 1814 bis 1816 befand sich das Gebiet des
ehemaligen Fürstentums Siegen also noch einmal unter
nassau-oranischer Verwaltung, welche die französischen
Verwaltungsstrukturen schrittweise aufhob und die
administrativen Verhältnisse der vorbergischen Zeit wieder
aufleben ließ. Im Zuge des Wiener Kongresses fielen bereits am
29. Juli 1815 größere Teile des Siegerlandes an Preußen, das
besonderes Interesse an der Erwerbung des erz- und
industriereichen Landes gezeigt hatte. Zunächst wurde das
Siegerland der preußischen Rheinprovinz, Regierungsbezirk
Ehrenbreitstein, zugeschlagen. Nachdem der Prinz von Oranien
Luxemburg gegen seine nassauischen Stammgebiete eingetauscht
hatte, kam es zwischen dem Herzogtum Nassau, dem Erben aller
oranischen Besitzungen, und Preußen zu einem umfassenden
Gebietsaustausch. Nassau erhielt zur Abrundung seines Gebietes
zwischen Lahn und Sieg versprengt liegende preußische Gebiete,
Preußen bekam dafür das wirtschaftlich begehrte Siegerland.
Ausgenommen waren 25 Gemeinden, die in den Ämtern Burbach und
Wilnsdorf sowie in den Kirchspielen Irmgarteichen und Netphen
lagen. Diese Abtrennung löste Widerstände im Siegerland aus,
weil historisch gewachsene Strukturen zu zerreißen drohten. Der
Unmut endete, nachdem weitere Tauschverhandlungen zwischen
Nassau, Preußen und Hessen-Kassel dazu führten, dass am 14.
Dezember 1816 diese 25 Gemeinden zum Siegerland zurückkamen. Die
Gebietsteile des ehemaligen Fürstentums Nassau-Siegen, des
Freien Grundes und des Hickengrunds gingen in dem neu
geschaffenen preußischen Kreis Siegen auf. Für kurze Zeit
gehörte der Kreis Siegen dem Regierungsbezirk Koblenz der
Rheinprovinz an. Doch bereits 1817 wurde er dem Regierungsbezirk
Arnsberg der Provinz Westfalen angegliedert.
Bestandsgeschichte
Tektonik und Umfang der
Bestände des Fürstentums Nassau-Siegen
Die Bestände des Fürstentums Siegen setzen sich aus zwei
Schichten zusammen. Die erste Schicht ist die Überlieferung der
Verwaltungsbehörden unter der Bestandsbezeichnung ”Fürstentum
Siegen, Landesarchiv“. Sie ist unterteilt in einen Urkunden- und
in einen Aktenbestand: der Bestand ”Fürstentum Siegen,
Landesarchiv - Urkunden“ umfasst 726 mittelalterliche und
frühneuzeitliche Urkunden, der Bestand ”Fürstentum Siegen,
Landesarchiv - Akten“ enthält größtenteils Akten (2647
Verzeichnungseinheiten) aus der Zeit der selbständigen
Verwaltung des Fürstentums Siegen ab 1606, dagegen
vergleichsweise nur wenige aus der nassau-dillenburgischen Zeit
des Amts Siegen vor 1606 und für die Zeit der vereinigten
nassau-oranischen Länder nach 1743.
Die zweite
Schicht betrifft die Zeit der Verwaltung des Teilfürstentums
Siegen unter Nassau-Oranien von 1743 bis 1816 (mit Unterbrechung
1806-1813). Diese Überlieferung setzt sich aus einem
Urkundenbestand und zwei Aktenbeständen zusammen: ”Fürstentum
Siegen, Oranien-Nassauische Behörden - Urkunden“ mit 84
Verzeichnungseinheiten, ”Fürstentum Siegen, Oranien-Nassauische
Behörden, Zentralbehörden in Dillenburg“ mit 587
Verzeichnungseinheiten und ”Fürstentum Siegen,
Oranien-Nassauische Behörden, Siegener Behörden“ mit 768
Verzeichnungseinheiten. Während die genannten Urkundenbestände
chronologisch gegliedert wurden, können die Sachgruppen bei den
Aktenbeständen sowohl chronologisch als auch alphabetisch
geordnet sein.
Die Entstehung
der heutigen Urkunden- und Aktenbestände des Fürstentums
Siegen
Die Urkunden und Akten des
ehemaligen Fürstentums Nassau-Siegen, wie sie heute im
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen verwahrt werden, entstanden in
den verschiedenen Verwaltungsorganisationen vor, während und
nach der Eigenstaatlichkeit Nassau-Siegens. Sie wurden in den
gräflichen bzw. später fürstlichen Kanzleien der Regierungen zu
Dillenburg und Siegen, aber auch in den nachgeordneten
Verwaltungszweigen der oberen, mittleren und unteren
Behördenorganisation gebildet. Die Entstehung des
Teilfürstentums Siegen 1606 hatte zur Folge, dass die dortige
gräfliche Kanzlei und Regierung rechtsrelevante und geschäftlich
wichtige Unterlagen aus Dillenburg abzog, um diese in die eigene
Registratur einzubinden und gegebenenfalls fortzuführen. Die
Spaltung Nassau-Siegens in drei Stammteile und die
konfessionelle Aufspaltung nach 1623 wirkte sich kontraproduktiv
auf das Weiterbestehen einer Gesamtregistratur aus. Gewisse
Zuständigkeiten wurden gemeinschaftlich geklärt, andere hingegen
blieben Angelegenheiten der Teilfürstentümer und fanden ihren
schriftlichen Niederschlag in den dortigen Registraturen. Erst
nach dem Aussterben der ottonischen Linien in Hilchenbach
(1642), Hadamar (1711), Siegen (reformierter Teil, 1734) und
Dillenburg (1739) fiel das letzte verbleibende Teilfürstentum
Nassau-Siegen mit dem Tod des katholischen Fürsten Wilhelm
Hyacinth 1743 an die Linie Nassau-Diez, welche alle
nassau-ottonischen Besitzungen nunmehr vereinigte. Den üblichen
Gepflogenheiten der Verwaltungen folgend wurden die Akten und
Urkunden aller Landesteile immer an den Regierungs- und
Verwaltungshauptsitz des Rechtsnachfolgers gebracht. Die in
Siegen bei den obersten Verwaltungen vorhandenen Unterlagen
schaffte man zeitnah nach Dillenburg, dem Sitz der
nassau-oranischen Regierung. Hier wurden sie zunächst im Schloss
zusammen mit anderen nassauischen Registraturen verwahrt.
Während des Siebenjährigen Krieges brachte man die nassauischen
alten und nassau-oranischen neuen Registraturen in der Oberen
Orangerie zu Dillenburg, danach im Schloss Beilstein und
schließlich wieder in der Oberen Orangerie unter. Um die vielen
alten Registraturen aus Dillenburg, Hadamar, Siegen und Diez
besser zu handhaben, wurde 1765/66 in Dillenburg ein eigenes
Archivgebäude errichtet, das nassau-oranische Archiv zu
Dillenburg. Verdienste in diesem Zentralarchiv erwarb sich der
Jurist Anton Ulrich von Erath (*1709, 1773). Er trennte
Urkunden und Akten, ordnete und verzeichnete das Archiv nach
alphabetisch gegliederten Stichworten, wobei er rudimentär die
Zusammenhänge der alten Teilarchive berücksichtigte.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts nahm die territoriale
Entwicklung der Teilfürstentümer Nassau-Oraniens eine ungeahnte
Wendung, die sich äußerst negativ auf das Dillenburger Archiv
auswirken sollte und im Grunde genommen eine Odyssee seiner
Bestände einleitete. Die Fürstentümer Nassau-Dillenburg und
Nassau-Siegen gingen 1806 in der Verwaltungsorganisation des
Großherzogtums Berg auf, dessen Hauptstadt Düsseldorf war. Beide
ehemaligen Fürstentümer gehörten nunmehr zum so genannten
Sieg-Departement mit Sitz des Präfekten in Dillenburg. Das
genannte Departement gliederte sich wiederum in die
Arrondissements Dillenburg und Siegen. Beiden Arrondissements
stand ein Unterpräfekt vor.
Die Angliederung
Nassau-Dillenburgs und Nassau-Siegens an das Großherzogtum Berg
hatte für das Dillenburger Archiv fatale Auswirkungen. Was
eigentlich historisch zusammengehörte und nach 1743 vereinigt
worden war, wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts besonders durch
Umbrüche in Verwaltung und Staatlichkeit getrennt. Zahlreiche
Hausakten des entthronten Prinzen von Nassau-Oranien wurden
ausgeliefert und nach Oranienstein gebracht. Große Teile der
laufenden Registratur der ehemaligen Regierung zu Dillenburg
nahm die bergische Regierung für sich in Anspruch. Nicht
ausgeschlossen ist, dass Teile des Dillenburger Archivs nach
1806 auch an andere Verwaltungen von Staaten gingen, die nunmehr
für die Gebiete ehemaliger nassau-ottonischen Fürstentümer
zuständig geworden waren. Das Archivgebäude in Dillenburg wurde
nach 1806 von der bergischen Regierung beschlagnahmt und in ein
Justizgebäude umfunktioniert. Das Archiv wurde ausgelagert und
im Marstall sowie im Reithaus mehr schlecht als recht
untergebracht. Durch die Abgabe besonders wichtiger
Familiensachen an das fürstlich-oranische Haus und durch die
hervorgerufene Unordnung infolge ihrer Auslagerung hatte das
Dillenburger Archiv erstmals Einbußen erlitten.
Nach
dem Ende des Großherzogtums Berg Ende 1813 gelangte das
Siegerland zurück an den früheren Landesherrn, Fürst Wilhelm VI.
von Oranien, der als Ergebnis der Verhandlungen des Wiener
Kongresses große Teile das ehemaligen Fürstentums 1815 im Tausch
an Preußen abtrat. Preußen erwarb 1815 und 1816 darüber hinaus
den Freien Grund Selbach und Burbach und die vier im Hickengrund
gelegenen nassauischen Dörfer Holzhausen, Niederdresselndorf,
Oberdresselndorf und Lützeln. Aus dem ehemaligen Fürstentum und
den erworbenen Ländereien wurde 1816 der Kreis Siegen gebildet,
der bis Anfang 1817 dem Regierungsbezirk Koblenz der Provinz
Großherzogtum Niederrhein (1815-1822) angehörte, dann aber auf
Betreiben des ersten Oberpräsidenten von Westfalen, Ludwig
Freiherr Vincke (*1884, 1844), und mit Zustimmung des Kölner
Oberpräsidenten Friedrich Ludwig Christian von Solms-Laubach
(*1769, 1822) 1817 dem Regierungsbezirk Arnsberg und damit der
Provinz Westfalen zugeschlagen wurde.
Der Anfall der
nassau-oranischen Gebiete an das übrige Herzogtum Nassau 1815/16
hatte zur Folge, dass aus dem einstigen nassau-oranischen
Landesarchiv zu Dillenburg ein Filialarchiv wurde. Infolge der
Erhebung des Archivs zu Idstein zum Zentralstaatsarchiv des
Herzogtums Nassau wurden nämlich aus Dillenburg wichtige
Archivalien zur nassauischen Gesamtgeschichte abgegeben. Auch
das neu entstandene Königliche Haus der Niederlande erhob
weitere Ansprüche auf große Teile der oranischen Hausakten und
bekam diese nach Den Haag überwiesen. Auch die Einbindung des
Siegerlandes in die Provinz Westfalen hatte zur Folge, dass die
das Fürstentum Nassau-Siegen betreffenden Archivalien dauerhaft
von den Archivalien der übrigen ottonischen Linien getrennt
wurden. Auch hier hatte das Filialarchiv zu Dillenburg weitere
Abgaben zu leisten.
Das Dillenburger Filialarchiv
wurde Mitte des 19. Jahrhunderts durch weitere Abgaben an das
Nassauische Zentralarchiv in Idstein so empfindlich beschnitten,
dass es fast völlig an Bedeutung verlor und schließlich nur noch
nebenamtlich betreut wurde. Nach der Annexion Nassaus durch
Preußen im Jahr 1866 folgte das baldige Ende des Dillenburger
Filialarchivs. Bereits 1868 gingen dessen letzte Bestände nach
Idstein, dessen Archiv wiederum 1881 nach Wiesbaden verlagert
wurde. Heute befindet sich der größere Teil des alten
Dillenburger Archivs im Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden,
ein etwas geringerer Teil im Königlichen Hausarchiv in Den Haag.
Die Siegener, nunmehr im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen
Abteilung Westfalen befindlichen Bestände bilden hingegen den
kleinsten Teil der nassau-ottonischen Überlieferung.
Der Weg der Siegener Archivalien von Dillenburg
nach Münster
Die das Fürstentum Siegen
betreffenden Archivalien sollten - so der Plan Preußens - erst
einmal von Dillenburg in ein Archivdepot nach Arnsberg geschafft
werden, also an den zuständigen Verwaltungssitz einer Regierung
des Rechtsnachfolgers. Die Verhandlungen wegen der Übergabe der
Siegener Archivalien begannen bereits 1817 und zogen sich über
viele Jahrzehnte hin. In der damaligen Korrespondenz unterschied
man in der Regel zwischen Urkunden und Akten. 1829 lassen sich
die ersten Siegener Urkunden bei der Regierung in Arnsberg
nachweisen, wohin sie wegen des ”Domanial-Interesses“ gebracht
worden waren. 1832 kamen sie schließlich zusammen mit einer sie
grob erschließenden Abgabeliste in das wenige Jahre zuvor
gegründete Provinzialarchiv in Münster an. Bei einer dortigen
Bestandsrevision wurde festgestellt, dass manche in der
Abgabeliste aufgeführte Stücke fehlten. Einige von ihnen
befanden sich noch bei der Regierung in Arnsberg.
Während die Übernahme der Siegener Urkunden durch das
Provinzialarchiv voranschritt, kam es zu Verzögerungen bei den
Akten. Wie sich herausstellte, lagen diese 1832 in Siegen im
Landratsamt, verpackt in Kisten auf einem offenen Flur vor den
Geschäftsräumen des Landrats Wolfgang Friedrich von Schenck
(*1768, 1848). Allerdings gab es für sie bereits ein
Repertorium bzw. eine Abgabeliste. Oberpräsident Vincke sowie
die Archivare Ferdinand Kersten (*1770, 1851) und Heinrich
August Erhard (*1793, 1851) plädierten jedoch vor dem Transport
der Akten von Siegen nach Münster für eine Aussonderung. Dabei
sollte Schriftgut separiert werden, das die Verwaltung noch
benötigte und Eingang in die Registraturen der Regierung zu
Arnsberg und andere Stellen finden sollte. Dies betraf
insbesondere Bausachen von Kirchen und Kapellen sowie
Schulsachen. Außerdem gab es nicht archivwürdiges Schriftgut,
welches kassiert, und archivwürdiges Schriftgut, das nach
Münster in das Provinzialarchiv verbracht werden sollte. Die
Aufgabe der Aussonderung in Siegen übertrug man dem ehemaligen
Domänenrentmeister Diez, der in Netphen wohnte. Dieser sollte
Bewertungsvorschläge unterbreiten, die anschließend vom
Provinzialarchiv in Münster zu genehmigen waren. Um die Aufgabe
zu bewältigen, wurden die in Siegen lagernden Akten nach Netphen
gebracht, wo Diez die entsprechenden Aussonderungsvorschläge
erarbeitete und nach und nach über die Regierung Arnsberg an den
auch an solchen Details sehr interessierten Oberpräsidenten
Vincke und an das Provinzialarchiv in Münster schickte. Ein Teil
der Akten gelangte auf diesem Weg tatsächlich nach Münster, ein
anderer Teil ging als Vorakten in die Registraturen der
laufenden Verwaltung: in die Kirchen- und Schulregistratur und
die Domänen- und Forstregistratur der Regierung Arnsberg, aber
auch in das Rentamt Siegen, in das Bergamt Siegen, in die
Forstinspektion Siegen und in das Landratsamt Siegen. Teile
dieser Registraturen kamen Jahre später als Archivgut nach
Münster, wo sie dem Provenienzprinzip folgend erst einmal den
Beständen der genannten Behörden zugewiesen worden.
Die Geschichte der späten Spaltung:
Bestandsgeschichte in Münster
Das reine
Provenienzprinzip wurde bei der Bildung der Siegener Bestände im
19. Jahrhundert nicht konsequent angewandt. Selbst bei den
Nachträgen wurde es oft und zum Teil bewusst nicht
berücksichtigt. Im Grunde genommen setzen sich die Siegener
Bestände aus einer Vielzahl von Akten und Urkunden zusammen, die
in den verschiedensten Behördenorganisationen aus der Zeit vor,
während und nach der territorialen Selbstständigkeit entstanden.
Was 1834 tatsächlich in Münster ankam, waren Archivalien, die
sich durch die spezifische Geschichte des Fürstentums Siegen von
anderen Landesarchiven unterschieden. Sie bilden den Kern
dessen, was heute in Münster als ”Fürstentum Siegen,
Landesarchiv“ mit den beiden Teilbeständen an Urkunden und Akten
liegt, aber durch den Umzug nach Dillenburg und später nach
Münster nicht mehr gut nach Provenienzen aus den einzelnen
Behörden Rent- und Hofkammer, Justizkanzlei, Oberkonsistorium
und Landesregierung zu trennen war. In Münster fiel die
Entscheidung für die Bildung eines Mischbestands, in den auch
die Überlieferungen der einzelnen Ämter Siegen, Hilchenbach,
Krombach, Ferndorf, Freudenberg, Netphen und des
Vierdorfschaften eingingen.
Die in Dillenburg
zwischen 1743 und 1806 entstanden Urkunden und Akten wurden im
Staatsarchiv Münster erst in den 1960er Jahren auf Veranlassung
des Archivars Dr. Helmut Richtering (1924-1993) aus den so
genannten Nachakten des Landesarchivs Siegen herausgelöst. Sie
sind zusammen mit den nassau-oranischen Vorakten der Regierung
Arnsberg sowie Akten aus dem Rentamt Siegen und dem Landratsamt
Siegen in den neuen Bestand ”Fürstentum Siegen,
Oranien-Nassauische Behörden“ mit seinen drei Teilbeständen
eingegangen. Insbesondere der Teilbestand ”Zentralbehörden in
Dillenburg“ muss in Zusammenhang mit seinem in Wiesbaden
liegenden Pendant (Abt. 172 Regierung Dillenburg) gesehen
werden. Die Archivalien wurden im ersten Drittel des 19.
Jahrhunderts in Dillenburg nach Belegenheitsprinzip, d.h. nach
dem Ort, den sie betrafen, auseinander sortiert und teils nach
Wiesbaden, teils nach Münster verbracht. Titelaufnahmen,
Provenienzbestimmung und erste Gliederung der Bestände
”Fürstentum Siegen, Oranien-Nassauische Behörden, Siegener
Behörden“ und ”Fürstentum Siegen, Oranien-Nassauische Behörden,
Zentralbehörden in Dillenburg“ wurden im Sommer 1965 von den
Referendaren Dr. Nordsiek, Dr. Sagebiel und Dr. Wolf unter
Anleitung des Archivars Dr. Richtering vorgenommen, der das
Ganze dann noch einmal überarbeitete und einen Anhang
hinzufügte. Details darüber befinden sich in den älteren
Repertorien.
Darüber hinaus wurden in Münster
ebenfalls in den 1960er Jahren noch die Akten des Freien Grunds
Sel- und Burbach (641 Akten, Laufzeit 1444-1846) aus dem
Siegener Landesarchiv und seinen Nachakten heraus in einen
eigenen Bestand ausgegliedert. Der Freie Grund war insofern
etwas Besonderes, als er seit dem Mittelalter bis zum Kauf durch
Preußen 1816 ein Kondominat zwischen Nassau und dem Hause Sayn
bildete. Erst 2009 wurden die Akten der Mittelrheinischen
Reichsritterschaft (84 Akten, Laufzeit 1325-1800) in Umsetzung
älterer Pläne des Hauses aus dem Bestand ”Fürstentum
Nassau-Siegen, Landesarchiv - Akten“ herausgelöst und als
eigener kleiner Bestand etabliert. Die Mitglieder der
mittelrheinischen Reichsritterschaft im Fürstentum Siegen
bildeten eine besondere Schicht von Adligen, die im Auftrag des
Kaisers Reichssteuern erhoben. Die Auseinandersetzung um die
Anerkennung ihrer Reichsunmittelbarkeit dominiert die Akten des
Bestands, der sich fast nur aus Prozessakten
zusammensetzt.
Auch die Überlieferung der beiden
geistlichen Institutionen des Fürstentums Siegen, des als
Prämonstratenserinnenkloster gegründeten späteren Damenstifts
Stift Keppel mit seinen Teilbeständen sowie ein kleiner Teil der
Urkunden des von 1626 bis 1771 bestehenden Jesuitenkollegs
Siegen wurde dem Bestand ”Fürstentum Siegen, Landesarchiv“
entnommen und eigens gebildeten Beständen zugeordnet.
In der sogenannten Übergangszeit gehörte Siegen von 1806
bis 1813 zum Großherzogtum Berg und innerhalb dieses Staates zum
Siegdepartement (ohne Burbach, aber mit Homburg und
Gimborn-Neustadt). Der Bestand ”Großherzogtum Berg“ ist erst
1951 im Staatsarchiv Münster aus späteren Abgaben der
Regierungen Münster und Arnsberg gebildet worden. Das Geheime
Ratskolleg Dillenburg wurde 1814 als Oberbehörde für die 1813
bis 1816 wieder von Oranien-Nassau übernommenen Landesteile aus
dem Siegdepartement errichtet. 1816 wurde es dem Königreich
Preußen bzw. dem Herzogtum Nassau angegliedert. Preußen hatte am
31. Mai 1815 vom König der Niederlande die nassau-oranischen
Stammlande sowie die 1813 an Oranien gekommenen Herrschaften
Westerburg und Schadeck sowie Wied-Runkel erhalten, am gleichen
Tag diese Territorien aber an das Herzogtum Nassau abgetreten.
Unberührt von diesem Tausch waren Teile des Fürstentums
Nassau-Siegen sowie die Ämter Burbach und Neunkirchen.
Erst 2010 wurde der Bestand ”Fürstentum Oranien-Nassau,
Geheimes Ratskolleg Dillenburg“ dem Bestand ”Fürstentum Siegen,
Oranien-Nassauische Behörden, Zentralbehörden in Dillenburg“
entnommen.
Überlieferung zum Siegerland
seit 1816
Der Kreis Siegen als unterste
staatliche Verwaltungsinstanz nahm seit seiner Einbindung in die
Provinz Westfalen einen festen Platz in deren
Verwaltungsstrukturen ein. Ihm vorgesetzt waren staatliche
Verwaltungs- und spezielle Fachbehörden. Betreffe des
Siegerlandes besonders nach 1816 befinden sich in folgenden
Archivbeständen:
Oberpräsidium
Münster
Regierung Arnsberg
Kreis
Siegen
Katasterbücher im Regierungsbezirk Arnsberg
und Katasterkarten
Polizeipräsidium Hagen
Kreispolizeibehörde Siegen
Bau-Inspektion,
Staatshochbauamt Siegen sowie Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW,
Niederlassung Siegen
Oberfinanzdirektion
Münster
Finanzamt Siegen
Kreisamt für
gesperrte Vermögen Siegen
Landwirtschaftliche
Kreisstelle Siegen-Wittgenstein
Wiesenbaumeister
Siegen
Forstamt Siegen-Netphen mit Vorgängern
Domänenrentamt Siegen
Oberbergamt Bonn
Altes Bergamt Siegen
Bergamt Siegen
Arbeitsamt Siegen
Staatliches Umweltamt
Siegen
Gewerbeaufsichtsamt Siegen
Telegrafenbauamt Siegen
Provinzialschulkollegium
Staatliches
neusprachliches Mädchengymnasium Siegen
Oberlandesgericht Hamm
Landgericht Siegen
Landgerichte, Rückerstattungen
Generalstaatsanwaltschaft Hamm
Staatsanwaltschaft Siegen
Amtsgericht Siegen mit
den Vorgängern Kreisgericht sowie Land- und Stadtgericht
Siegen
Arbeitsgericht Siegen
Justizvollzugsanstalt Siegen
Personalakten.
Auch einige das
Siegerland betreffende Nachlässe und ein Hofarchiv liegen in
Münster:
Nachlass Johann Heinrich
Reifenrath und Friedrich Reifenrath
Hof
Heistern
Sammlung Hermann Jüngst.
Zahlreiches Material befindet sich ebenfalls in der
Kartensammlung A und in der Sammlung Katasterkarten K.
Die Altverzeichnung und die Neuverzeichnung der
Bestände ”Fürstentum Siegen, Landesarchiv- Akten“ und
”Fürstentum Siegen, Oranien-Nassauische Behörden“
Wie bereits erwähnt, hatte bereits Anton Ulrich
von Erath die Grundlage der Verzeichnung des nassau-oranischen
Landesarchivs gelegt, indem er die Urkunden und getrennt davon
die Akten bis 1743 verzeichnet hatte. Die Akten, die er selbst
zum Teil formiert hatte, waren von ihm innerhalb der Bände
chronologisch geordnet und auf seine Weisung hin teilweise
gebunden worden. Die Folge seiner Arbeiten war, dass er manche
Zusammenhänge zerriss. Welche Schwierigkeiten aus seiner
Arbeitsweise und Systematik erwuchsen, hat Rouven Pons
anschaulich beschrieben sowie den Umgang mit diesem Erbe durch
seinen Nachfolger Karl Otto Heinrich von Rauschard (1750-1796)
thematisiert.
Hatte man nach der Abgabe der
Archivalien an Preußen 1832 in Eraths Findmitteln jeweils
notiert ”an Preußen abgegeben“, waren die Urkunden zusammen mit
einem Abgabeverzeichnis nach Münster geschickt worden. Sie
wurden dort mit ihren Nummern, die Erath vergeben hatte und die
durch das Zerreißen zu Springnummern geworden waren, als
Regesten verzeichnet. Diese Verzeichnung war die Grundlage einer
Neuverzeichnung mit durchgehender Neunummerierung durch den
Archivar Heinrich August Erhard im Jahre 1835. Dessen
Verzeichnung der Urkunden bis 1500 wurde wiederum überholt durch
das von Friedrich Philippi erstellte Siegener Urkundenbuch von
1877 bzw. 1927. Die Regesten der jüngeren Urkunden verharren
indessen noch auf dem Stand der älteren hundertachtzig Jahre
alten Verzeichnung. Die Urkunden des Stifts Keppel liegen in
einer Verzeichnung aus dem 19. Jahrhundert vor, die 1877 und
1927 für die Zeit bis 1500 durch das Siegener Urkundenbuch
verbessert und für die Urkunden ab 1502 eine Neuverzeichnung
durch den Staatsarchivassessor Dr. Franz Böhm und den Siegener
Dr. Fischer im Jahr 1939 erfuhr.
Den Akten erging es
in Münster lange Zeit nicht besser: Die von Erath bis 1743
erfassten und die neueren Akten bis 1806 wurden, wie erwähnt, in
Münster im Bestand ”Fürstentum Siegen, Landesarchiv - Akten“
zunächst zusammengefasst. Zu diesen gibt es die zitierten
Abgabeverzeichnisse des Rentmeisters Diez aus Netphen, der
zwischen Akten unterschied, die nach Münster ins Archiv kamen,
und solchen, die an verschiedene, genau von ihm bezeichnete
preußische Behörden geschickt wurden. In Münster wurde auf
dieser Grundlage um 1890 ein handschriftliches Findbuch
erstellt, das bis zur Retrokonversion 2008 in dieser Form in
Gebrauch war und im Laufe der Zeit viele Nachträge und
Berichtigungen erfuhr, außerdem durch die Abspaltung diverser
Aktenbestände ab 1743 und der Akten des Stifts Keppel in Teilen
obsolet wurde. Immerhin konnte das retrokonvertierte und somit
für das digitale Zeitalter vorbereitete Findbuch 2010 bereits
über das Internet zugänglich gemacht werden, obwohl eine moderne
Erschließung ein dringendes Desiderat blieb. Als die Bestände
Fürstentum Siegen, Oranien-Nassauische Behörden mit den drei
Teilbeständen Urkunden, Zentralbehörden in Dillenburg und
Siegener Behörden in den 1960er Jahren aus dem Landesarchiv
herausgelöst wurden, erfuhren auch sie jeweils eine
Neuverzeichnung. In Münster wurden die Archivalien also
geordnet, es wurde Bestandsbildung betrieben und ein
Urkundenbuch herausgegeben. Verzeichnet wurden die neu
gebildeten Bestände, nicht aber der ”Urbestand“, der trotz aller
Abspaltungen der größte blieb, Fürstentum Siegen, Landesarchiv -
Akten, der auf dem Stand von ca. 1890 über gut 120 Jahre benutzt
wurde. Das Findbuch A 413 "Fürstentum Siegen,
Oranien-Nassauische Behörden, Siegener Behörden" wurde im Herbst
2010 von Markus Gerhards-Padilla unter der Betreuung von Thomas
Reich mit dem Verzeichnungsprogramm VERA abgeschrieben. Bis
dahin waren die Akten Bestandteil des maschinenschriftlichen
Findbuchs A 412 Bd. 1 (S. 102-179). Die Signaturenkonkordanz aus
A 412 Bd. 2 wurde von Matthias Beckenuyte in das Findbuch
übernommen. Thomas Reich hatte diesen Bestand teilweise neu
geordnet und wenige Akten nachverzeichnet.
Eine
Neuverzeichnung der Siegener Aktenbestände erfolgte schließlich
in den Jahren 2014-2017 durch den Archivar Jens Heckl. Sie
betraf die Bestände ”Fürstentum Siegen, Landesarchiv - Akten“,
Fürstentum-Siegen, Oranien-Nassauische Behörden, Zentralbehörden
Dillenburg“, ”Fürstentum Siegen, Siegener Behörden“ und
”Mittelrheinische Reichsritterschaft“. Da aufgrund der
vorliegenden neu zu verzeichnenden Aktenmengen eine
Einzelblattverzeichnung binnen kurzer Zeit nicht realisierbar
ist, wurde ein für künftige Forschungen akzeptabler Mittelweg
gewählt, der sich von der Altverzeichnung gravierend
unterscheidet und besonders das digitale Zeitalter
berücksichtigen soll. Unter weitgehender Beibehaltung der
bestehenden inhaltlichen Gliederung/Klassifikation der
Aktenbestände wurden alle Aktentitel modernisiert und dem
tatsächlichen Inhalt der Akten angepasst. Außerdem wurden
Laufzeiten korrigiert und ergänzt sowie durchaus umfangreiche
Enthält-Vermerke erstellt. Bei diesen Enthält-Vermerken wurde
darauf Wert gelegt, möglichst wichtige Vorgänge inhaltlich zu
erfassen, aber auch besondere Einzeldokumente hervorzuheben. Im
Hinblick auf verwaltungs-, herrscher-, diplomatie-, orts- und
familiengeschichtliche Fragestellungen wurden neben den
sachthematisch bezogenen Enthält-Vermerken separiert auch die
Namen der wichtigsten Korrespondenten zu den jeweiligen Akten
erfasst, meist in Zusammenhang mit ihrer Funktion/Profession und
dem Ort, von dem ihre Korrespondenz ausging. Der Bestand
”Fürstentum Siegen, Landesarchiv - Akten“ wurde darüber hinaus
mit neuen Signaturen versehen. Anstelle der alten,
mehrgliederigen Signaturen trat eine fortlaufende Signierung.
Eine entsprechende Konkordanz zwischen alten und neuen
Signaturen wurde verfasst.
Durch die beim Hessischen
Hauptstaatsarchiv Wiesbaden angesiedelte und seit dem 4.
November 2015 freigeschaltete Archivdatenbank Nassau-Oranien, in
der auch die nassauischen Bestände des Landesarchivs
Nordrhein-Westfalen eingebunden sind, ist es nunmehr virtuell
möglich, einen Gesamtüberblick über die auf mehrere
Archivstandorte verteilte nassauische Überlieferung zu
bekommen.
Alte Findmittel,
Ergänzungsüberlieferungen und ausgewählte Literatur
Alte Repertorien zum Fürstentum Siegen:
··Alte Findbücher Nr. 332: Fürstentum Siegen, Landesarchiv,
1856. Enthält: Repertorium mit Ablieferungsverzeichnis.
·Alte Findbücher Nr. 333: Fürstentum Siegen, Landesarchiv,
um 1800. Enthält: Fragment (keine nähere Bestimmung
möglich).
·Alte Findbücher Nr. 334 (1833-1840)
·Alte Findbücher Nr. 812: Fürstentum Siegen, Landesarchiv,
1890. Enthält: Archivisches Findbuch mit zahlreichen Nachträgen.
Als Kopie bis 2009 gültiges Findbuch (A 411).
··
·
·Ergänzungsüberlieferung in der
Abteilung Westfalen des Landesarchivs NRW:
··Urkundenabschriften und Aktenauszüge 1224-1801,
Bergbausachen, Notizkalender des Fürsten Johann Moritz 1671 in
Msc. VII Nr. 6501 bis 6517 (Fürstentum Nassau-Siegen).
··
·
·Sonstige Archive:
··Staatsarchive Darmstadt und Wiesbaden: Sonstige
nassauische Grafschaften, Mittelrheinische
Reichsritterschaft.
·Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Wien: Insbesondere die Bestände Reichskammergericht und
Reichshofrat.
··
·
·Ausgewählte
Literatur:
··Achenbach, Heinrich von: Geschichte der
Stadt Siegen, 2 Bde., Siegen 1894.
·Bald, Ludwig: Das
Fürstentum Nassau-Siegen. Territorialgeschichte des Siegerlandes
(Schriften des Instituts für geschichtliche Landeskunde von
Hessen und Nassau 15), Marburg 1939.
·Becker, Emil:
Beiträge zur Geschichte des Archivs und der Kanzlei des
nassau-ottonischen Hauses zu Dillenburg, in: Siegerland 18
(1936), S. 63-72, 97-106138-147, Siegerland 19 (1937), S. 15-27,
54-61, 82-96.
·Behr, Hans-Joachim: ”Zu rettung deren
hart getruckten Nassaw-Siegischen Unterthanen“. Der
Niederrheinisch-Westfälische Kreis und Siegen im 18.
Jahrhundert, in: Jahrbuch für Westfälische Kirchengeschichte 85
(1991), S. 159-184.
·Black-Veldtrup, Mechthild: Ein
langer Weg. Nassau-Siegener Archivalien im Landesarchiv NRW
Abteilung Westfalen in Münster, in: Rouven Pons (Hg.): Nassau
und Oranien in der Frühen Neuzeit. Erweiterter Tagungsband des
Symposiums im Hessischen Hauptstaatsarchiv am 5. November 2015,
Wiesbaden 2017.
·Eiler, Klaus: Nassauische
Grafschaften, in: Winfried Speitkamp (Hg.), Handbuch der
hessischen Geschichte. Band 3. Ritter, Grafen und Fürsten -
weltliche Herrschaften im hessischen Raum ca. 900-1806
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 63),
Marburg 2014, S. 3-92.
·Geschichtswerkstatt Siegen.
Arbeitskreis für Regionalgeschichte e.V. (Hg.): Siegener
Beiträge. Jahrbuch für regionale Geschichte, Bände 1-21
(1996-2016).
·Güthling, Wilhelm: Geschichte der Stadt
Siegen im Abriß, Siegen 1955.
·Lademacher, Horst:
Oranien-Nassau, die Niederlande und das Reich. Beiträge zur
Geschichte einer Dynastie (= Niederlande-Studien 13), Münster
1995.
·Ludorff, Albert: Die Bau und Kunstdenkmäler
des Kreises Siegen (= Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen,
Band 12: Kreis Siegen), Münster 1903.
·Menk, Gerhard:
Die oranisch-nassauischen Archivalien in der frühen Neuzeit.
Überlieferung, Erschließung, Forschungsfragen, in: Een
vorstelijk Archivaris. Opstellen vor Bernard Woelderink, Zwolle
2003, 217-223.
·Petri, Franz: Das Siegerland und
Westfalen, in: ders. (Hrsg.), Zur Geschichte und Landeskunde der
Rheinlande, Westfalens und ihrer westeuropäischen Nachbarländer,
Bonn 1973.
·Pfau, Dieter, Zeitspuren in Siegerland
und Wittgenstein. Früh- und Hochmittelalter 750-1250, Bielefeld
2009.
·Philippi, Friedrich (Hg.): Siegener
Urkundenbuch (bis 1500), 2 Bde., Siegen 1887/1927.
·Pons, Rouven: Das zerrissene Archiv. Die wechselhafte
Geschichte des Alten Dillenburger Archivs (1743 - nach 1950),
in: Siegerland 91 (2014), S. 81-100, Siegerland 92 (2015), S.
31-48.
·Spielmann, Christian: Geschichte von Nassau,
3 Bde., Wiesbaden, Plaum und Montabaur 1909-1926.
·Werd, Guido de (Red.): Soweit der Erdkreis reicht. Johann
Moritz von Nassau-Siegen 1604-1679, Kleve 1980.
Zitierweise:
Landesarchiv
Nordrhein-Westfalen Abteilung Westfalen (kurz: LAV NRW W)
Fürstentum Siegen, Oranien-Nassauische Behörden, Zentralbehörden
in Dillenburg Nr.
- Reference number of holding
-
E 403
- Extent
-
587 Akten.
- Language of the material
-
German
- Context
-
Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen (Archivtektonik) >> 1. Territorien des Alten Reiches bis 1802/03 einschließlich Kirchen, Stifter, Klöster, Städte u.ä. >> 1.5. Weitere weltliche Territorien (E) >> 1.5.5. Fürstentum Siegen >> 1.5.5.1. Verwaltungsbehörden >> Fürstentum Siegen, Oranien-Nassauische Behörden
- Date of creation of holding
-
(1293)-1842
- Other object pages
- Delivered via
- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs
- Last update
-
05.11.2025, 1:59 PM CET
Data provider
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen. Abteilung Westfalen. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Bestand
Time of origin
- (1293)-1842