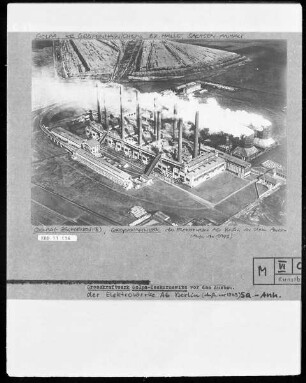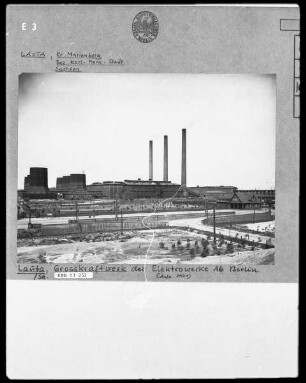Bestand
A Rep. 250-03-07 Elektrowerke AG (Bestand)
Vorwort: A Rep. 250-03-07 Elektrowerke AG
1. Unternehmensgeschichte
Die Elektrowerke AG haben ihren Ursprung in dem Vorhaben der AEG, die Stadt Berlin mit Fernstrom aus den mitteldeutschen Braunkohlerevieren zwischen Bitterfeld und Wittenberg zu versorgen. Zu diesem Zweck übernahm das Unternehmen 1913 die 1892 gegründete Braunkohlenwerk Golpa-Jessnitz AG, Halle / Saale. Die Anforderungen, die der Erste Weltkrieg an die deutsche Wirtschaft stellte, verhinderte jedoch, den Plan umzusetzen. Zwar wurde 1915 ein Großkraftwerk in Zschornewitz, Kreis Wittenberg, errichtet, das mit der Kohle der unweit entfernten Grube Golpa, Kreis Bitterfeld, betrieben wurde. Es versorgte jedoch die benachbart entstandenen Reichsstickstoffwerke Piesteritz, die künstliches Salpeter für die vom Export abgeschnittene Landwirtschaft produzierten, mit Strom.
Das einstige Tagebauunternehmen firmierte daraufhin seit 1915 als Elektrowerke AG und nahm seinen Sitz in Berlin. [1] Auf Grund wirtschaftlicher Schwierigkeiten ging die Gesellschaft zum 01. Oktober 1917 von der AEG zu 100% in das Eigentum des Reiches über. Unternehmerisch blieb die mitunter nun auch Reichselektrowerke genannte Firma selbstständig. Sie wurde 1923 lediglich in die soeben gegründete Vereinigte Industrie-Unternehmungen AG (VIAG) eingegliedert, die als Holding alle reichseigenen Beteiligungen zusammenfasste.
Energiewirtschaftlich verfolgten die Elektrowerke fortan das Ziel, weite Teile des Reiches mit Fernstrom zu versorgen sowie kleinere und größere Kraftwerke, die zumeist in öffentlicher Hand waren, unter ihrem Dach zu vereinen. Dieses Vorhaben war auch in anderen Gebieten des Reiches zu beobachten. Dass sich die wenigen Strom-Großproduzenten hierbei durchsetzen konnten, verdankten sie der kostengünstigen Stromerzeugung durch ihre Großkraftwerke. So entwickelte sich allmählich eine dreistufige Gliederung der deutschen Stromwirtschaft mit einem überregional dominierenden Großproduzenten, Regionalversorgern und Stadtwerken. Beherrschte die Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk AG (RWE), an der zahlreiche rheinische und westfälische Kommunen beteiligt waren, das westliche Deutschland, so war es im Hannoveraner Raum die dem Land Preußen gehörige Preußische Elektrizitäts-AG (PreussenElektra / Preag) und in Mittel- und Ostdeutschland die reichseigenen Elektrowerke AG.
Den Beginn der Expansion der Elektrowerke machte nach Kriegsende ein Vertrag zur Fernstromversorgung mit der Berliner Städtischen Elektrizitätswerke AG (Bewag). Dadurch wurde die Stadt seit 1918 mit Strom beliefert, der bis dahin dem kriegswichtigen Aluminiumwerk Rummelsburg zugeleitet worden war. Die Versorgung des Piesteritzer Stickstoffwerks blieb bestehen. Weitere Unternehmen, wie die ebenfalls reichseigenen Vereinigten Aluminium-Werke (VAW), die IG Farben und die Metallgesellschaft AG mit ihren Bitterfelder Betriebsteilen sowie die Lonza-Werke Elektrochemische Fabriken GmbH, traten als Stromabnehmer hinzu. Darüber hinaus wurden Lieferungsverträge u. a. mit der Stadt Leipzig, dem Elektrizitätswerk Sachsen-Anhalt AG (Esag), Halle / Saale, der Elektrizitätswerk AG, Brandenburg, der Niederschlesische Elektrizitäts-AG, Hirschberg, und der Elektrizitätswerk Schlesien AG, Breslau, geschlossen. Ein weiterer Großabnehmer war die Reichsbahn, mit der die Elektrowerke auch bei der Errichtung von Starkstromleitungen und dem Anschluss von werkseigenen Privatbahnen an das öffentliche Verkehrsnetz kooperierten.
Mit der erhöhten Nachfrage ging der Ausbau der betriebseigenen Großkraftwerke einher. So wurde das ohnehin weltgrößte Dampfkraftwerk Zschornewitz 1918/19 für größere Leistungen ausgerüstet. Ferner wurde mit der Übernahme der Kohlenkraftwerke Lauta bei Senftenberg und Trattendorf bei Spremberg ein zweites Standbein in der Niederlausitz geschaffen. Beide Anlagen waren 1921 nach der Fusion mit der Mitteldeutsche Kraftwerke AG und der Niederlausitzer Kraftwerke AG zusammen mit der sie beliefernden Braunkohlengrube Brigitta an die Elektrowerke gelangt. [2] Nach ihrem Ausbau Mitte der zwanziger Jahre gelang es den Elektrowerken, von dort aus den schlesischen Strommarkt zu erschließen. Energie produzierten darüber hinaus auch die Kraftwerke Elbe bei Vockerode / Dessau, Glogau, Lohs und Magdeburg, mit denen die Elektrowerke anscheinend über Beteiligungen verbunden waren. [3] Insgesamt konnte die eigene Stromerzeugung von 1,41 Mrd. kWh (1924) über 2,23 Mrd. kWh (1930) auf 6,8 Mrd. kWh (1934) gesteigert werden. [4]
Parallel zum Ausbau der Kraftwerke erfolgte die Verdichtung des Fernversorgungsnetzes. Neben weiteren Leitungen ins mitteldeutsche Industrierevier und zwischen den Kraftwerken Zschornewitz - Lauta und Lauta - Trattendorf war vor allem eine zusätzliche Verbindung Berlins mit dem Kraftwerk Trattendorf bedeutsam. In Berlin-Friedrichsfelde trafen die beiden Hauptversorgungsstränge der Elektrowerke AG - einerseits aus Zschornewitz, andererseits aus Lauta / Trattendorf - zusammen.
Die unternehmerische Expansion wurde ergänzt durch die Beteiligung an regionalen wie lokalen Stromversorgern, die nicht selten Abnehmer der Elektrowerke waren. Hierunter befanden sich bis 1945 die Braunkohle-Benzin AG (Brabag), Magdeburg, die Electricitäts-Werke Liegnitz AG, Liegnitz (Beteiligung seit 1925), die Elektrizitätswerk Sachsen-Anhalt AG (Esag), Halle / Saale (1922), die Energieversorgung Oberschlesien AG (1944), die Gewerkschaft Lohser Werke, Kunzendorf / Niederlausitz (1925), die Greppiner Werke AG, Greppin / Bitterfeld (1929), die Kommunale Elektrizitäts-Lieferungs-Gesellschaft, Sagan (1925), die Landkraftwerke Leipzig AG, Leipzig, die Mitteldeutsches Kraftwerk Magdeburg AG (Mikramag), Magdeburg (1938), die Niederschlesische Elektrizitäts-AG, Hirschberg, die Ostkraftwerk AG, Cosel / Oberschlesien (1928), die Stromversorgungs-AG Weißenfels-Zeitz, Theißen, und die Überlandwerk Oberschlesien AG, Neiße (1923). Eine weitere bedeutsame Beteiligung stellten seit 1925 die Braunschweigischen Kohlen-Bergwerke (BKB), Helmstedt, wegen ihres Kraftwerks Harbke dar.
Ferner waren die Elektrowerke seit 1931 bei der Berliner Kraft- und Licht AG engagiert, in die die Stadt Berlin zur Linderung ihrer Finanznot die Bewag eingebracht hatte. Um zu verhindern, dass die hauptstädtische Stromversorgung in private Hände gelangte, wurde die Hälfte der Aktien auf Anordnung der preußischen Regierung von der Stadt Berlin (47,5 %), den Elektrowerken und der im preußischen Besitz stehenden PreussenElektra (je 26,25 %) übernommen. [5] Diese sogenannten B-Aktien konnten im Gegensatz zu den frei verkäuflichen A-Aktien nur unter den drei Anteilseignern angeboten werden. Zu ihrer besseren Abstimmung schlossen sie sich 1932 in der Berliner Elektrizitäts-Union AG zusammen.
Der wirtschaftliche Ausbau der Elektrowerke AG ließ sich an den Betriebskennzahlen ablesen. So stieg die Bilanzsumme von 93,6 Mio. RM (1924) auf 293,9 Mio. RM (1931). [6] Das Aktienkapital, das gänzlich im Besitz der VIAG blieb, wuchs von 90 Mio. RM (1935) auf 170 Mio. RM (1945).[7]
Mit der Beteiligung an den Braunschweigischen Kohlen-Bergwerken stieß die Expansion der Elektrowerke nach Westen allerdings an ihre Grenze. Das benachbarte Gebiet wurde von der PreussenElektra dominiert. Mächtigster Rivale der Elektrowerke im Reich war jedoch das RWE. Beide Gesellschaften konkurrierten in der Weimarer Republik um die noch unaufgeteilten Versorgungsgebiete. Ebenso betrieben beide nebeneinander den Bau einer Verbundleitung in die Alpen, um die dortigen Wasserkräfte zu nutzen. Während die Elektrowerke dabei zur Errichtung ihrer sogenannten Nord-Süd-Leitung mit PreussenElektra und Bayernwerk zusammenarbeiteten, kooperierte das RWE mit der Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG (VEW), Dortmund, und dem Badenwerk. Eine bessere Abstimmung zwischen den deutschen Energieunternehmen sollte die im Mai 1928 gegründete Aktiengesellschaft für deutsche Elektrizitätswirtschaft, Berlin, herbeiführen, an der sich die großen deutschen Stromversorger, darunter die Elektrowerke, PreussenElektra und Bayernwerk, später auch das RWE, mit je 10 % beteiligten. In ihr fanden die beteiligten Unternehmen Ende der zwanziger Jahre einen Ausgleich über ihre geschäftlichen Interessensgebiete, den sogenannten Elektrofrieden.
Die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten brachte zunächst keine entscheidenden Veränderungen in der Unternehmensentwicklung der Elektrowerke. Vielmehr festigte das 1935 erlassene und bis 1998 gültige Energiewirtschaftsgesetz [8] die im Elektrofrieden abgesteckten Einflusssphären der Energieunternehmen. Zu einer Ausdehnung des Absatzgebietes gelangten die Elektrowerke erst in Folge der Annexion Tschechiens 1938 durch das Deutsche Reich. Noch im selben Jahr begannen sie mit Vollmacht des Reichswirtschaftsministers, die Elektrizitätswerk Ostböhmen AG zu übernehmen, ferner die Mährisch-Schlesischen Elektrizitätswerke AG und die Mittelmährischen Elektrizitätswerke AG. [9] Zudem wurden die dortigen Kraftwerke Parschnitz, Seestadtl, Strebowitz und Schreckenstein betrieben. [10]
Im Jahre 1949 erfolgte die Sequestrierung der im sowjetischen Sektor und in Ost-Berlin gelegenen Betriebsteile, die den größten Teil des Firmenbesitzes ausmachten. [11] Aus ihnen ging die Stromversorgung der DDR hervor, die nach dem politischen Wandel 1990 in die Vereinigte Energiewerke AG (VEAG) überführt wurde. Im Westteil Deutschlands bestanden die Elektrowerke dagegen als Teil der VIAG, München, fort. Die 1990 privatisierte Holding wurde im Jahr 2000 mit der VEBA, Düsseldorf, in der die ehemals preußischen Industriebeteiligungen zusammengefasst waren, zur E.on, Düsseldorf, fusioniert.
[1] Gesellschaftsvertrag vom 21. Mai 1915. Vgl. Handbuch der Deutschen Aktien-Gesellschaften, Bd. II, Berlin, Leipzig 1926, S.2274. Im Folgenden: Handbuch.
[2] Vorbesitzer und Übernahmejahr nach Handbuch, S.2274. Anders Richard Hamburger: Die Elektrizitätswirtschaft. Elektrowerke AG, Berlin 21930 (= Musterbetriebe dt. Wirtschaft, Bd.1), S.17.
[3] Vgl. Landesarchiv Berlin, A Rep. 250-03-07, Nr.206.
[4] Angaben für 1924 und 1932 nach Das Grünbuch der Aktiengesellschaften. Aufbau, Statistik und Finanzen. - Interessengemeinschaften und Konzerne, Bd. II, Berlin: Hoppenstedt 1932, S.1416 (Im Folgenden: Hoppenstedt), für 1934 nach Landesarchiv Berlin, C Rep. 105, Nr. 277/2.
[5] Vgl. Landesarchiv Berlin, A Rep. 250-03-07, Nr.25.
[6] Angaben nach Hoppenstedt, S.1416.
[7] Angabe für 1935 nach Hoppenstedt, S.1416, für 1945 nach Landesarchiv Berlin, C Rep. 105, Nr.277 / 2.
[8] Vgl. Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) vom 13. Dezember 1935, Reichsgesetzblatt I, S.1451.
[9] Vgl. Landesarchiv Berlin, A Rep. 250-03-07, Nr.31 und Nr.202.
[10] Zu den Kraftwerken vgl. Landesarchiv Berlin, A Rep. 250-03-07, Nr.206.
[11] Vgl. Landesarchiv Berlin, C Rep. 105, Nr. 277 / 2.
2. Bestandsgeschichte
Die Unterlagen der Elektrowerke AG wurden im Jahr 1995 von der Reichs-Kredit-Gesellschaft, die am letzten Sitz der Elektrowerke in Berlin ansässig war, dem Landesarchiv Berlin übergeben (Acc. 1092 / 95). Lediglich die Nrn. 1 - 15 wurden bereits zuvor vom Ost-Berliner Stadtarchiv verwahrt. Die Papiere waren überwiegend in Ordnern abgelegt, duplizierte Stromlieferungsverträge befanden sich in Klemmmappen. Ein Gliederungsverzeichnis lag nicht vor, obschon einzelne Akten unternehmenseigene ‚Archivsignaturen’ aufweisen.
Im Rahmen der Erschließung, die im Jahr 2002 stattfand, wurden die Papiere zunächst in säurefreies Material umgebettet. Sodann erfolgte die Verzeichnung mittels Augias 7.2 nach Bär’schem Prinzip. Wegen des fehlenden früheren Ordnungszustandes, der auch durch die gelegentlichen Archivsignaturen nicht rekonstruiert werden konnte, wurde hierzu eine dem Bestand angemessene Klassifikation erarbeitet. Sie diente als Grundlage der Erschließung, bei der sämtliche Unterlagen einschließlich der ersten 15, bereits auf Karteikarten verzeichneten Akten erfasst wurden. Eine Kassation erfolgte mit Ausnahme eines Ordners mit älteren Rechnungsbelegen nicht. Der Bestand umfasst nunmehr insgesamt 260 Nummern (ca. 3,30 lfm). Seine Laufzeit reicht von 1894 bis 1988, wobei der Schwerpunkt in den 1920er bis 1940er Jahren liegt.
Für die fehlenden Datierungen wurde in eckigen Klammern die Laufzeit des Gesamtbestandes gesetzt [1894 - 1988], damit in der elektronischen Recherche, bei Datierungseingrenzungen, der Bestand mit recherchiert werden kann.
Der Bestand ist wie folgt zu zitieren:
Landesarchiv Berlin, A Rep. 250-03-07 Elektrowerke AG, Nr. ...
3. Schwerpunkte des Bestandes
Der überwiegende Teil des Schriftguts beinhaltet Unterlagen zur Energieerzeugung und -versorgung. Mit Blick auf die Betriebsanlagen sind hier besonders Materialien zu einzelnen Kraftwerken zu nennen, namentlich Lauta, Trattendorf und Seestadtl. Bergbauspezifische Akten betreffen zumeist abbaurechtliche Fragen. Darüber hinaus ist der Ausbau der stromwirtschaftlichen Infrastruktur durch zahlreiche Verträge und Genehmigungen zur Leitungsführung von Starkstromleitungen und zur Anbindung von Privateisenbahnen an das Netz der Reichsbahn gut dokumentiert. Die umfangreichste Einzelgruppe innerhalb des Bestandes machen jedoch die Stromlieferungsverträge der Elektrowerke mit zahlreichen öffentlichen und privatwirtschaftlichen Abnehmern, aber auch Anbietern aus. Sie zeigen, wie flächendeckend die Elektrowerke Mittel- und Ostdeutschland, seit 1938 auch Teile Tschechiens mit Strom versorgten. In Verbindung mit Unterlagen zu einzelnen Beteiligungen, die ebenfalls teilweise vorliegen, spiegeln sie ansatzweise die Verflechtung in der deutschen Energiewirtschaft wider.
Unterlagen der Geschäftsführung sind dagegen fast ebenso wenig überliefert wie Schriftgut von der und über die Konzernmutter VIAG. Lediglich technische, energiewirtschaftliche und Finanzberichte des Arbeitsausschusses des Aufsichtsrats aus den Jahren 1943 / 44 vermitteln offensichtlich einen tieferen Einblick in die Tätigkeit des Elektrowerke-Vorstands. Gleichfalls finden sich Eingriffe staatlicher Stellen nur selten, zumeist abgelegt bei Stromlieferungsverträgen oder Unterlagen über Beteiligungen. Personalwirtschaftlich liegt allein eine Akte vor. Sie betrifft einen Prokuristen der Überlandwerk Oberschlesien AG, dem 1943 / 44 widerrechtlicher Handel mit bewirtschafteten Lebensmitteln vorgeworfen wurde.
4. Korrespondierende Bestände
LAB A Rep. 256 Berliner Städtische Elektrizitätswerke AG (Bewag)
LAB C Rep. 620 VVB Verbundwirtschaft
LAB C Rep. 797 VVB Energieversorgung
5. Literatur- und Quellenverzeichnis
Hamburger, Richard: Die Elektrizitätswirtschaft. Elektrowerke AG, Berlin 21930 (= Musterbetriebe deutscher Wirtschaft, Bd.1).
Pohl, Manfred unter Mitarbeit von Andrea H. Schneider: VIAG Aktiengesellschaft 1923 - 1998. Vom Staatsunternehmen zum internationalen Konzern, München, Zürich 1998.
Stier, Bernhard: Staat und Strom. Die politische Steuerung des Elektrizitätssystems in Deutschland 1890 - 1950, Ubstadt-Weiher 1999 (Mannheim, Habil. 1997).
Berlin, im April 2002 Michael Klein
- Bestandssignatur
-
A Rep. 250-03-07
- Kontext
-
Landesarchiv Berlin (Archivtektonik) >> A Bestände vor 1945 >> A 6 Unternehmen der Wirtschaft >> A 6.2 Unternehmen der privaten Wirtschaft
- Verwandte Bestände und Literatur
-
Verwandte Verzeichnungseinheiten: LAB A Rep. 256 Berliner Städtische Elektrizitätswerke AG (Bewag)
LAB C Rep. 620 VVB Verbundwirtschaft
LAB C Rep. 797 VVB Energieversorgung
- Bestandslaufzeit
-
1894 - 1988
- Weitere Objektseiten
- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs
- Rechteinformation
-
Für nähere Informationen zu Nutzungs- und Verwertungsrechten kontaktieren Sie bitte info@landesarchiv.berlin.de.
- Letzte Aktualisierung
-
22.08.2025, 11:21 MESZ
Datenpartner
Landesarchiv Berlin. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Bestand
Entstanden
- 1894 - 1988