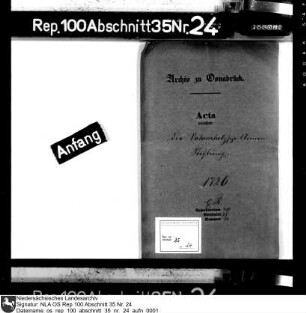Archivale
Auseinandersetzung um Zahlungsverpflichtungen an die Monheimische Armenstiftung in Köln
Enthält: Ende der 1620er Jahre war es anscheinend zu Unstimmigkeiten über Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde zu Kerpen an die Monheimische Armenstiftung in Köln gekommen. Die Forderungen beruhten auf drei Rentbriefen aus dem 16. Jahrhundert: 1. auf einer Obligation vom 9.1.1560 über 10 Malter Roggen, die die Gemeinde für 200 Goldgulden von Heinrich Schildt, Bürger zu Köln, und seiner Frau Magdalena Ringdorffs erworben hatte (Nr. I,6 und Nr. I,1), 2. auf einer Kapitalaufnahme von 60 JoachimsTlr für 3 JoachimsTlr jährlichen Zins die Giell Kremer und seine Frau Lutger [Luitgard] ebenfalls von Heinrich Schildt und Magdalena Ringdorffs am 14.10.1561 erworben hatten (Nr. I,4 und I,6); die Käufer setzten ihr Haus am Markt in Kerpen als Unterpfand ein (Nr. I,4). 3. auf einem weiteren Rentbrief von Godtfried Taxis und Magdalene von Volden vom 20.11.1589 über 9 Tlr (à 52 Albus) (Nr. II,1) Die ersten beiden Verpflichtungen waren über den Sohn Heinrichs, Wilhelm Schild, an Dr. med. Bernhardt Cronenberg zu Köln und Magdalene von Volden gekommen, die auch den dritten Brief hielt. Nach dem Tod des Ehepaares erbte die einzige Tochter Catharina Cronenberg und ihr Mann, Dr. med. Henrich Stapedius, ebenfalls Bürger in Köln, die Obligationen. Er verkaufte sie am 28.9.1613 an die von Anna von Niell, Witwe des Peter von Monheim, eingesetzte Armenstiftung (Nr. I,6). Offensichtlich kam im Laufe der Zeit die Gemeinde ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nach. Daher reduzierte am 10.2.1629 der damalige Provisor der Stiftung, Heinrich Hardenrath, die Rente über 10 Malter Roggen auf einen jährlichen Zins von 10 Goldgulden. Aber auch die Zahlungen für den Rentbrief über drei JoachimsTlr blieben seit 1614 aus. Deshalb beauftragen die Provisoren Henrich Hardenrath und Johannes Krebs den Lizentiaten Theodor Kaldenbach, das Unterpfand gerichtlich einzufordern (Nr. I,2 Vollmacht vom 18.12.1628). Am 19.3.1629 bringt Kaldenbach die entsprechende Klage gegen Anna Lyscano, die jetzige Besitzerin des Hauses vor (s. Nr. I,24). Die Beklagte bestreitet jedoch die Zahlungsverpflichtung. Aus diesem Prozess, der sich von 1629-1636 hinzog, besteht der Hauptteil der Aktenüberlieferung. Die Beklagte beruft sich auf Verjährung der Forderungen. Das weisen die Kläger aber zurück: Die Beklagte müsse vielmehr die 40 Jahr lange Nichtzahlung der Rente beweisen. Es nütze ihr auch nicht die Behauptung, dass die verschriebene Rente beim Verkauf des Hauses verschwiegen worden sei. Die Rentbriefe, die die Stiftung in Händen halte, seien "uncancellirt" (d. h. nicht durchgestrichen), also noch gültig, und die Zahlungsverpflichtung bis 1613, d. h. bis zur Übergabe durch Dr. Stapedius, 37 Jahre lang im Besitz der Familie Cronenberg gewesen. Daher fordern sie den Umschlag (d. h. die Entschädigung mit dem Unterpfand) auch erst ab diesem Datum, also für 15 oder 16 Jahre. Als Unfug bezeichnen sie, dass die Beklagte beispielhaft für ein Urteil in ihrem Sinne einen Prozess Johann Lintz ./. Adolff Groven anführt, bei dem Groven, weil - im Gegensatz zu ihnen - Lintz keine Urkunden und kein "heben und bueren" [d. h. Nachweise für einen verbrieften oder ersessenen Besitz] hatte vorbringen können, von seiner Forderung absolviert wurde (Nr. I,1). Die Beklagte weist die Beweispflicht aber zurück und beruft sich dabei auf den Kauf durch ihren Vater. Der Transport der Rente auf die Armenstiftung sei für sie daher auch unwesentlich und "nit praejudicirlich" (Nr. I,3 Duplik 8.1.1630). In der Triplik darauf (Nr. I,5, 19.2.1630) halten die Kläger der Beklagten zwei Tatsachen entgegen, nämlich dass das Gericht den Besitz der Cronenbergs über 37 Jahre anerkannt hat und dass Anna Lyscanos Vater schon vor 1614 von einem Abgesandten aus Köln zur Zahlung der Rente für die Hauptsumme von 60 Rtlr ermahnt worden sei. Das erste könnten die Schöffen, das zweite Peter Eßer bezeugen, der dafür als Zeuge zugelassen werden soll. Zum Beweis legen sie eine Kopie über die Transaktion der Verschreibung auf die Monheimische Armenstiftung von 1613 vor (Nr. I,6). Ihre Argumentation konzentriert sich nun im wesentlichen auf zwei Punkte: die Beweispflicht der Nichtzahlung durch die Beklagte und der ihrerseits erbrachte Nachweis des Besitzes ("Possession, Heben und Büren") durch ihre Vorgänger (Nr. I,7, 4.6.1630). Verwirrung stiftet dann ein am gleichen Sitzungstermin von Anna Lyscano eingebrachter Protokollauszug vom 21.4.1592 über einen Prozess zwischen Reinhardt von Dalen und Johann Lyscano, Annas Vater, anlässlich des Verkaufs des Hauses. Lyscano wird darin zur Zahlung der restlichen Kaufpfennig verpflichtet, da von Dalen die Schuldverschreibung auf das Haus laut Vereinbarung im Kaufbrief, "dem Geldern abzuschaffen oder zu lieberen", geregelt habe ("mit Recht abgestalt") (Nr. I,8). In ihrer Antwort darauf weisen die Provisoren die dadurch angeblich belegte Aufhebung der Schuldverschreibung (Cassation) mit Bezug auf ihre älteren (1565 !) und jüngeren (1613) Dokumente als unwirksam zurück, zumal die Beklagte den Kaufbrief nicht vorgelegen habe (Nr. I,9 und 10, 15.10.1630). Es könne sich also bestenfalls um eine zwischenzeitliche Kassation handeln, die durch die Anerkennung der Zession 1613 revidiert worden sei. Sollte sie aber jetzt berücksichtigt werden, sei das Gericht zum Schadensersatz für die dadurch den Armen entgangenen Gelder verpflichtet. Das Gericht fühlt sich durch den Vorwurf der Provisoren angegriffen, es habe durch die Hineinnahme des Protokolls die Rechte der Armen verletzt (Nr. I,11 und 12), und es soll ein Beschluss zur Wiederherstellung der Reputation des Gerichts, insbesondere Theodor Schreibers und Conradt Jaixens, die 1613 als Schöffen bei der Übertragung der Rente dabei waren, gefasst werden, "qui multum terreret adversarios, ne tam facile absque ratione taxarent Judices" [..., damit sie nicht so leicht unbegründeterweise das Gericht abschätzig behandelten]. Der Anwalt der Stiftung soll so lange da bleiben, bis er seine Behauptung bewiesen ("verificirt") habe und versichere, dass er sich dem Recht ("koningliche Interesse") und Urteil stelle und es befolge ("judicatum solvi"). Der Anwalt Lyscanos verteidigt natürlich die Gültigkeit der Ablöse (Nr. I,13). Dies bleibt der Hauptstreitpunkt in den nächsten Monaten (Nr. I, 14-17), bis die Kläger am 23.9.1631 einer Aktenversendung und Begutachtung durch einen unparteiischen Richter zustimmen (Nr. I,18). Die Zusammenstellung der Akten zieht sich dann allerdings hin. Am 15.11.1633 monieren die Kläger, dass die Akten erst kürzlich vom alten Gerichtsschreiber zurückgekommen und einige Gerichtstage seither verstrichen seien. Nun wollten sie aber die Akten präsentieren und auch die Gebühren in doppelter Höhe ("duplices sportulas") unter Vorbehalt der Rücknahme beilegen. Denn zum einen müssten erst die Verschreibungen, die von verschiedenen Händen geschrieben seien (eine davon wird als die des Adolph Newenhaußen identifiziert), miteinander verglichen werden. Und zum anderen sei noch nicht, wie sie zuvor beantragt hätten, für die minderjährige Tochter von Anna Lyscano ein Vormund oder Kurator bestellt worden. Man wolle schon wegen der hohen Kosten jetzt keine Verzögerung mehr dulden (Nr. I,19). Am 13.12. wiederholt Ihr Anwalt noch einmal ausführlich den Antrag auf Bestellung eines Vormunds für die Tochter Lyscano, von der man nicht weiß, ob sie inzwischen die Volljährigkeit erreicht habe, ob sie überhaupt noch lebe oder - wie ihre Mutter behaupte, auswärtig wohne (Nr. I,20). Am 13.6.1634 legt Kaldenberg dann eine Rechnung für die bisherigen Kollationierungskosten vor, erscheint aber 3 Wochen später vor dem Notar Matthias Woipolor, um sich über Unstimmigkeiten bei der Abschrift durch den Gerichtsschreiber Hendrich Kratzmecher zu beschweren (Nr. I,22). Am 27.3.1635 soll endlich das Urteil verkündet werden. Doch die Provisoren haben am 24.3. offensichtlich noch keine Kopie des entsprechenden Dekrets erhalten. Caspar von Hardenrath als Wortführer beschwert sich außerdem, dass die Beklagte ihre Akten noch nicht vollständig eingereicht hat (Nr. I,23). In den folgenden Tagen erfolgt aber dennoch die Urteilsverkündung, und Anna Lyscano obsiegt. Noch bevor die Gegenseite Appellation einlegt (Praesentatum 5.6.) (Nr. I,25), reicht Anna Lyscano am 24.4. die Gerichtskostenrechnung ein (Nr. I,24). Das Hohe Gericht zu Limburg verweist die Sache an den Drossart Heinrich Bilderbeck. Wie sich die Sache dann entwickelt, ist nicht überliefert. Aus der weiteren Aktenüberlieferung ist immerhin zu belegen, dass inzwischen, 1633 und 1634, offensichtlich die Gemeinde einen Teil ihrer Schulden beglichen hatte (Nr. III,2 und 3). Dennoch müssen in den folgenden Jahren die Zahlungen immer wieder angemahnt werden. 1640 beschweret sich der Provisor Hermann Cron, dass für den Rentbrief Nr. 1 im Jahr 1634 nur 11 Tlr 28 Albus 6 Heller und 1635-1639 gar nichts bezahlt worden sei, so dass ein Rückstand von 50 GG 11 Tlr 28 Albus 6 Hellern aufgelaufen war. Aus der Verschreibung von 1589 (3) resultierte aus den Jahren 1629-1639 eine Schuld von 99 Tlr (Nr. II,1 und 2). Auch 1643, 1650 und 1685 muss die Gemeinde zur Zahlung erst aufgefordert werden. Quittungen sind vorhanden für die Jahre 1643/44, 1648, 1651 und 1655 (Nr. III, 4-7).
- Reference number
-
GerKer, 1216
- Extent
-
Schriftstücke: 26+5+7
- Context
-
Schöffengericht Kerpen >> 1 Zivilsachen >> 1.1 Forderungen - Geld / Sachen
- Holding
-
GerKer Schöffengericht Kerpen
- Date of creation
-
1629 - 1636, (1633-1685)
- Other object pages
- Delivered via
- Last update
-
05.11.2025, 3:54 PM CET
Data provider
Stadtarchiv Kerpen. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Archivale
Time of origin
- 1629 - 1636, (1633-1685)